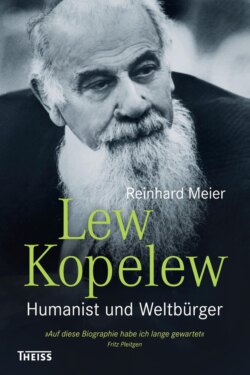Читать книгу Lew Kopelew - Reinhard Meier - Страница 28
Stalins hypnotische Wirkung
ОглавлениеJewgenij Sacharow, der Leiter einer Menschenrechtsorganisation im heutigen Charkiw, nennt in einer Analyse der ukrainischen Hungerkatastrophe von 1932/33 vier Hauptverantwortliche für diese Tragödie, die der Autor aufgrund differenzierter Abwägungen als Genozid einstuft: Josef Stalin als ideologischen Kopf dieses Vernichtungsfeldzugs, die Politbüro-Mitglieder Lazar Kaganowitsch, Wjatscheslaw Molotow und den ukrainischen Parteiführer Pawel Postyschew als seine wichtigsten Henkersknechte.61 Mit allen vier dieser mächtigen Sowjetgrößen setzt sich Kopelew in seinen Jugenderinnerungen auseinander, am ausführlichsten mit Stalin, dem späteren Generalissimus, der sich ab den 30er-Jahren als unumschränkter Diktator etablierte.
In einer Rede auf einer Plenarsitzung des KP-Zentralkomitees im Januar 1933, so schildert es Kopelew, sprach Stalin ausführlich über die Kollektivierung der Landwirtschaft und die Getreidebeschaffung in der Ukraine, erwähnte aber die damals bereits ausgebrochene Hungersnot mit keinem Wort.62 Zwar räumte er ein, dass es in der Landwirtschaft Schwierigkeiten gebe und dass man die Kolchose wohl überschätzt und idealisiert habe. Auch habe sich die Führung in Moskau ein wenig zu sehr auf die „Leninsche Härte und Scharfsichtigkeit der Funktionäre vor Ort“ verlassen. Daraus zog Stalin in der erwähnten Rede den Schluss, die Partei müsse nun die Leitung der Kolchose noch enger an die Hand nehmen und konsequent zentralisieren, „sie muss in alle Details des Kolchoslebens eindringen“. Weil sie dies bisher nicht getan habe, „regieren in den Kolchosen ehemalige weißgardistische Offiziere, ehemalige Petljura-Leute63 und sonstige Feinde“.
„Die hypnotisierend hartnäckige Wiederholung einfacher Worte und Wortgruppen war eine Besonderheit der Stalinschen Reden, ebenso der klare, katechismushafte Aufbau: Frage – Antwort; Ursache – Folge; Prämisse – Schlussfolgerung und Aufzählung der nummerierten Thesen“, so charakterisiert Kopelew diesen Stil. Außerdem führt er die „psalmodierende Monotonie“ von Stalins Reden, den „Wechsel von ‚Demut‘ und dogmatischer Inbrunst und das ständige Bemühen ‚Satans Ränke‘ aufzuspüren (also die der Feinde, Trotzkisten, Kulaken u.a.m.)“ auf Stalins jugendliche Erfahrungen als Zögling in einem georgischen Priesterseminar zurück.
Die Behauptungen über das Eindringen von Feinden in die Kolchosen oder über die ungenügende Wachsamkeit der Behörden, schreibt Kopelew weiter, seien in Stalins Reden, geschmückt mit Lenin-Zitaten, „immer nachdrücklicher, wuchtiger und monotoner“ geworden – „wie Beschwörungen eines Schamanen“. Dies wiederum habe zu einer „epidemischen Psychose“ geführt, der Verfolger wie Verfolgte erlagen. „Innerhalb von drei bis vier Jahren wurde dieser Wahn zu einem integrierenden Bestandteil unseres gesellschaftlichen Seins ebenso wie unseres täglichen Daseins.“ Über das Wesen von Stalins terroristischer Herrschaftspraxis und die Gründe für seine jahrelange hypnotische Wirkung auf weite Teile der Sowjetbevölkerung inklusive die Mehrheit unter so hellwachen Köpfen wie Lew Kopelew – darüber wird sich der Autor dieser Erinnerungen im Rückblick noch öfter quälende Gedanken machen. Als betagter Beobachter im unfreiwilligen deutschen Exil hat Kopelew in einem „Spiegel“-Essay Stalin und Hitler als „feindliche Brüder“ bezeichnet.64
Molotow und Kaganowitsch, Stalins enge Politbüro-Kumpanen und direkt an der Kollektivierungs-Kampagne in der Ukraine beteiligt, hat der junge Betriebs-Journalist Kopelew persönlich erlebt, als sie im September 1932 die Charkower Lokomotivenfabrik besuchten und dabei auch über die Getreidebeschaffung sprachen. Der spätere Außenminister Molotow machte auf ihn keinen großen Eindruck. Er beschreibt ihn als „gelblich-fahle“ Figur, der jedes Mal stotterte, wenn er den Namen Stalins aussprach, was häufig vorkam.
Kaganowitsch, der selbst in der Ukraine aufgewachsen war und einer jüdischen Arbeiterfamilie entstammte, wird als „jovial“ geschildert, bei seinem Auftritt habe er die „langgeübte Rolle des übermüdeten, aber dennoch ‚flammenden Agitators‘ und guten Kumpels“ gespielt. Kaganowitsch und Molotow gehörten übrigens zu den wenigen Vertrauten und Handlangern Stalins, die innerparteilich sämtliche Säuberungswellen heil überlebten. Sie wurden vier Jahre nach dem Tod des Despoten (1953) zwar von Chruschtschow entmachtet, doch war ihnen ein langes und unbehelligtes Pensionärsdasein in Moskau vergönnt.
Nach dem Kollaps des Sowjetregimes sind 1996 in Moskau Kaganowitschs fast 600-seitige Memoiren erschienen – eine durchgehende Verherrlichung der stalinistischen Herrschaft, geschrieben in der bürokratisch-hölzernen Manier eines Sowjet-Apparatschiks.65 Molotow lebte, ebenso wie Kaganowitsch und Malenkow (und später Chruschtschow), noch viele Jahre geruhsam in einer Regierungsdatscha bei Schukowka außerhalb Moskaus, wo Kopelew nach seiner Freilassung aus dem Gulag zusammen mit seiner zweiten Frau Raissa Orlowa ab der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre jeden Sommer in einer gemieteten Datscha-Wohnung verbrachte.66
Ein komplizierteres Verhältnis hatte Lew Kopelew zum ukrainischen Parteiführer Pawel Postyschew, dem vierten Hauptverantwortlichen für die Hungerkatastrophe von 1932/33. Der junge Aktivist Kopelew war begeistert von dessen ungekünsteltem, gradlinigem Auftreten. Über Postyschew, schreibt Kopelew in seinen Erinnerungen, seien Anfang der 30er-Jahre in der Ukraine Geschichten wie über Harun al-Raschid im Umlauf gewesen. So hieß es, dass der mächtige Postyschew in Läden und Kantinen in der Schlange und in Vorzimmern mit Bittstellern zusammenstehe. Auf dessen Vorschlag hin seien in vielen Fabrikabteilungen in der Ukraine Kaffeestuben eingerichtet worden, wo Soja-Kaffee und Soja-Gebäck mit Sacharin gesüßt ohne Lebensmittelkarten erstanden werden konnten. „Diese Süßigkeiten … und weiße Tischchen vor dem Hintergrund dunkler verräucherter Fabrikhallen erschienen uns wie lebende Beispiele des Sozialismus, ebenso die neuen Selterswasser-Behälter in den Gießereien und Schmieden – gratis für die Kumpel.“67
Doch anders als Molotow und Kaganowitsch überlebte der populäre ukrainische Parteigewaltige die Stalinschen Säuberungen nicht. Er wurde 1939 verhaftet und kurz darauf erschossen. 1956 wurde Postyschew posthum rehabilitiert. Kopelew glaubte lange Zeit, Postyschew sei umgekommen, weil er sich gegen die blutigen Exzesse Jeschows, des Organisators des Großen Terrors im Jahre 1937, eingesetzt habe. Postyschew erschien dem jungen Kopelew, da er ihn bei Auftritten mehrfach erlebt und dessen offene Briefe gelesen hatte, „wie einer der letzten aus Lenins Garde, wie ein Held, der ganz im Widerspruch zu Stalin, Molotow, Kaganowitsch, Berija und den vielen anderen prinzipienlosen, machthungrigen, eigennützigen und grausamen ‚Stalin-Priestern‘ stand“.
Durch spätere Informationen kamen ihm aber vermehrt Zweifel an Postyschews Aufrichtigkeit und Uneigennützigkeit. Er stieß auf Indizien einer zunehmenden Anpassung und sklavischen Demut gegenüber dem „blutdürstigen Paranoiker“ Stalin. Eine objektive Deutung von Postyschews Schicksal sei für ihn ebenso schwer möglich wie für die Schicksale von Kirow oder Bucharin, Ordschonikidse oder Kamenew, Smirnow oder Litwinow „und all jener Bolschewiki, von denen ich auch heute mit Überzeugung sagen kann, dass jeder von ihnen anfangs ein opferwilliger Revolutionär war …“ Dennoch hätten später alle mitgeholfen, „dass die Revolution, erträumt und begonnen zur Befreiung des Volkes, zur Schaffung eines demokratischen und sozialistischen Gesellschaftssystems, zur Konterrevolution wurde, eine neue Autokratie herbeiführte, neue Sklaverei und so unendliche Not“, schreibt Kopelew Jahrzehnte später in seinen Erinnerungen.
Neben der erwähnten massenhaften Beschlagnahmung von Saatgut bei den ukrainischen Einzelbauern und selbst in den Kolchosbetrieben spricht ein weiterer Aspekt der Hungerkatastrophe in den Jahren 1932/33 dafür, dass Stalin und seine Schergen diese Tragödie zur Zerschlagung der widerstrebenden Bauernschaft gezielt planten oder zumindest skrupellos in Kauf nahmen: Auch während der beiden schlimmsten Hungerjahre wurde der umfangreiche sowjetische Getreide-Export ins Ausland unvermindert fortgesetzt. Timothy Snyder macht in seinem faktenreichen Buch „Bloodlands“ geltend, Stalin hätte Millionen in der Ukraine und anderen Hungergebieten retten können, wenn er nur die Nahrungsmittel-Exporte für wenige Monate hätte aussetzen lassen oder drei Millionen Tonnen staatliche Getreidereserven freigegeben hätte. „So einfache Maßnahmen hätten noch im November 1932 die Opferzahl bei Hunderttausenden statt bei Millionen halten können. Stalin setzte keine davon in Gang“, argumentiert Snyder.68