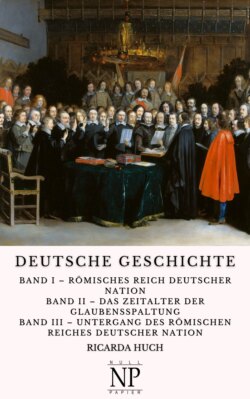Читать книгу Deutsche Geschichte - Ricarda Huch - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Bischöfe
ОглавлениеWährend der Kriege Karls des Großen mit den Sachsen schickte die altbritische Kirche Missionare an die deutsche Küste; einer von ihnen war Willehad, den Karl der Große im Jahre 787 in Worms zum Bischof machte. Zu seinem Wohnsitz wählte er ein Dorf, das Bremen hieß, wo er auch, als er zwei Jahre später starb, bestattet wurde. Erst sein Nachfolger Willerich erhielt zum Bischofstitel ein Bistum, das dem Erzbischof von Köln unterstellt wurde. In Nordalbingien, dem Niederelbeland, gab es damals zwei Kirchen, die eine war in Hamburg und gehörte zu Bremen, die andere war in Meldorf im Dithmarschen und gehörte zu Verden. Sehr, sehr langsam befestigte sich bei den Sachsen und Friesen, die die Gegend der unteren Weser und Elbe bewohnten, das Christentum; an eine weitere Ausbreitung desselben nach dem skandinavischen Norden konnte erst nach dem Tode Karls des Großen gedacht werden. Der Anlass dazu ging von Dänemark aus, da König Harald sich mit seinem Gefolge in Mainz taufen ließ; Kaiser Ludwig selbst war sein Taufpate. Als er den Wunsch äußerte, einen Geistlichen mitzunehmen, der den Gottesdienst ausübe und das Volk bekehre, und nach einem Manne gesucht wurde, der sich dazu eignete und bereit erklärte, meldete sich der, den man an erster Stelle nennen muss, wenn man von großen Bischöfen erzählen will, Ansgar, damals Mönch im Kloster Korvey. Schon in dem Kinde, das der Vater dem Kloster Corbie dargebracht hatte, wirkte das Feuer genialer Begabung. Jungenhafte Ausgelassenheit wechselte ab mit schmerzlicher Sehnsucht nach der früh verlorenen Mutter. Einmal erschien ihm die Heilige Jungfrau und zeigte ihm die Geliebte im Chor der Seligen wandelnd; wenn er nicht fleißig und fromm werde wie sie, sagte sie, werde er nicht zu ihr kommen. In seinem 13. Jahre erfuhr er eine starke Erschütterung durch den Tod Karls des Großen. So mächtig war die Zauberkraft, die der große Kaiser ausstrahlte, dass für den im Kloster aufgewachsenen Knaben die Erde zu beben schien, die der Heros verlassen hatte. Aus der schwankenden Seele des Knaben stiegen wieder Visionen auf: Petrus und Johannes traten zu ihm und führten ihn in das himmlische Licht und dann in die undurchdringliche Finsternis des Fegefeuers, wo er drei Tage blieb, die wie drei Jahrtausende waren. Dann wieder in ein Meer unendlichen Glanzes, das die Chöre der Seligen erfüllten. »Ihn aber sah ich nicht. Und doch war Er in allen und alle in Ihm. Er umgab alle äußerlich. Er lenkte alle innerlich. Er stützte alle von oben her und stützte sie von unten. Da erging zu mir eine süße Stimme, süßer denn irgendein denkbarer Klang, die schien das All der Welt zu erfüllen, und sprach zu mir: Gehe hin, und mit der Märtyrkrone wirst du wiederkehren.« Aus diesem inneren Aufruhr ging Ansgar reif, mit dem Bewusstsein eines hohen Zieles hervor. Bald darauf wurde durch Adalhard, den Abt von Corbie, der als Sohn einer sächsischen Mutter das Christentum in Sachsen zu verbreiten suchte, das Kloster Korvey in der Wesergegend gegründet. Adalhard selbst begab sich im Jahre 823 mit einigen Mönchen, unter denen Ansgar war, in die entlegene Waldwildnis. Trotz seiner Jugend wurde Ansgar bald Vorsteher der Schule und Prediger der Gemeinde, das heißt, dass er in der Landessprache predigte.
Als die Frage der Mission in Dänemark sich erhob, führte man Ansgar nach Ingelheim, wo der Kaiser sich aufhielt, und gab ihm zu bedenken, mit welchen Gefahren die Bekehrung des heidnischen, barbarischen Volkes verbunden sei. Während er allein in sich versunken sein Schicksal bedachte, mögen ihn abwechselnd Bilder des liebgewonnenen Lebens im Kloster und erhabene Gesichte bedrängt haben, die ihm jenseits der Wolken die Märtyrkrone zeigten. Nun sie sich auf ihn herabsenkte, sah er die blutigen Dornen, und es graute ihn. Er hatte sich eben entschlossen, als Antbert, ein Freund aus dem Kloster Corbie, zu ihm trat, ein vornehmer junger Mann, der zum Nachfolger des Abtes ausersehen war, und sagte: Wenn du gehst, gehe ich mit dir. Antbert ertrug die Strapazen der Reise nicht, erkrankte, wurde nach Korvey gebracht und starb dort. Nachdem Ansgar in Schleswig eine Schule errichtet hatte, wurde ihm die Mission in Schweden aufgetragen, wo er das altberühmte Sigtuna am Mälarsee, den von Odin begründeten Ursitz der schwedischen Könige, und den heiligen Hain und goldenen Tempel von Uppsala mit den Bildern der Götter Odin, Tor und Freyr kennenlernte. Er hatte das Glück, dass der Ortsvorsteher der eine Tagereise von Uppsala entfernten großen Handelsstadt Birka sich zum Christentum bekehren ließ und auf seinem Gut eine Kirche baute und dass dieser Mann, der wirklich im Herzen für die neue Lehre gewonnen war, auch nach Ansgars Abreise an ihr festhielt.
Zum Zwecke der Bekehrung der nordischen Länder wurde nunmehr, im Jahre 831, ein Erzbistum gegründet und Ansgar übertragen, dessen Sitz Hamburg sein sollte, und dessen Ausstattung dadurch zustande kam, dass die Erzbischöfe von Bremen und Verden auf einen Teil ihrer nordalbingischen Diözese verzichteten. Erzbischof Drago von Reims, ein natürlicher Sohn Karls des Großen, weihte Ansgar zum ersten Erzbischof von Hamburg. Die Verbindung Hamburgs mit Bremen veranlasste 14 Jahre später ein Überfall der Wikinger, der Hamburg gänzlich zerstörte. Es war zur Stunde der Abenddämmerung, als 600 Schiffe bei der wehrlosen Stadt landeten; denn der Graf des Gaus, zu dem Hamburg gehörte, war abwesend. Ansgar rief wohl zusammen, was an waffenfähigen Männern da war; aber es war zu spät, um mehr als das Leben und einige Reliquien zu retten. Die wohl ganz aus Holz gebaute Stadt lag in Asche, als der Sturm vorübergebraust war.
Es war nicht so, dass die Dänen und Schweden durch Ansgars Predigt Christen geworden wären; aber alle, die mit ihm in Berührung kamen, gewannen den Eindruck eines großen und guten Menschen. Man glaubte leichter an den allmächtigen Vater im Himmel, wenn ein Mann ihn verkündete, auf dessen Antlitz, wie es von Ansgar heißt, Adel und Hoheit leuchteten, der den Großen Ehrfurcht, den Niedrigen Vertrauen, den Bösen Scheu einflößte. Besonders bemerkenswert war seine Tätigkeit unter Armen und Kranken; es wird hervorgehoben, dass er, wo er Notleidende traf, nicht nur half, sondern sofort half. Dem Fehler des Hochmuts, in den er zuweilen zu verfallen fürchtete, wirkte er durch Handarbeit entgegen, namentlich beschäftigte er sich mit dem Stricken von Netzen. Überhaupt verlangte er von den missionierenden Priestern, dass sie sich Kleidung und Nahrung durch Handarbeit selbst verdienten. Wenn er gelegentlich einer Krankenheilung, da das Volk ihn als Wundertäter verehrte, sagte, Gott möge ihn des einen Wunders würdigen, einen guten Menschen aus ihm zu machen, bekannte er sich zu der Auffassung, dass erst die Güte des großen Mannes Vollendung ausmache. Ansgar starb im Jahre 865.
Den heiligen Ulrich von Augsburg hat hauptsächlich sein heldenhaftes Verhalten beim Einfall der Ungarn berühmt gemacht. Als die gefürchteten Wilden in großen Massen heranzogen und Augsburg belagerten, das damals ganz ungenügend durch niedrige Mauern befestigt war, wollten die Ritter, seine Vasallen, die er in der Stadt versammelt hatte, dem Feinde entgegengehn; Ulrich verbot das und ließ die Tore gut verrammeln. Das Glück der Belagerten wollte, dass ein Führer der Ungarn fiel, worauf sie sich klagend ins Lager zurückzogen. Die dadurch gewonnene Zeit benutzte der Bischof, während der Nacht die Mauer verstärken zu lassen und Gebete anzuordnen. Nach kurzem Schlaf erhob er sich bei Tagesgrauen, feierte die Messe und reichte allen das Abendmahl. Noch hatte der Sturm nicht begonnen, als der herannahende Entsatz durch den König gemeldet wurde. Während des Kampfes war Ulrich mitten im Getümmel, hoch zu Ross, ungerüstet, mit der Stola bekleidet.
Bischof Benno von Osnabrück, ein Schwabe, stammte, eine bemerkenswerte Ausnahme, von nichtadligen Eltern ab; begütert aber waren sie, denn sie pilgerten, um ihrer Kinderlosigkeit abzuhelfen, nach Rom und opferten am Grabe des Apostels ein silbernes Kind, worauf ihnen ein Knabe geschenkt wurde. Er wurde in Straßburg und in der Reichenau erzogen und lernte auf seinen Wanderungen viele Teile Deutschlands und viele Menschen kennen; seine mannigfache Begabung und ungewöhnliche Persönlichkeit machten auf ihn aufmerksam. Beim Bau des Domes von Speyer tat er sich durch seine Kenntnisse hervor: er ließ den Dom, der zu nah am Rheine gebaut war, auf eine neue und schwierige Art durch Mauern gegen Unterspülung sicheren. Ebenso war er Leiter beim Bau der Burgen, durch welche die salischen Könige das Sachsenland unterwerfen wollten. Als Lehrer an der Domschule von Hildesheim glänzte er in der Wissenschaft, auf einem Kriegszuge gegen die Ungarn sorgte er erfinderisch für die Verpflegung des Heeres, in der Landwirtschaft und Viehzucht besaß er ungewöhnliche Kenntnisse, als Bischof von Osnabrück stellte er durch Entsumpfung brauchbare Wege her. In der aufgewühlten Zeit Heinrichs IV. war er unentwegt dem Kaiser treu, ohne sich deswegen gegen den Papst zu erklären. Es wird erzählt, dass er auf der Synode von Brixen, wo die königlichen Bischöfe den Papst absetzten, sich unter dem königstreuen Altar versteckte, um sich nicht gegen einen Akt auszusprechen, an dem er sich nicht beteiligen wollte. Dass weder Kaiser noch Papst ihm seine Haltung übelnahmen, beweist, wie hoch sie ihn schätzten, und dass sie ihn für ehrlich hielten. Lange Zeit war er von den Sachsen aus seinem Bistum vertrieben und musste sich oft durch Verkleidung vor Nachstellungen schützen. Benno selbst hatte zuweilen das Gefühl, zu weltlich zu sein, um einen rechten Bischof abzugeben; jedenfalls hinderte ihn seine geistige Überlegenheit, das kirchliche Zeremoniell allzu ernst zu nehmen. Nicht selten befreite er Laien gegen Geld vom Fastengebot; er gab das Geld den Armen und sagte, es sei Gott lieber, als wenn einer den ganzen Tag einen leeren Bauch spazierentrage, umso mehr, als der Frömmigkeit dadurch kein Abbruch geschehe. Als er auf dem Sterbebett lag, bat eine vornehme Witwe, namens Azela, ihn besuchen zu dürfen. Er lehnte ab mit der Begründung, er wolle sie lieber im anderen Leben wiedersehen, wo sie sich gegenseitig ihres Anblicks erfreuen könnten, nachdem sie sich auf Erden rein und keusch geliebt hätten. Dort werde keine Todesangst ihre Liebe trüben.
Weniger durch Begabung als durch Charakter zeichnete sich Bischof Meinwerk von Paderborn aus. Ihm lag das Los der Armen besonders am Herzen; es genügte ihm nicht, in der üblichen Art Almosen zu spenden, er überwachte die Meier und Vögte, von denen die Hörigen abhingen, untersuchte die Verhältnisse selbst, und damit er nicht betrogen würde, zog er als Kaufmann verkleidet im Sprengel herum. Er gebot den Meiern, die Hörigen zur Erntezeit mit Speise und Trank zu versorgen, was vorher augenscheinlich nicht üblich war, und als er einmal zufällig eine Wirtschafterin schimpfen hörte, dass man die Arbeiter mit Mehlsuppe abspeise, verordnete er, sie sollten noch einige Schinken außer denen erhalten, die die Meier ohnehin ihnen zu stellen verpflichtet waren. Wenn er auf Unregelmäßigkeiten stieß, wurde er leicht zornig, machte aber die Schläge, die er dann etwa austeilte, hernach in großmütiger Weise gut. Zurzeit einer Hungersnot kaufte er in Köln Getreide auf und ließ es durch seine Meier so verteilen, dass ein Teil dem eigenen Bedarf, ein Teil den Leuten, ein Teil als Samengetreide und ein Teil den Bettlern diente. Wo die Bevölkerung einer Pfarrei sehr weite Wege zur Kirche hatte, teilte er sie entweder oder baute eine neue Kapelle innerhalb der Pfarrei.
Er war ein naher Verwandter Heinrichs II. und stand mit ihm auf dem Fuße humoristischer Neckerei. Als der Kaiser beschlossen hatte, ihn zum Bischof zu machen, ließ er ihn kommen und überreichte ihm lächelnd einen Handschuh. Was das zu bedeuten habe? fragte Meinwerk. »Das Bistum Paderborn«, antwortete der Kaiser. Mit Bezug darauf, dass dies Bistum als sehr arm bekannt war, entgegnete Meinwerk: »Was soll mir dies Bistum, da ich mit meinen eigenen Gütern ein viel stattlicheres zu gründen vermöchte.« Eben darum, sagte der Kaiser, weil Meinwerk reich sei, solle er sich der Armut des Paderborner Sprengels erbarmen. Es scheint, dass diese Worte die tatkräftige Menschlichkeit Meinwerks entzündeten oder doch sie in beglückender Weise auf eine große Aufgabe lenkten. Er warf sich so stürmisch darauf, dass er drei Tage nach seiner Ankunft in Paderborn die bescheidene und ungenügende Hauptkirche niederreißen ließ und mit großem Aufwand einen neuen Dom zu errichten begann. Nicht genug, dass er unaufhörlich aus seinem eigenen Besitz spendete, er veranlasste auch den Kaiser zu Schenkungen, wobei es den Spaß vermehrte, dass dieser sich seine Gaben ablisten oder abtrotzen ließ. Einmal schickte er dem Bischof einen Trunk edlen Weins in einem goldnen Becher. Unter einem Vorwand behielt Meinwerk den Becher über Nacht, ließ ihn durch einen Goldschmied in einen Kelch verwandeln und am anderen Tage während der Weihnachtsmesse in Gegenwart des Kaisers gebrauchen. Der Kaiser schalt ihn zwar einen Dieb, fügte sich aber. Da es bekannt war, dass Meinwerk kein Gelehrter und nicht sicher im Lateinischen war, ließ Heinrich einmal in Meinwerks Messbuch bei der Gebetsformel für die Verstorbenen in den Worten famulis et famulabus die Silbe fa ausradieren, sodass der Bischof, als der Kaiser ihn bat, die Seelenmesse für seine Eltern zu lesen, für Maulesel und Mauleselinnen betete. Der Berichterstatter fügt hinzu, dass der Bischof zwar zu lesen angefangen, dann aber doch den Ulk bemerkt habe. Einmal trieb der Kaiser das Hänseln so weit, dass er auf Pergamentstreifen die Worte schreiben ließ: »Bischof Meinwerk, bestelle dein Haus, in fünf Tagen musst du sterben«, und sie in der Umgebung des Bischofs verstreuen ließ. Für das Verhältnis der Menschen jener Zeit zum Tode ist es bezeichnend, mit welcher Ruhe und Umständlichkeit der Bischof sich auf seine Abberufung vorbereitete, über sein Hab und Gut verfügte, betete, fastete und schließlich der Vorschrift gemäß auf dem Boden der Krypta ausgestreckt das Ende erwartete. Da der Tod ausblieb, erriet er den Veranstalter des brutalen Scherzes oder sollte er absichtlich auf ihn eingegangen sein? – und belegte den Schuldigen und seine Gehilfen mit dem Bann, aus dem sie erst gelöst wurden, als der Kaiser öffentlich Buße getan und zu Füßen des Bischofs Verzeihung erfleht hatte.
Ein anderer Verwandter Kaiser Heinrichs II., mit dem er gleichfalls gern Neckereien trieb, und der noch mehr Anlass dazu bot als Meinwerk, war Bischof Megingaud von Eichstätt. Er war ein fröhlicher Zecher und liebte es nicht, sich die Essenszeit durch das vorgeschriebene Psalmensingen und Beten verkürzen zu lassen. Wenn er ein Kloster besuchte und man ihn, wie üblich, mit Gesängen begrüßen wollte, stellte er sie durch einen Wink ab, um desto eher zu Tisch gehen zu können. Wenn er das Hochamt hielt, kam es vor, dass er sich ärgerlich die Sequenz verbat und gleich zum Evangelium überging: »Die Narren lassen mich mit ihrem Gesang vor Hunger und Durst sterben«, sagte er. Er wurde leicht heftig und fluchte gern; mit den hundert Flüchen, für die er einmal die Erlaubnis erhielt, war er im Umsehen fertig. Wenn die übrigen Bischöfe sich vor dem Kaiser erhoben, blieb er sitzen, weil er der ältere sei, und die Bibel gebiete, den Älteren zu ehren. Trotz seiner Heftigkeit und Formlosigkeit wurde er geliebt. Sein Biograf fügte dem Bericht, dass Megingaud die Priester zuweilen, um schnell damit fertig zu werden, im Walde geweiht habe, die Bemerkung hinzu, dass Gott diese formlose Priesterweihe im Walde vielleicht lieber gewesen sei als die von manchem Bischof in der Kirche vollzogene; denn Megingaud sei ohne Falsch gewesen.
Eine große politische Rolle spielte Willegis, wozu ihn schon seine Stellung zuerst als Kanzler Ottos I., dann als Erzbischof von Mainz und Erzkanzler berief. Er hat zurzeit der beiden letzten Ottonen die Einheit des Reiches gewahrt und dem tüchtigen Herzog von Bayern, Heinrich II., die Krone zugewendet. Willegis war ein Sachse, wie man annimmt in Schöningen geboren; dass er niederen Herkommens, etwa gar ein Höriger gewesen sei, wird neuerdings bezweifelt, aber gewiss ist, dass er in den Kreisen des hohen Adels nicht beliebt war. Für die Armen sorgte er durch Almosenspenden und Speisungen, wobei er sich persönlich beteiligte; er selbst aß erst, nachdem er die Armen bedient hatte. Ebenso war er streng in der Beobachtung der Gebetsstunden, aber auf grundsätzliche mönchische Askese legte er keinen Wert; auf Gottesfurcht komme es an, pflegte er zu sagen, ein Kanoniker, ja ein Laie könne Gott ebenso angenehm sein wie ein Mönch. Von der kluniazensischen Reform wollte er nichts wissen. Mit viel Verständnis ordnete er das Schulwesen und sorgte dafür, dass die armen Schüler nicht zurückgesetzt wurden. Seine Bautätigkeit war außerordentlich. Ein seltsames Geschick wollte, dass sein Dom am selben Tage, wo er ihn geweiht hatte, durch Feuer zerstört wurde; nur ein Teil der Fundamente ist in der Prachtgestalt des heutigen Domes erhalten. Am Marktportal desselben befinden sich die Erztüren mit den Löwenköpfen, die Willegis in Nachahmung der Türen des Aachener Doms für die während der Französischen Revolution zerstörte Liebfrauenkirche gießen ließ.
Willegis dankte seinen Aufstieg einem Geistlichen namens Volkold, der ihn unterrichtete, erzog und dem Könige empfahl. Die Vertreibung Volkolds, der später Bischof von Meißen wurde, durch die aufrührerischen Tschechen gab Willegis Gelegenheit, seine Dankbarkeit zu erweisen: er nahm den Pflegevater herzlich auf und bereitete ihm in Erfurt eine Heimat. Seinerseits brachte Willegis durch seine Empfehlung einen tüchtigen Mann auf den Bischofsstuhl zu Worms, Burchard, der als erster ein geschriebenes Recht für seine Familie, nämlich die auf dem Stiftsgebiet ansässigen, der Kirche und ihrer Gerichtsbarkeit untergebenen Leute, verfasste. »Wegen der unablässigen Klagen der Armen«, so beginnt das berühmte Hofrecht, »und der zahlreichen Gewalttaten vieler Personen, die wie Hunde die Familie des heiligen Petrus zerfleischten, indem sie den dieser Familie Zugehörigen alle möglichen Gesetze aufbürdeten und die Schwachen durch ihre Urteile unterdrückten, habe ich, Bischof Burchard, unter dem Beirat meines Klerus, meiner Vasallen und der ganzen Familie diese Gesetze aufzeichnen lassen, damit kein Stiftsvogt, Viztum, Ministerial oder sonst eine rechtweisende Person der genannten Familie etwas Neues auferlegen könne, sondern dass reich wie arm ein und dasselbe Gesetz vor Augen gestellt werde und allen gemeinsam sei.« Der mächtige Bischof erließ kein Gesetz ohne die Mitwirkung und Zustimmung nicht nur des Klerus und seiner Vasallen, sondern auch seiner Untergebenen.
Burchard zeigte sich als geschickter Politiker, indem er die salischen Herzöge zum Verlassen der Stadt Worms zu bewegen wusste und dadurch ihr alleiniger Herr wurde. Als solcher hat er sie in fünfundzwanzigjähriger Regierung innerlich und äußerlich gepflegt und gehoben. Willegis nacheifernd baute er den Dom auf einer alten Kultstätte, wo eine frühchristliche Basilika gestanden hatte, die vom Blitz vernichtet und noch nicht wieder aufgebaut war. Das herrliche Gebäude ist wohl mehrfach verändert, aber in der Grundanlage erhalten geblieben; die Festigkeit seiner Mauern hat im Jahre 1689 der systematischen Zerstörungswut der Franzosen getrotzt. Bis zur Vollendung des Doms von Speyer war der Dom von Worms die Begräbnisstätte der Salier; hier ruht Herzog Konrad der Rote, der Schwiegersohn Otto I., der in der großen Ungarschlacht fiel. Jetzt ist der Dom fast das einzige Denkmal aus Worms’ großen Tagen.
Ein großer Bauherr war Burchards Zeitgenosse, Erzbischof Poppo von Trier. Von einer Reise nach Jerusalem brachte er den Einsiedler Simeon mit, der sich in der Porta Nigra einnistete und dort sein Eremitendasein weiterführte. Als er gestorben und heiliggesprochen war, wandelte Poppo das Heidentor in eine christliche Doppelkirche um, sodass das zweite Stockwerk desselben die untere, das dritte die Oberkirche wurde; die Wehrgänge des Tors bildeten die Seitenschiffe. Als ein Wahrzeichen des triumphierenden Christentums überwuchs Sankt Simeon fantastisch die Riesenspur der römischen Kaisermacht. Den Anlass zu Poppos Pilgerfahrt nach Jerusalem soll gegeben haben, dass er das alte, in der Merowingerzeit gegründete Kloster Pfalzel aufgehoben hatte, dessen Insassen den Ansprüchen der Reformzeit nicht genügten; eine Nonne ging so weit, sich in den Erzbischof zu verlieben und ihm einen Liebeszauber in die Schuhe zu nähen. Den aus der letzten römischen Zeit stammenden Dom ließ Poppo zu einem dreischiffigen Hallenbau mit zwei Türmen umbauen. Als er im Jahre 1047 auf dem Bauplatz den Arbeitern zusah, ereilte den Mächtigen der Tod durch einen Sonnenstich. Er war ein Sohn des Markgrafen Leopold I. von Österreich.
Sein Namensvetter, Patriarch Poppo von Aquileja, der ungefähr gleichzeitig regierte, ist der Erbauer des Domes von Aquileja und des Palastes, von dem nichts mehr als zwei Säulen übriggeblieben sind. Von der Höhe des Campanile, den krächzende Dohlen umschwärmen, sieht man im Norden die Häupter der Alpen, Triglav und Krn und Monte Matajur, im Süden die Lagunen und das Meer, im Westen die grüne flimmernde Ebene des Friaul, damals ein dem Patriarchat unterworfenes Gebiet. Der Patriarch Poppo war ein Günstling der Kaiser Heinrich II. und Konrad II., deren Schenkungen ihn zu einem der reichsten Fürsten seiner Zeit machten. Wie alle damaligen Bischöfe, umgab er sich mit Ministerialen und Vasallen und richtete Hofämter nach dem Muster der Kaiserlichen ein. Ebenso bedeutend als Kriegsmann wie als Staatsmann besiegte er die Ungarn, die in Krain einfielen.
Bischof Pilgrim von Passau fasste den kühnen Plan, das benachbarte Ungarn in seine Diözese einzubeziehen, sein Bistum zum Mittelpunkt der ungarischen Kirche, sich selbst zum Erzbischof von Ungarn zu machen. Zu diesem Zweck wollte er durch gefälschte Urkunden glaubhaft machen, dass das alte Lauriakum an der Mündung der Enns in die Donau in früherer Zeit ein Erzbistum gewesen sei, mit dem Passau zusammengehangen habe, und ersuchte den Papst, das untergegangene wiederherzustellen. Dadurch wäre Passau von Salzburg unabhängig geworden, eine Veränderung, der der Erzbischof von Salzburg sich natürlich widersetzt hätte. Weder Papst noch Kaiser hatten für den großartigen, folgenreichen Plan Verständnis. Otto III. unterstützte vielmehr das Bestreben der Herzöge Geisa und Stephan von Ungarn, ihr Land zu einem selbstständigen Staat zu machen, und stand ihnen bei, das Erzbistum Gnesen für Ungarn zu gründen, womit die Möglichkeit schwand, das Land, das bisher politisch und kulturell vom deutschen Reiche abhängig gewesen war, kirchlich an Deutschland zu binden. Das seltsame Auftauchen von Pilgrims Namen im Nibelungenliede hat zu der Annahme geführt, das größte Epos der Deutschen sei an seinem Hofe, vielleicht unter seinem Einfluss entstanden. Da wo die Donau sich der Ostmark zuwendet, mögen sich wohl die Lieder von der burgundischen Königstochter, die vom Rheine her, ungesättigte Rache im Herzen, den schilfumraschelten Strom hinunter zu tragischer Hochzeit fuhr, im Gedächtnis des Volkes erhalten haben.
Ein Freund der alten Volksgesänge war der schöne Bischof Günther von Bamberg, der auf einer Pilgerfahrt ins Heilige Land mehrmals für den König gehalten wurde, was wohl mit seiner Schönheit und stolzen Haltung zusammenhing. Bei den vielen Abenteuern, die die Pilger, unter denen noch andere Kirchenfürsten und mehrere Grafen und Herren waren, zu bestehen hatten, ging Günther allen an unerschütterlichem Mut voran. Kurz vor Jerusalem wurden sie von Arabern überfallen; ein Teil wurde ermordet, ein anderer warf sich unter Günthers Führung in einen festen Turm und verteidigte sich dort. Nachdem ein Waffenstillstand geschlossen war, wurden mehrere Araberfürsten eingelassen, um über den Preis der Befreiung zu verhandeln. Einer von diesen bedrohte Bischof Günther, den er für den höchsten von allen hielt, in rohen Worten mit dem Tode. Kaum hatte Günther durch den Dolmetscher erfahren, was der Mann gesagt hatte, als er, nicht im Geringsten beunruhigt, den Feind mit einem Faustschlag zu Boden streckte und ihm mit dem Fuße die Kehle zudrückte. Einige Wochen später konnten die Andächtigen am Heiligen Grabe ihre Gebete verrichten. Als die Pilger auf der Rückreise die Donau erreicht hatten, kniete Günther nieder und küsste die Erde; gleich darauf erkrankte er und starb, noch jung, ohne sein geliebtes Bamberg wiedergesehen zu haben. Von ihm sagt der zeitgenössische Chronist, er habe sich nicht mit Augustin oder Gregor, sondern mit Etzel, Amalung und ähnlichen Ungeheuern beschäftigt, und habe die Schneidigkeit des Schwertes für ein besseres Beweismittel gehalten als die Spitzfindigkeit gelehrter Untersuchungen.
Im Wesen vieler dieser Kirchenmänner waren Hochmut mit Demut, Ausgelassenheit, Wildheit, Abenteuerlust und Prachtliebe mit Gottergebenheit und Askese wunderlich gemischt. Die eben noch mit Begeisterung Hiebe ausgeteilt oder an reichbesetzter Tafel geschwelgt hatten, überschwemmten bald darauf den Boden der Kirche mit Tränen.
Groß war aber auch die Zahl derer, die ihr Leben in staatsmännischer Arbeit verzehrten und daneben das Beispiel der Sittenreinheit und priesterlichen Frömmigkeit gaben.