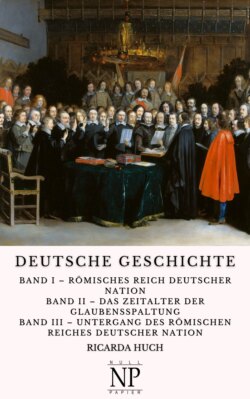Читать книгу Deutsche Geschichte - Ricarda Huch - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Frauen
ОглавлениеDie Leiden und Entbehrungen, zu denen die Frau durch die Natur bestimmt ist, wird keine menschliche Einrichtung je ganz aufheben können; denn wer befreite sie von der Liebe zu den Kindern, die von diesen nie im selben Grade erwidert wird, von ihrer Anhänglichkeit an den Mann, der im Wechsel glücklich ist, von ihrem Schwelgen in Unterordnung, das ihre Beherrscher erst recht zu Tyrannen macht, von ihrem Pflichtgefühl, das sie an Haus und Familie bindet, von der Zartheit ihres Gewissens, das ihr manches verbietet, was der Mann sich erlaubt, und ihr manches auferlegt, was der Mann vernachlässigt. Sieht man ab von den Beschränkungen, mit denen die Natur die Frau eingeengt hat, so findet man, dass sowohl die germanische Auffassung wie die der Kirche der Frau günstig war. Das Wort Frau heißt Herrin, und Herrinnen waren die adligen und freien nordischen Frauen, von denen Geschichte und Sage melden. Durch das Gesetz allerdings war die Frau vom Manne abhängig und von der Betätigung im staatlichen Leben ganz ausgeschlossen, wenn sie auch im Volksrecht einiger Stämme doppeltes Wergeld genoss und auch sonst gewisse Züge auf eine zartfühlende Berücksichtigung der körperlich schwächeren und geistig so wirksamen, der opferbereiten, mit so schwerer Verantwortung beladenen Gefährtin deuten. Allein man kann auf die Geltung, die eine Klasse von Menschen hat, nicht nur aus dem Gesetz schließen. Die enge Beziehung zwischen Mutter und Sohn, Vater und Tochter, Bruder und Schwester, Mann und Frau schuf im täglichen Leben Gewohnheiten, die der Frau mehr zuwendeten, als das plumpe Gesetz ihr nahm. Soweit die Persönlichkeit wirken konnte, hatte die Frau viel Einfluss. Lässt er sich selten ausdrücklich berechnen, so spiegelt er sich darin, dass die Überlieferung oft, wenn ein Mann etwas im Guten oder Bösen Auffallendes, etwas Sieghaftes oder Unheilvolles tat, die Mutter oder Frau dafür verantwortlich machte.
Unbändiger Stolz beseelte die deutsche und namentlich die nordische Frau, ebenso wie die nordgermanischen Männer. Sie zürnen dem Vater, wenn er sie, ohne sie um ihre Einwilligung zu fragen, vermählt, zürnen ihm doppelt, wenn er sie einem Unebenbürtigen gibt. Es kommt vor, dass der Mann die Frau im Zorne schlägt, aber ebensooft, dass sie den Schlag mit seinem Tode rächt. Als der norwegische König Olaf Tryggvasohn um die schwedische Königin Sigrid warb und verlangte, dass sie Christin würde und sie das nicht wollte, schlug er ihr den Handschuh ins Gesicht. »Das soll dir noch einmal den Tod bringen«, sagte sie und hielt Wort. Sie heiratete den Dänenkönig Sven Gabelbart und bewog ihn, Olaf zu bekriegen, bis er als Unterliegender sich selbst den Tod gab. Es scheint, dass die Männer die Frauen umso mehr liebten, je stolzer, kühner und selbstständiger sie waren. Sie bewunderten ihre Klugheit, hörten auf ihren Rat, ordneten sich ihnen unter, hatten besonders eine abergläubische Ehrfurcht vor ihnen, wenn sie ihre Sehergabe, Zauberkunst und Heilkunst ausübten. Zurzeit, als die Sitten schon bedeutend gemildert waren, erscheinen in der Dichtung Kriemhild und Gudrun in einer Pracht der Persönlichkeit, wie sie nur bei ungekränktem Selbstgefühl sich entfalten kann. Gudruns entrüstete Ablehnung eines Gemahls, der Vasall ist, veranlasst verheerenden Krieg, und wilden Stolz verleugnet das Königskind nie, nicht in Todesgefahr, nicht unter Qualen und Demütigungen, nicht gegenüber der Schmeichelei. Als Bräutigam und Bruder sie wiedergefunden haben und Befreiung in Aussicht steht, ist ihr erstes Tun, dass sie mit jubelndem Hohn die Wäsche, die sie waschen musste, ins Meer wirft. In königlicher Großmut sucht sie die Feindin, als sich der Sieg den Ihren zugewendet hat, zu schützen, findet es aber doch richtig, dass die Frau, die sie, die Hochgeborene, gezwungen hat, Magddienste zu tun, mit dem Tode büßen muss. Nicht selten erscheint der Verschwendung, den hochmütigen Ansprüchen der Frau gegenüber der Mann als der Bescheidenere, Maßvollere.
Wie viel Anteil die Frauen an den Staatsgeschäften nahmen, zeigt die Geschichte. Bertrada, die Mutter Karls des Großen, veranlasste seine Heirat mit einer langobardischen Prinzessin; obwohl andere Wege eingeschlagen wurden, blieb sie bis zu ihrem Tode hochgeehrt von ihrem Sohn und ihrer ganzen Familie. Eine ähnliche Stellung hatte in Sachsen die fränkische Oda, die Frau Ludolfs und Mutter der Herzöge Brun und Otto, und ganz besonders die Königin Mathilde. Sie wurde einer Heiligen gleich geachtet, ihr Name erbte sich in der Familie fort, solange sie bestand. Nicht nur ihre eigenen erwachsenen Söhne betrachteten sie als Oberhaupt, sondern auch Ottos natürlicher Sohn Wilhelm, der Erzbischof von Mainz. Nach dem Tode ihres Mannes beschäftigte sie sich mit der Sorge für Arme, Kranke und Pilger, was als vornehmste Aufgabe der Frau angesehen wurde, aber auch mit Handarbeit und Wissenschaft; ihr Biograf betont, dass sie bei aller Demut immer die königliche Würde behauptete. Seiner Schwester Mathilde, der Äbtissin von Quedlinburg, vertraute Otto der Große während seiner Abwesenheit das Reich an; seine Tochter Mathilde, ebenfalls Äbtissin von Quedlinburg, hatte großen Einfluss während der Kindheit Ottos III. Ottos Bruder Heinrich hatte zwei energische und kluge Töchter, Gerberga, die Äbtissin von Gandersheim wurde, und Judith, die Gattin des viel älteren Herzogs Burkhard von Schwaben, welche letztere ganz besonders sowohl des Vaters Schönheit sowie seine Herrschsucht und sein heftiges Temperament geerbt zu haben scheint. Ihr Freund Ekkehard II., den sie zu sich auf den Hohentwiel befahl, um mit ihr den Virgil zu lesen, und den sie mit Gnaden und Geschenken überhäufte, genoss die Gunst der herben Dame halb widerwillig; so wenigstens wird berichtet. Unter der Führung der Äbtissin Gerberga und der Lehrerin Richardis bildete sich im Kloster Gandersheim, am Rande des Harzes, die Dichterin Hroswitha, deren Werk, wenn es auch, wie der Körper von einer Kutte, durch die fremde Sprache vermummt ist, Verstand und Geschmack und eine feste Linienführung offenbart. Dass Nonnen Latein lernten, war nicht selten. Nicht nur die Mädchen, sondern auch die Knaben erhielten ihren ersten Unterricht in den Frauenklöstern. Unter den Frauen der Salier ragt Gisela, die Witwe des Herzogs von Schwaben und Mutter des unglücklichen Ernst, als bedeutende Persönlichkeit hervor. Sehr großen Einfluss scheint die Braunsenweigerin Richenza auf ihren Mann, den König Lothar, gehabt zu haben, sodass, wer etwas bei ihm erreichen wollte, zuerst sie zu gewinnen suchte. Als sie mit Lothar in Italien war, besuchte sie nicht nur die heiligen Stätten, um zu beten, wie das üblich war, sondern auch die durch Geschichte und Kunst denkwürdigen Orte. Nach dem Tode ihres Mannes war sie noch jahrelang die Führerin der Welfen im Kampfe gegen die Staufer; als sie starb, erlahmte die Bewegung. Auch die Frau Barbarossas, die Kaiserin Beatrix, begleitete ihren Mann auf allen seinen Feldzügen; sie galt als klug und gebildet, und man wusste, dass der Kaiser sehr abhängig von ihrem Urteil war. Mochten Geistliche gelegentlich die Schwachheit der Frau im Munde führen, so dachte man doch nicht daran, der Frau ihr Geschlecht als Minderwertigkeit anzurechnen oder sie auf ein enges Feld der Betätigung einzuschränken, wenn die kriegerische auch für sie natürlich nicht in Frage kam. Wir hören, dass im 9. Jahrhundert Bischof Ansgar zuweilen zu einer sächsischen Adligen namens Liutbirg pilgerte, die im Bodetal ein Eremitendasein führte; sie unterrichtete Mädchen im Beten, Singen und Handarbeiten. Dazu kam später wohl noch die Kenntnis von Sprachen und das Spielen verschiedener Musikinstrumente. Jedenfalls waren die Frauen eher gebildeter als die ritterlichen Männer; noch Ende des 15. Jahrhunderts konnten ein Burggraf von Nürnberg und ein Graf von Sayn nicht schreiben, vielleicht konnte es auch Rudolf von Habsburg nicht: es ist anzunehmen, dass die Frauen, die sich so warm für Dichter und Dichtkunst interessierten, das Lesen verstanden. Dass Nonnen oft schrift- und sprachenkundig waren, ist selbstverständlich. Den Bürgerfrauen stand in Bezug auf Arbeitsbetätigung ihr Geschlecht nur insofern im Wege, als ihnen zu manchen Berufen die körperliche Kraft fehlte. Der Eintritt in eine Zunft war ihnen nicht verwehrt, abgesehen davon, dass oft Witwen das Geschäft des Mannes fortsetzten. Besonders gehörten ihnen gewisse Berufe, die eine zarte, biegsame Hand erforderten, wie der der Schleierwäscher oder Goldspinner oder Sticker, aber auch andere, in denen sie seit der Zeit geschickt sein mochten, als der häusliche Haushalt für die eigenen Bedürfnisse aufkam. Wie in der Frühzeit übten sie auch später die ärztliche Kunst aus; es gab hier und da Stadtärztinnen.
Dem Vater stand es zu, Söhne und Töchter ins Kloster zu schicken oder zu verheiraten; aus vielen Beispielen geht hervor, dass er dabei in der Regel die Wünsche der Mutter berücksichtigte. In vielen adligen Familien war es Sitte, nur je eines der Kinder zu verheiraten, die übrigen geistlich werden zu lassen. Bei der Heirat wurde hauptsächlich der Vorteil in Betracht gezogen; aber es wird liebevolle Eltern gegeben haben, die bestimmte Neigung oder Abneigung der Kinder nicht unbeachtet ließen. Von der eigenwilligen Judith erzählte man, sie habe, weil sie keine Lust hatte, den ihr bestimmten griechischen Prinzen zu heiraten, dem griechischen Maler gegenüber, der sie porträtieren sollte, ihr schönes Gesicht zur Grimasse verzogen, um den Freier abzuschrecken, was ihr auch gelungen sei. Den Aufenthalt im Kloster zogen gewiss viele Mädchen der Ehe vor; sie genossen dort Bequemlichkeit, Sicherheit und Ehre, und auch eine weitgehende Freiheit nahmen die adligen Frauen als selbstverständlich für sich in Anspruch. Fanden die Frauen kein Glück in der Ehe, so wussten sie sich zu entschädigen, wenigstens möchte man das aus den häufigen Verdächtigungen hochgestellter Frauen schließen, wenn sie auch nicht immer begründet waren. Ottos des Großen Tochter Liutgard wurde des Ehebruches beschuldigt, die später heiliggesprochene Kunigunde, die Frau Heinrichs II., soll sich durch das Gottesgericht von der Anklage gereinigt haben, indem sie mit bloßen Füßen über ein glühendes Eisen schritt. Man dachte im Allgemeinen nicht streng über leidenschaftliche Beziehungen zwischen Mann und Frau. Bischof Salomon von Konstanz hatte ein Liebesverhältnis mit der Äbtissin des Klosters Fraumünster von Zürich; in die schöne Tochter, die der Verbindung entsprang, verliebte sich der Kaiser Arnulf. Es ist nicht zu verwundern, wenn Frauen oft beschuldigt wurden, mit Geistlichen zärtliche Verbindungen zu unterhalten, wenn sie gern mit Geistlichen verkehrten. Das Interesse für die gleichen Gegenstände, für Armen- und Krankenpflege, für Poesie und Kunst führte sie zusammen, Frauen und Geistliche waren gebildeter als die weltlichen Männer, sie betrachteten die Dinge in einem Lichte, das sie interessanter, bedeutender, vielgestaltiger erscheinen ließ. Begreiflich ist es auch, dass die Mütter wenigstens einige ihrer Söhne der Kirche zu übergeben liebten, wo sie einigermaßen vor dem Tod im Kriege gesichert waren, wo ihre Begabung gepflegt wurde und sich entfalten konnte. So dachte zum Beispiel die Gräfin von Goseck, eine geborene Gräfin von Weimar, von deren Söhnen einer, Adalbert, der berühmte Erzbischof von Bremen wurde. Die ritterliche Erziehung der Knaben war so hart, sie verlief zwischen Pferden und Waffen, im Stalle, im Sattel, unter Knüffen und Püffen, dass es dem Herzen mancher Mutter wehtun mochte, besonders wenn das Kind zart war und darunter litt.
Das Christentum hat mit seiner Anpreisung der Demut wohl nicht nur im guten, sondern auch im üblen Sinne zähmend gewirkt, indem es mit der Wildheit der heidnischen Frau ihre frische Kraft dämpfte; aber es setzte ihre weibliche Würde nicht herab, verklärte sie vielmehr in ihren wesentlichen Eigenschaften. Das überirdische Geheimnis der Empfängnis und Mutterschaft hatte sein Symbol in der jungfräulichen Mutter des Herrn, in der das Wort Gottes Fleisch wurde. In den kleinen dunklen Kirchen der ottonischen Zeit sah man sie unnahbar groß, den wunderbaren Sohn auf dem Arme, eine Göttin mit unergründlichem Leidensblick, man sah sie unschuldig ernst, halb abgewendet der Botschaft des Engels lauschen, der die Fülle himmlischer Herrlichkeit vor sie hinstürzt, man sah sie, das Herz von Schwertern durchbohrt, sah die Überwinderin aufwärts schweben, das verjüngte Haupt mit der Krone des Lebens gekrönt. Sie, die Gottesgebärerin, die Himmelskönigin, war in allen irdischen Leiden geprüft. Und erlebte nicht jede Frau das Wunder, dass ihrem Schoße ein Kind entsprang, dem Gott die Seele einhauchte? Das unlösbare Geheimnis der Geburt band die Frau an den Gott, dessen Atem dem Geschöpf die letzte Vollendung zur Menschenwürde gibt; ihm brachte man es dar nicht erst bei der Taufe; schon vorher, als es noch ungestaltet in ihrem Schoße lag, musste es durch sie von seinem Wort beseelt werden. Im Märchen wird die Frau, die beschuldigt wurde, anstatt eines menschlichen Kindes einen Hund oder einen Wolf zur Welt gebracht zu haben, zum Feuertode verurteilt; wie eine Ketzerin oder Zauberin, eine Gottlose, erscheint die, deren Kind kein Menschenantlitz trägt, also kein Gotteskind ist.
Neben der Maria stehen viele große Heilige: Margarete, die Drachentöterin, Agnes, die im Hause der Unzucht ihre Reinheit bewahrt, Katharina, Dorothea und viele andere, die von dem todüberwindenden Heldenmut der Frau und ihrer Überzeugungstreue zeugen. In der Hochschätzung der Jungfräulichkeit traf die christliche Auffassung mit der germanischen zusammen. Die Walküren verloren ihre Kraft mit der Jungfräulichkeit, das Blut oder der Kuss einer reinen Jungfrau hat im Märchen erlösende Kraft. Darin wird nicht nur die Tatsache gewürdigt, dass die Frau durch die sinnliche Liebe oft bis zur Betäubung des Gewissens und zum Verlust der eigenen Persönlichkeit vom Manne abhängig wird, sondern wohl auch die andere, dass die zurückgedrängte Kraft geschlechtlicher Liebe sich in schöpferische Geisteskraft umsetzen kann. Die Heilige trat für den Germanen an die Stelle der wegen ihres prophetischen Geistes oder wegen ihrer Zauberkunst verehrten Frauen. Sieht man, mit was für geduldiger Aufmerksamkeit ein so imperatorischer König wie Friedrich I. Barbarossa die Strafpredigten der Hildegard von Bingen aufnahm, kommt es einem vor, als habe die Ehrfurcht in ihm nachgewirkt, die seinen heidnischen Vorfahren die Seherin als die von den Göttern Erwählte einflößte.
Dass die Frau die frohe Botschaft verständnisvoll aufnahm, hat die rasche Verbreitung des Christentums erleichtert, wenn nicht ermöglicht. In vielen Fällen wurden die Könige und Volkshäupter, die das Beispiel gaben, durch die Frau bekehrt. Es ist immer die Frau, die den Sinn für das Übersinnliche hat, und Frauen waren es, die das eigentliche Wesen des Christentums erkannten oder erfühlten. Ihnen empfahl sich der Christengott nicht, weil er der mächtigste, sondern weil er der liebende war, der gerechte und gnädige, der der Sünde wehrt und dem reuigen Sünder verzeiht. Die Frau als die körperlich Schwächere, als Mutter zu Schmerz und Opfer und zur Hüterin von Haus und Familie bestimmt, verstand die Religion, welche die Gewalt durch die Kraft des liebevollen Geistes und durch den Glauben an den Sieg des Guten überwindet. Die Heiligung der Ehe durch die Kirche entsprach dem Interesse der Frau, die den Kindern den Vater erhalten will, die aus Liebe zu den Kindern auf den Wechsel verzichtet, und der, da ihre zarte Körperlichkeit den Reiz früh einbüßt, der den Mann anzieht, die Verklärung des ehelichen Verhältnisses durch das Sakrament willkommen sein musste. Von der ungeregelten Leidenschaft der nordischen Heiden hatten wohl Frauen Genuss und Vorteil; aber überwiegend litten doch Frauen darunter. Denn es ist unumgänglich, dass der natürliche Mann sich seiner überlegenen Kraft bedient, um die Frau zu beherrschen und um sich ihrer zu entledigen, wenn sie ihm im Wege ist, nicht selten mit derselben Leidenschaft, die er einsetzte, um sie zu gewinnen, solange er sie begehrte. Drückten nun auch Päpste und Bischöfe zuweilen ein Auge zu, wenn es sich um mächtige Herren handelte, so haben sie doch im Allgemeinen auch solchen gegenüber die gekränkte Frau beschützt. Die Familie konnte zu einem befriedeten Bezirk werden, innerhalb dessen, wenn ringsum ungezähmte Leidenschaft, Habsucht und Machtgier der Großen sich austobten, vorzüglich unter der mütterlich regierenden Hand der Frau sich diejenigen Tugenden erhielten, die der Gesundheit und dem Glücke des Volkes zugrunde liegen.
Dass die Regelung des Verhältnisses zwischen Mann und Frau durch die Kirche nichts mit Zimperlichkeit und Sinnenfeindlichkeit zu tun hatte, beweist die Unbefangenheit, mit der die Dirnen in den öffentlichen Frauenhäusern betrachtet und behandelt wurden. Sie erschienen bei festlichen Anlässen als eine ständische Gruppe neben anderen, oft mit Blumen geschmückt, und wenn an der Rücksicht, die man auf sie nahm, auch der finanzielle Gewinn einen Anteil hatte, den Stadträte oder Fürsten aus ihnen zogen, so zeigte sich doch auch die Neigung des ganzen Volkes darin, diese Mitbürgerinnen sich eher mit Wohlwollen einzugliedern, als sie zu verachten oder sich an ihnen zu ärgern. Auch in dieser Beziehung brachte das Christentum wohl Veredlung, aber nicht Vergewaltigung der Natur; die »Tochter Gottes« sollte nicht nur für ihre schönen Triebe, sondern auch für Ausgelassenheit und Unart Spielraum haben.