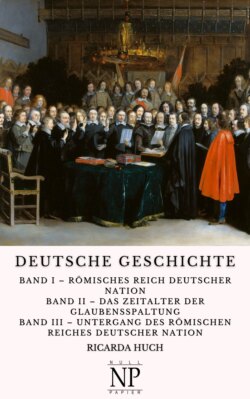Читать книгу Deutsche Geschichte - Ricarda Huch - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Norden
ОглавлениеOtto I. schickte den Bischof Liutprant von Cremona, einen begabten, temperamentvollen Langobarden, an den Hof von Byzanz, um für seinen Sohn um die Hand einer griechischen Prinzessin zu bitten. Als der Kaiser Nikephoros sich bei Tisch über die Völlerei der Burgunder lustig machte, sagte Liutprant, schon gereizt durch geringschätzige Behandlung: »Wir Langobarden, Sachsen, Franken, Lothringer, Bayern, Schwaben und Burgunder verachten die Römer so sehr, dass wir im Zorn für unsere Feinde kein anderes Schimpfwort haben als Römer.« Zweihundert Jahre später waren aus den Langobarden Lombarden geworden, und ihr germanischer Ursprung glich den Gegensatz zwischen Deutschen und Italienern nicht mehr aus. Wohl aber bestand im Norden noch lange ein germanisches Zusammengehörigkeitsgefühl. Wenn es auch englische und schwedische, dänische und norwegische Königreiche gab, die sich untereinander bekriegten, wenn auch die Sachsen und Friesen sich bewusst waren, zum Römischen Reiche Deutscher Nation zu gehören, wenn sie auch verschiedene Sprachen redeten und verschiedene Ziele verfolgten, so fühlten sie sich doch als Nordleute, verbunden durch das nordische Meer, das gegen ihre Küsten flutete, das ihre Schiffe befuhren, das ihr gemeinsames Schicksal war. Oft scheint es sogar, als fühlten die Sachsen mehr Verwandtschaft zu den Angelsachsen, Dänen und anderen Nordleuten als zu den Schwaben und Bayern; selbst das bedeutende Moment der Zusammengehörigkeit, das das Christentum bildet, kommt nicht immer gegen das germanische Verwandtschaftsgefühl auf.
Clarum inter Germanos Frisiorum nomen. Berühmt ist unter den Deutschen der Name der Friesen, sagte Tacitus. Kaum erscheint ihr Name in der Geschichte, hatten sie schon Taten getan, die sie als Rächer ihrer Freiheit zeigten. Weder Herren noch Knechte litten sie unter sich. Jahrhunderte hindurch war ihre Chronik Kampf und Sieg über alle, die sie unterwerfen wollten. Viele Grafen von Holland, die die Friesen als ihre Untertanen betrachteten, fanden in ihren Sümpfen ihr Grab. Wie die Möwen, die sich kreischend vor gieriger Lust in den Sturm werfen, wenn sie am Strande gehen, etwas von gemütlichen Enten haben, so sagt man von den Friesen, dass sie daheim stumpfsinniger Untätigkeit verfallen; aber wenn eine Sturmflut Deich oder Vieh bedroht, oder auf dem Meere, stürmen sie furchtlos in die Gefahr, ringen sie wie ein unbändiges Element mit den Elementen. Dieser Friesenstolz war allen Nordleuten bis zu hohem Grade eigen. Man hat bemerkt, dass die Sprache der Friesen der englischen näher als der deutschen verwandt ist, von der sie sich stärker als ein Dialekt unterscheidet, und dass sie auch im Charakter den Engländern gleichen; allein auch den Sachsen waren sie so ähnlich, dass es schwer ist, eine bestimmte Grenze zwischen Sachsen und Friesen zu ziehen. Waren doch auch die Engländer damals unvermischte Sachsen, vielleicht schon mit Friesen verschmolzene. Meeranwohner waren sie alle, als Kinder des Meeres einander verschwistert. Sachsen und Friesen waren viel eher Christen geworden als die Skandinavier; aber wie diese waren jene durch die wilde Taufe des Meeres gefeit, ein Geschlecht, das mitten im Untergang, wenn Erde und Sterne wanken, die Wonne seiner Kraft am sichersten fühlte. Auf den ewig von Stürmen umsausten Dünen wuchsen keine Bäume, gab es keine heiligen Haine; heilig war dort die Freiheit. Noch jahrhundertelang beteten auf den friesischen Inseln die Pfarrer selbst um gesegneten Strand, nämlich dass viele Schiffe scheiterten. Als die Blutrache längst nicht mehr im Schwange war, schlugen die Angehörigen eines Getöteten noch mit dem Schwert an die Kirchhofspforte und an die Tür des Mörders und murmelten: Rache! Rache! Die Weisen, die beim friesischen Festmahl zur Harfe gesungen wurden, waren bald stürmisch, bald unsäglich süß und zwangen alt und jung zu tanzen, tolle, heidnische Tänze, bis sie besinnungslos hinfielen. Die nordischen Glaubenshelden behielten als Christen ihre schwungvolle Faust. Bischof Evermod von Ratzeburg wollte einmal einen vornehmen Dithmarschen, dem ein Verwandter erschlagen worden war, bewegen, von der Rache abzustehen. Vergebens predigte er ihm die Grundsätze christlicher Nächstenliebe, vergebens drang er mit Bitten und Flehen auf den Unversöhnlichen ein, endlich fiel er ihm zu Füßen. Der Dithmarsche verschwur sich mit schrecklichen Eiden, sich niemals mit dem Beleidiger zu versöhnen. Da holte der Bischof aus und versetzte dem Manne einen gewaltigen Backenstreich, worauf der Dithmarsche nachgab und verzieh. Außerordentlich stark und verwegen war Dankbrand, der Sohn eines sächsischen Grafen. Nachdem er wegen eines schönen Mädchens mit einem dänischen Großen in Streit geraten war und ihn erschlagen hatte, floh er nach England und wurde dort Kaplan des berühmten norwegischen Königs Olaf Tryggvason, der soeben mit der ungestümen Leidenschaft, die ihm eigen war, das Christentum ergriffen hatte. Olaf Tryggvason war ein König nach dem Herzen der Nordleute: fröhlich, prächtig, glücklich und gütig, im Zorne unaufhaltsam zerstörend wie das Feuer. Er begann sofort die Heiden zu bekehren und schickte den kühnen Dankbrand zu diesem Zwecke nach Island. Einige Heiden, die sich der Taufe widersetzten, schlug Dankbrand sofort tot, einem besonders starken Helden erbot er sich, die Überlegenheit seines Gottes im Zweikampf zu beweisen. Trotz mancher auf diese Art errungenen Erfolge hielten es die erstaunten Isländer für ratsam, den gefährlichen Missionar aus ihrem Lande zu verbannen. So waren die nordischen Küstenbewohner: funkelnd vor Kraft und Übermut und Grausamkeit wie das Meer, halb Kinder, halb Riesen.
Meerkönig im Norden zu werden, die verschiedenen, das friesische Meer begrenzenden Länder zu einem Reich zusammenzufassen, war eine Lockung für Erobererherzen. Dänen und Deutsche kamen dabei hauptsächlich in Betracht, Dänemark und Deutschland haben jahrhundertelang um die Beherrschung der Nord- und Ostsee gerungen, bald kämpfend, bald sich vertragend. Der erste, der die Aufgabe mit großem Sinn erfasste, war der König von Dänemark, Knut, der im Beginn des 11. Jahrhunderts England mit seinem Lande vereinigte und musterhaft regierte. Sein Ansehen war so überzeugend, dass Konrad II., der damalige Kaiser, es für das beste hielt, in Freundschaft mit ihm auszukommen, ihm das Land zwischen Eider und Schlei abtrat, seinen Sohn Heinrich mit Knuts Tochter verheiratete. Auch Erzbischof Unwan von Bremen, ein Nachkomme Widukinds und Vetter des Bischofs Meinwerk von Paderborn, dem er darin glich, dass er angestammten Reichtum seinem Bistum zugute kommen ließ, unterhielt mit Knut freundschaftliche Beziehungen. Er empfing ihn in Hamburg, wo er gern Hof hielt, um ihn zu ehren, zugleich aber auch, ihm einen Eindruck von seiner fürstlichen Macht zu geben. Die Erzbischöfe von Hamburg-Bremen waren die größten Herren im deutschen Norden, mächtiger als die Herzöge von Sachsen, die eifersüchtig sie zu schädigen trachteten. Es war deshalb natürlich, dass einem von ihnen die Vision des Nordischen Reiches aufging, wenn sie es auch nur in kirchliche Grenzen bannen konnten.
Nachdem Knut und Unwan gestorben waren, ernannte Heinrich III. Adalbert, einen Grafen von Goseck, zum Erzbischof von Bremen. Gegenüber von Naumburg sind noch Reste seiner Stammburg erhalten, die er und seine Brüder in ein Kloster verwandelten. Von allen Leidenschaften, die diesen ungewöhnlichen, hochbegabten Mann bewegten, war Ruhmbegierde die stärkste. Man hätte denken können, ihr wäre Genüge getan, als der Kaiser, der ihn hochschätzte, ihn zum Papst machen wollte; aber er lehnte es ab, um ein Patriarchat im Norden zu errichten. So sehr hatte der Norden seinen Sinn berückt. Allerdings konnte er im Norden unabhängiger sein als ein vom Kaiser ernannter Bischof von Rom. Um die nordischen Angelegenheiten bekümmerten sich die Kaiser wenig: es war keine Unterstützung, aber auch keine Einmischung von ihnen zu erwarten. Hier war alles neu und fremd, Abenteuer, unbegrenzte Möglichkeit. Der Blick des jungen Mannes, der in den türingischen Wäldern gefangen gewesen war, schweifte entzückt über das britannische und das baltische Meer, über nie gesehene Inseln bis dahin, wo in Dunkel und Grauen die Erde endet. Diese Länder waren zum Teil noch heidnisch, zum Teil noch nicht im Christentum befestigt; durch lebhafte Missionstätigkeit konnte die Kirche von Bremen hoffen, sie sich kirchlich unterzuordnen, war sie doch mit Hinblick auf diese Aufgabe gegründet, die nur durch unglückliche Umstände und durch die Nachlässigkeit mancher Bischöfe nicht erfüllt war. Es war ein ähnlicher Gedanke, wie im Südosten des Reiches Bischof Pilgrim von Passau ihn gehegt hatte.
Aus eigener Anschauung hatte Adalbert keine Kenntnis der nordischen Länder; aber er sammelte so viel Nachrichten über sie wie möglich. Mit den Slawen, die Mecklenburg und Pommern bewohnten, gab es Beziehungen, denn an der Mündung der Oder lag Jumne, die reichste Handelsstadt der Welt, wo kostbare Erzeugnisse ferner Länder getauscht wurden. Es war bekannt, dass man von dort zu Lande nach Griechenland gelangen konnte, wenn auch dieser Weg wegen der unberechenbaren Sinnesart der anwohnenden Völker vermieden wurde. Weiterhin nach Osten warf das Meer den goldgelben Bernstein ans Ufer, mit dem die Frauen des Südens sich schmückten, und noch weiter oben lag das seltsame Land der Amazonen, von denen man sagte, dass sie durch ein Wasser, das dort fließe, schwanger würden, andere meinten durch vorüberreisende Kaufleute, die sie gefangennähmen und nach dem Gebrauch wieder verstießen. Sie erzeugten Mädchen von wunderbarer Schönheit und Söhne mit Hundeköpfen. Zurzeit des Erzbischofs Alebrand, der vor Adalbert regierte, taten sich einige vornehme Friesen zusammen, um zu erkunden, ob es wahr sei, dass man von der Mündung der Weser aus immer nordwärts fahrend zum grenzenlosen Weltmeer komme. Nachdem sie sich eidlich miteinander verbunden hatten, fuhren sie ab, ruderten an Dänemark, Schottland und Island vorüber und gerieten plötzlich in den Nebel des weltendenden Meeres. Dort riss sie ein Strudel mit, der ihrer Meinung nach dadurch entstanden sei, dass dort alle Strömungen Ursprung und Ausmündung hätten, verschlang einige Schiffe und spie andere wieder aus. Sie kehrten nach Bremen zurück und erzählten dem Erzbischof ihre Erlebnisse. Bei Island, sagten sie, sei das Eis des Ozeans schwarz und so trocken vor Alter, dass es angezündet brenne. Sicherere Nachrichten gab es über die skandinavischen Länder. Nicht nur dass schon der heilige Ansgar am Mälarsee gewesen war, Adalbert stand in freundschaftlicher Beziehung zum schwedischen König Sven Esthritson, in dessen Gedächtnis die Geschichte der nordischen Völker wie in einem Buche geborgen war. Man kannte Fünen mit der großen Stadt Odense, Seeland mit Röskilde, dem dänischen Königssitz, Schonen mit Lund, die fruchtbarste dänische Landschaft, wo es schon 300 Kirchen gab. Schweden schilderte der König als ein ebenfalls an Vieh, Früchten und Honig reiches Land, dem auch viel Waren aus der Fremde zugeführt würden; herrlich sei der goldene Tempel von Uppsala, wo alle neun Jahre, zurzeit der Frühlings-Tagundnachtgleiche alle schwedischen Völker zusammenkämen und ein Fest feierten. Norwegen dagegen sei rau, ungeheuer kalt, unfruchtbar, arm. Das Volk lebe von Viehzucht, nur an Milch und Wolle sei es reich. Er erzählte von den schwarzen Füchsen und Hasen, weißen Mardern und Bären, die es oben im Norden gäbe, und von den Finnen, die auf Schneeschuhen die Ure, Büffel und Elche überflügelten, die sie jagten. Alle Nordleute, aber ganz besonders die Finnen, kannten noch die alten Zauber; so wussten sie durch gemurmelte Sprüche die Walfische in ihre Gewalt zu bringen. Je mehr man nach Norden kam, desto mehr war heidnische Zauberei im Schwange.
Den Charakter der Nordleute stellte man an Adalberts Hofe nach allem, was man davon sah und hörte, sehr hoch. Sie besaßen die von den Deutschen so geschätzten Eigenschaften der Tapferkeit und des Stolzes; sie ließen sich lieber töten als züchtigen; von einem zum Tode Verurteilten erforderte der Anstand, unbekümmert fröhlich zu erscheinen. Sie verachteten Gold und Silber, Pelzwerk und feine Stoffe, und ihre Gastfreiheit war unbegrenzt. Es machte tiefen Eindruck, dass in manchen Gegenden Schwedens und Norwegens die vornehmsten Männer Viehhirten waren wie die Erzväter der Bibel, dass die Schweden noch keine Städte hatten und ihr Leben in Armut und heiliger Einfalt zubrachten. Sie waren so liebevoller Gesinnung, dass sie alles gemeinsam besaßen, und zwar nicht nur die Einheimischen untereinander, sondern die Fremden inbegriffen. Dies, sagte man, sei nicht eine Folge des Christentums, sondern ihre Natur sei christlich, ohne dass sie von Christi Lehre etwas wüssten. Die gebildeten Deutschen betrachteten die Nordleute gerührt wie etwa Tacitus die Germanen.
Sowohl in Dänemark wie in Schweden gab es schon christliche Kirchen und Gläubige, überhaupt ließ sich das Volk dort oben gern von Christus und seinen Taten erzählen; aber die deutschen Christen waren es, so erfuhr man, die die Ausbreitung des Christentums erschwerten. Ihr Beispiel schreckte ab, da sie das, was sie lehrten, nicht durch ihr Leben verwirklichten. Besonders die Habgier, mit der sie Steuern auflegten, und die Härte der Einforderung derselben erregten Unwillen; beides wurde dem Herzog Bernhard von Sachsen vorgeworfen, der ohnehin Adalberts Feind war. Auch der Slawen Freigebigkeit und Gastfreiheit hob sich preiswürdig ab von der christlichen Habgier. Die Anerkennung schöner und edler Eigenschaften der Heiden führte nicht etwa zur Herabsetzung des Christentums, sondern zu dem verstärkten Wunsche, diese Heiden zu Christen zu machen, damit sie das einzige erwürben, was ihnen fehlte. Denn erst als Christen waren sie Glieder des Reiches, traten sie ein in den gotterfüllten Raum des Himmels und der Erde, des Lebens in der Ewigkeit. Es war ein Zauber, der die Menschen verklärte, auch wenn er ihr Inneres nicht verwandelte.
In einem Punkte nur fand man die Nordleute zu tadeln, in der Maßlosigkeit nämlich, mit der sie sich sinnlichen Genüssen hingaben. Sie berauschten sich im Trunk und in der Liebe, und weder das Trinken noch die Frauen wollten sie sich nehmen lassen. König Sven wurde vom Volke wegen der großen Zahl seiner natürlichen Kinder König Vater genannt. Die Menge der Beziehungen hinderte nicht, dass sie einer einzelnen Frau mit beharrlicher Leidenschaft anhingen. Sven hatte nach dem Tode seines Vorgängers auf dem schwedischen Throne dessen Witwe Gunhild geheiratet, die nach der Ansicht der Kirche in einem verbotenen Grade mit ihm verwandt war. Da die dänischen Bischöfe ihn bei Adalbert deswegen anklagten und Adalbert, in diesem Punkte unerbittlich, ihm riet, sich von seiner Frau zu scheiden, weigerte er sich, musste schließlich aber doch nachgeben. Adalbert hatte Mühe, den Erbitterten zu versöhnen. Die Frau, die er dann heiratete, wurde von seiner Geliebten vergiftet. Adalbert, der selbst, augenscheinlich mehr infolge natürlicher Veranlagung als aus Askese, keusch war, verachtete die, welche ihre sinnlichen Gelüste nicht beherrschen konnten. Davon abgesehen mochte er sich dem Ausschweifenden und Fantastischen der nordischen Menschen verwandt fühlen. Mönchische Dürre war ihm fremd; es war, als breche die verhaltene Sinnlichkeit mit doppeltem Überschwang aus seinem Geiste hervor. Er war ein Verschwender, der nur in der Fülle atmen konnte. Nach einem großen Brande baute er den Dom von Bremen nach dem Muster des Doms von Benevent fremdartig und über alle Gewohnheit prächtig. Er liebte das Alte Testament, wo der Herr sich in seiner Majestät offenbart. Obwohl er an guten Tagen ohne Geselligkeit nicht leben konnte, empfand er leicht Verachtung für die Menschen. Freigebigkeit, sagte er, sei ein Merkmal des Adels; das Überwiegen von Kleinlichkeit, Dummheit und Habgier an den Menschen erregte seinen Hohn. Seine Pläne waren Visionen, die auf die Wirklichkeit wenig Rücksicht nahmen; das galt besonders von seinem größten, seinem eigentlichen Plan, den geheimnisvollen, urgewaltigen Norden zu seiner Diözese zu machen. Eine Zeit lang schien es, als sollte dieser mächtige Traum, der dem deutschen Einfluss ein neues, ausgedehntes Gebiet eröffnete, Gestalt gewinnen, als der deutsche Bruno von Toul den Heiligen Stuhl innehatte. Seine Regierung war zu kurz, als dass ein so wenig vorbereitetes Unternehmen vom Papst hätte an Hand genommen werden können. Das nordische Patriarchat sollte nach Adalberts Meinung zwölf Bistümer umfassen, von denen noch keines vorhanden war. Die Bekehrung machte keine nennenswerten Fortschritte. Es gehörte zu Adalberts Plänen, dass er selbst den Norden bereisen und den Heiden predigen würde; aber als König Sven ihm riet, die Aufgabe einem Einheimischen zu überlassen, der der Sprache mächtig sei, ließ er sich leicht überreden. Als ein großer Träumer badete er seine Stirn in Ruhm, ohne daran zu denken, dass der vorgefühlte Glanz durch Arbeit und mühselige Tage in die Wirklichkeit geleitet werden müsse. Allerdings nahm der Königsdienst seine Kraft und Zeit sehr in Anspruch: er begleitete Heinrich III. auf allen seinen Heerfahrten und stand in den Anfängen Heinrichs IV. eine Zeit lang an der Spitze der Reichsregierung. Wenn er den ungenügenden Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, schuld gab, dass er seine Gedanken nicht verwirklichen könne, hatte er nicht ganz unrecht; er sagte einmal, es fehlten ihm zum herrlichen Ausbau seiner Kirche nichts als Geistliche und Steine.
Einmal jedoch begegnete Adalbert einem Ebenbürtigen, wenn auch im Charakter ganz von ihm Verschiedenen, in dem Slawen Gottschalk. Ein Obotritenfürst war so weit für das Christentum gewonnen worden, dass er seinen Sohn dem Michaelskloster in Lüneburg zur Erziehung übergab, wo er den Namen Gottschalk annahm. Als dem Jüngling die Kunde zukam, dass sein Vater von den Sachsen ermordet worden sei, floh er aus dem Kloster, um Rache zu nehmen. Tausend Sachsen sollten fallen für einen Wenden. Nach mörderischem Wüten unter den Feinden wurde er von Herzog Bernhard von Sachsen gefangengenommen, der aus Achtung vor der Tapferkeit des Gegners ihm die Freiheit schenkte unter der Bedingung, dass er das Land verlasse. Gottschalk ging nach Dänemark, befreundete sich mit König Knut und begleitete ihn nach England. Dort wurde er vom Christentum, das er als Knabe wie andere Schulaufgaben gelernt hatte, im Innersten ergriffen und wünschte nun, seinem Volke diesen Glauben mitzuteilen. Er kehrte zurück, setzte sich mit Adalbert ins Einvernehmen und entwarf mit ihm den Plan eines Bekehrungsversuches unter den Wenden. Was Adalbert angriff, bekam einen großen, schwungvollen Umriss: ein christliches Wendenreich sollte gebildet werden, an dessen Spitze Gottschalk stehen sollte unter dem Schutze des Erzbischofs. Als eingeborener Fürst, der Sprache kundig und von der Kraft des aufrichtigen Glaubens durchdrungen, erzielte Gottschalk bedeutende Erfolge; es konnte ein Bistum Aldenburg den Bistümern Mecklenburg und Ratzeburg hinzugefügt werden. Adalberts Freund Sven Esthritson trat in die Verbindung ein, indem er Gottschalk seine Tochter Sigrid zur Frau gab. Bremens beherrschender Einfluss über das benachbarte Slawenland schien gesichert zu sein.
Da verriet ein furchtbarer Aufstand, zu dem der Sturz Adalberts im Jahre 1066 das Zeichen gab, dass der Hass der Wenden gegen die Christen und ihren Gott nicht erloschen sei: Gottschalk wurde erschlagen, ebenso die Bischöfe von Mecklenburg und Ratzeburg; wie Opfertiere wurden sie den heidnischen Göttern geschlachtet.
Adalbert sang wie das Standbild der Sage einen Hymnus des Lebens, wenn die Sonne des Glücks ihn berührte; dem Unglück gegenüber hatte er keine Widerstandskraft. Um dem Bischof von Würzburg gleichzukommen, der fast alle Grafschaften in seiner Diözese und zugleich die Herzogsgewalt besaß, hatte er möglichst viele Grafschaftsrechte aufgekauft und den umwohnenden Adel zu Vasallen gemacht und war dadurch in Schulden geraten. Seine königlichen Lebensgewohnheiten aufzugeben, war ihm unmöglich, lieber verkaufte er die Kirchenschätze und gab dadurch seinen zahlreichen Feinden Anlass, ihn der Ketzerei und Zauberei zu beschuldigen. Als es ihnen gelungen war, ihn von Hofe zu verdrängen, und er schutzlos den Übergriffen der Herzöge von Sachsen preisgegeben war, flüchtete er aus der hässlichen Wirklichkeit tiefer in seinen Traum, der allmählich fast Wahn wurde. Um die Einzelheiten der Verwaltung hatte er sich nie kümmern mögen, die Folge war, dass er von allen Seiten betrogen wurde. Seine jähen Zornausbrüche, wenn er es erfuhr, wurden verlacht oder machten ihn verhasst. Wenn er auch nach drei Jahren in seine Würde wieder eingesetzt wurde und Beweise königlicher Gunst in Fülle davontrug, so vermochte er doch weder sein Erzbistum noch seine verwilderte Seele neu zu ordnen. Um ihn herum bröckelte alles ab. Anstatt dem Verfall ernstlich zu wehren, raffte er gewaltsam zusammen, so viel er konnte, und wenn er von nutzlosem Auftrieb ermüdet war, wiegte er sich mit Musik und Märchen in Schlaf.
Adalberts großartige Gedanken in Bezug auf ein nordisches Patriarchat fanden nach seinem Tode, als mit Gregor VII. eine dem deutschen Reiche feindliche Stimmung zur Herrschaft gekommen war, kein Verständnis mehr in Rom. Nun empfing König Sven schmeichlerische Briefe vom Papst mit Aufmunterungen, die nordischen Reiche durch Gründung eines eigenen Erzbistums von den Deutschen zu befreien. Sven jedoch, dem die Abhängigkeit von Rom nicht lockender erscheinen mochte als die vom Kaiser, antwortete nicht. Er starb fünf Jahre nach Adalbert. Sein Nachfolger verhielt sich gegenüber weiteren Bemühungen Gregors, eine schwedische Nationalkirche zu gründen, ebensowenig zugänglich, erst Paschalis II. erhob im Jahre 1104 das Bistum Lund zum Erzbistum und übertrug ihm die Leitung des ganzen skandinavischen Nordens. Einige Jahrzehnte später trat in Erzbischof Eskil ein Mann auf, der den neuen Anspruch energisch ins Werk setzte. So war denn im Norden ebenso wie im Südosten der deutschen Kirche der Einfluss abgeschnitten, den sie anfangs auf die heidnischen Völker ausgeübt hatte, und Skandinavien wie Ungarn und Polen unmittelbar dem Papst unterworfen. Tatsächliche Herrschaft über die umwohnenden Völker auszuüben, hatten die Deutschen nicht Kräfte und Mittel genug, und überall begegneten ihnen hervorragende Männer, die ihnen die Kraft des fremden Volkstums entgegensetzten. Innerhalb dieser Wechselwirkung aber hatte das deutsche Volk, das Träger des Weltreichsgedankens war, doch noch ein so großes Übergewicht, dass es Angriffe nicht zu fürchten brauchte und mit dem Glanz seines ruhmreichen Namens weithin wirken konnte. Den slawischen Nachbarn entriss es sogar in langen, schweren Kämpfen so große Gebiete, dass damit fast ein neues Reich dem alten hinzuwuchs.