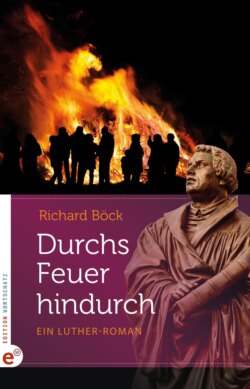Читать книгу Durchs Feuer hindurch - Richard Böck - Страница 11
Оглавление5.
Konfrontation
Die ersten Sonnenstrahlen des Tages tauchten das Zimmer in ein freundliches, helles Licht. Es hätte ein wunderbarer Sommermorgen sein können, wäre es ein üblicher Tag mit seinem für Martin gewohnten Ablauf gewesen. Vielleicht hätte Martin zur Laute gegriffen, ein Lied angestimmt. Bei schönem Wetter riss er als erstes das Fenster auf, um die Sonnenstrahlen zu genießen. Dann war er frohgemut. Er atmete die Sommerluft ein und freute sich auf seine Vorlesungen. Doch dieser Morgen lastete schwer auf dem jungen Mann. War er am Abend zuvor noch froh, sich endlich entschieden zu haben, so war das Erwachen am Morgen danach wie nach einem Keulenschlag. Es war ihm kaum möglich, seinen schweren und etwas dröhnenden Kopf zu heben. Sein Schädel fühlte sich wie ein Bergwerk an, in dem gemeine Zwerge mit ihren Spitzhacken gegen seine Schädeldecke hämmerten. Die rechte Hand schützend vor den Augen stöhnte er leise. »Wohin wollte ich heute? Zu den Augustinern?«
Vorsichtig und behutsam begab er sich in Sitzposition. Er wollte jede Erschütterung vermeiden. Wenn nur nicht dieses heftige und ständige Hämmern gegen die Stirn gewesen wäre …
Wäre er nicht absolut davon überzeugt gewesen, dass ihm sein Leben noch einmal geschenkt worden war, so hätte er sein Vorhaben an diesem schönen sonnigen Tag als einen Wahn bezeichnet. Er verkniff sich ein sarkastisches Lachen, denn er wollte nicht erneut von diesen furchtbaren Kopfschmerzen gepiesackt werden. Die Hand an die Stirn gelegt, ließ er den gestrigen Abend noch einmal Revue passieren.
»Als Mönch passiert dir so etwas nicht!« Dieser Gedanke zauberte ein kleines, aber schmerzverzerrtes Lächeln auf seine Lippen.
Als er endlich auf der Bettkante saß, blinzelte er in den Raum. »Ein Himmelreich für noch eine Stunde Schlaf.« Doch sein Vorhaben ließ kein Zögern zu. Vorsichtig griff er hinter sich und rückte seinen in festes Leinen genähten Strohsack zurecht. Auf dem Hocker neben seinem Bett stand der Kerzenhalter, den ihm seine Eltern zum Einzug in sein Studentenzimmer geschenkt hatten. Rechts neben der Bettstatt war sein nur noch mit wenigen Büchern gefülltes Regal. Die meisten und wertvollsten hatte er schon während der letzten Tage verkauft. Vier Schritte waren es zur Türe. Rechts davon eine Truhe, die seine übrigen Utensilien enthielten. Durch das Fenster bahnte sich ein Sonnenstrahl seinen Weg durch die Stube. Tausende Staubteilchen tanzten in dem hellen Streifen. Die Helligkeit trieb einen schmerzenden Stich in Martins Augen, die sich mit Tränen füllten und zugleich alles verschwommen erscheinen ließen. Er blickte auf sein Schreibpult unter dem Fenster. Es war aus grobem Holz zusammengezimmert. Wie viele Stunden hatte er hier verbracht. Und wie glücklich war er, wenn er eine Aufgabe zu seiner Zufriedenheit fertig gestellt hatte. Ja, das Studieren hatte ihm viel Freude bereitet. Er lernte nicht nur, damit die Professoren mit ihm zufrieden waren. Nein, er war begierig Neues zu erfahren. Würden die Augustiner ihn aufnehmen, so wäre all das, was die letzten Jahre seines jungen Lebens ausgemacht hatte, vorbei und wertlos. Wie war das zu verkraften? Würde er es schon nach ein paar Tagen bereuen? Er wusste, wozu er sich entschieden hatte.
Sieben Glockenschläge unterbrachen seine Gedanken und erinnerten ihn an sein Vorhaben. Und sein Gelübde. »Ich vergesse es nicht. Nur keine Bange!«, murmelte er vor sich hin, während er sich ankleidete. Ihm war die Wende in seinem Leben bewusst. Was er hinter sich ließ, schien ihm klar zu sein. Was vor ihm lag, wusste er nicht so genau. Daher stürmten Fragen über Fragen auf ihn ein. Es war bekannt, dass die Augustiner im »Schwarzen Kloster« nicht jeden aufnahmen. Sie wählten genau aus. Was ist, wenn er mit seiner Bitte um Aufnahme scheiterte?
Er verdrängte diese Möglichkeit, so gut es ging. Zum wiederholten Male musste er an seine Mutter denken. Er wusste, dass er ihr mit seiner Entscheidung sehr wehgetan hatte. Und auch Bärbel, mit der er sich verlobt hatte, die auf ihn wartete. Was wird aus ihr? Und könnte er jemals wieder seinem Vater ins Gesicht sehen? Martin wusste, dass er wohl am meisten enttäuscht war. Der Gedanke an seinen Vater erschien ihm kaum weniger bedrohlich als der Gewittersturm damals. Martin fühlte sich plötzlich kraft- und hilflos. Bisher wurde jeder seiner Schritte von seinem Vater entschieden. Martin galt solange als guter Sohn, wenn er das tat, was der Vater für richtig hielt. Und alles musste der großen Karriere dienlich sein. So viele Jahre schon war ihm all dies zuwider. Eine Bürde, die schwer auf ihm lastete, ihn niederdrückte. Natürlich war es die Todesangst in diesem grausamen Gewitter, die ihn zu diesem Gelübde gedrängt hatte. Doch tief in seinem Innersten spürte er, wie befreiend der Gedanke war, einmal das tun zu können, was er selbst entschieden hatte und selbst zu verantworten habe – auch wenn der »Wink« von oben kam.
Kaum hatte er das Haus verlassen, fühlte er sich beobachtet. Es war ein für ihn bisher unbekanntes Gefühl. Egal in welche Richtung er sich drehte und blickte, niemand war zu sehen. Er suchte die Umgebung ab, aber er konnte niemanden entdecken; und doch meinte er, beobachtet zu werden. Es war irgendwie unheimlich. Und jetzt, ganz plötzlich, wusste er, dass noch irgendetwas geschehen würde. Irgendetwas würde sich ereignen, bevor er das »Schwarze Kloster« erreicht haben würde.
Er setzte seinen Weg fort. Die Straße war leer. Vielleicht hatte er sich getäuscht. Da hörte er ein Plätschern. Es kam vom Brunnen auf der anderen Straßenseite. Wie oft war er schon an diesem Brunnen vorbeigegangen und nie war ihm das Plätschern aufgefallen. Warum auf einmal? Warum heute? Martin gab sich einen Ruck und überquerte die Straße, um einen Schluck zu trinken. Er spürte, dass er nervös war. Gerade hatte er einen Schluck Wasser aus der hohlen Hand getrunken, als er Hufgetrampel hörte. Um sein Gesicht zu kühlen, schöpfte er erneut kühles Nass und rieb es sich in Gesicht und Nacken. Kaum vom Brunnenrand erhoben, sah er ein schnaubendes Pferd auf sich zustürmen. Mit ihm eine Wolke voller Staub und Pferdeschweiß. Der Reiter hatte seinen Gaul gejagt, nun stand er dampfend und stampfend vor ihm. Martin konnte gegen die Morgensonne den Reiter nicht sofort erkennen und beschattete daher mit beiden Händen die Augen. Er blinzelte noch etwas, aber dann war ihm sofort klar, wer vor ihm auf dem Pferd saß: sein Vater.
Sein Gefühl, beobachtet zu werden oder dass noch etwas passieren würde, hatte ihn also nicht getäuscht. Insgeheim hatte er mit dieser Begegnung gerechnet. Vielleicht auch ein wenig gehofft. Er wollte die Angelegenheit geklärt wissen, da er befürchtete, dass sein Brief nicht alle Fragen der Eltern beantwortet hatte. Eine leise Hoffnung keimte in Martin auf, sich versöhnlich verabschieden zu können – mit dem Segen des Vaters.
So schnell wie Hans Luther herangesprengt war, so schnell sprang er auch vom Pferd. Bevor ihn Martin begrüßen konnte, donnerte der Vater bereits los:
»Ich könnte dich auf der Stelle packen und in den Brunnen werfen, wenn ich an den Unsinn denke, den du uns geschrieben hast.«
»Vater …«
»Hör auf damit. Du nennst mich ›Vater‹ und wie behandelst du mich? Wie einen Stallknecht. Als Vater erwarte ich Respekt! Und ich erwarte Gehorsam! Wer hat dich denn auf diese irrsinnige Idee gebracht, ins Kloster zu gehen?«
»Ich habe Euch geschrieben. Habt Ihr meinen Brief nicht gelesen?«
Da wurde Hans Luther laut: »Und ob ich ihn gelesen habe. Diesen Unsinn. Diesen Wahnsinn. Wer hat dir denn diesen Floh ins Ohr gesetzt?«
Martin setzte sich auf den Brunnenrand: »Ich habe es Gott versprochen!«
Hans Luther griff sich an den Kopf, blickte prüfend um sich, ob nicht jemand mithören konnte, und sprach nun leiser, aber nicht weniger eindringlich: »Wie viele hatten schon in Todesgefahr etwas gelobt, etwas versprochen? Wer tut das nicht? Aber danach muss man wieder die Vernunft walten lassen. Niemand von uns will in einem Gewitter umkommen. Aber deshalb muss man doch nicht sein jahrelanges Studium wegwerfen, als wäre es ein kaputtes Möbelstück.«
Auf der anderen Straßenseite gingen andächtigen Schrittes zwei Mönche vorüber. Hans zog seinen Sohn aus dem Sonnenlicht in den Schatten einer mächtigen Linde am Straßenrand: »Schau sie dir an! Willst du dein Leben lang so herumlungern und um Almosen bitten wie die Beiden?«
»Warum nicht? Wenn es Gottes Wille ist!«
Hans Luther trat zwei Schritte zurück und musterte kopfschüttelnd seinen Sohn von Kopf bis Fuß: »So hast du nie geredet.«
Dann ging er zu seinem Pferd, streichelte ihm die Mähne und schwieg. Auch Martin wusste nicht, was er sagen sollte.
»Du weißt, dass ich kein Freund der Pfaffen bin?«, versuchte der Vater das Gespräch erneut in Gang zu bringen.
Kopfnickend begann Martin, seinen Weg fortzusetzen. Vater Luther hatte einem Knecht sein Pferd übergeben und ging neben seinem Sohn her: »Du lässt nicht mit dir reden?«
»Jeder muss seinen Weg gehen, Vater!«
Hans hielt seinen Sohn am Ärmel fest. Eindringlich sagte er: »Martin, das ist nicht dein Weg. Glaube mir. Die Augustiner sind der strengste Orden. Du bist dafür nicht geschaffen.«
»Ich werde es versuchen. Das bin ich mir selbst schuldig. Und ob es mir gelingt? Das weiß ein anderer!«
Hans raufte sich die Haare: »Du wirst Probleme bekommen. Das kann ich dir mit Brief und Siegel geben! Du wirst dein Fleisch spüren, Martin!«, hob er beschwörend seine Stimme, »noch jede zweite Nacht komme ich zu deiner Mutter. Und du, du bist ein junger Mann. Wie soll das gehen?«
Da antwortete Martin kurz und knapp: »Ich bin nicht der erste, der es probiert hat!«
Hans stellte sich vor seinen Sohn: »Martin, was ist mit dem Gebot, dass du Vater und Mutter ehren sollst?«
Ein tiefes Durchatmen, dem ein ebenso tiefer Seufzer folgte: »Ich weiß, ich weiß, Vater. Aber es heißt auch: Man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen!«
Langsam setzte Martin einen Fuß vor den anderen, sodass Hans rückwärts gehen musste. Hans blieb einfach stehen und zwang seinen Sohn ebenfalls zum Stehenbleiben: »Hör mir noch einmal zu, Martin: Was ist mit deiner Verlobten? Der Bärbel? Ein hübsches Mädchen aus gutem Haus. Weißt du, was es mich gekostet hat, ihren Vater dahin zu bringen, dich nur mal in Betracht zu ziehen. Ich war so froh, als er einwilligte. Weißt du, wie ich jetzt dastehe. Du machst mich damit zu einem Ochsen!«
Um Hilfe suchend blickte Martin nach oben: »Ich weiß. Aber sie wird schon noch einen anderen finden!«
»Das ist alles, was du zu sagen hast? Sie wird einen anderen finden! Du machst es dir ja recht leicht!« Hans Luther merkte nicht, wie laut er geworden war und dass Menschen auf der Straße stehenblieben und das Geschehen verfolgten, darum warnte ihn Martin mit dem Finger am Mund, leiser zu werden.
Hans wieder um mehr Ruhe bemüht, erinnerte seinen Sohn: »Weißt du, was es mich gekostet hat, dich auf die Schule zu schicken? Ich habe mich krumm geschuftet, damit du es eines Tages besser haben sollst. Welcher Bergarbeiter kann seinen Sohn auf die Universität schicken? Welcher, Martin?«
Martin schwieg. Er wusste, dass es keine Antwort gab, die seinen vor Wut glühenden Vater befriedigen könnte.
»Du willst mit dem Kopf durch die Wand gehen«, kam erneut laut und aufgeregt aus Hans Luthers Mund. »Von wem hast du diesen Dickschädel, Martin?«
Martin lächelte ein wenig und schaute vielsagend seinen zornigen, aber auch verzweifelten Vater an. Als Martin weitergehen wollte, hielt ihn sein Vater noch ein letztes Mal mit beiden Händen am linken Arm fest: »Martin, überlege es dir doch noch einmal. Bitte!«
Martin legte seine rechte Hand auf die Hände des Vaters, um sich aus seinem Griff zu befreien: »Ich habe es gelobt!«
Das waren die letzten Worte, die Martin an seinen Vater richtete, bevor er sich endgültig zur Pforte der Augustiner aufmachte. Hans blieb zurück. Er fühlte sich leer. Auf was könnte er jetzt noch hoffen? Dass die Brüder ihn nicht aufnehmen würden? Nein, diese Hoffnung konnte kein Trost sein. Die Entschlossenheit mit der Martin alles aufgegeben hatte, wofür er, der Bergmann, so lange geschuftet hatte, das war für ihn zu viel. Jetzt wollte er nur noch nach Hause. Bevor er um die nächste Ecke bog, sah er noch einmal an die Stelle zurück, an der sich Martin endgültig von ihm getrennt hatte. Wann würde er seinen Sohn wiedersehen?
Mit einem unverständlichen Murmeln zog er sich in den Sattel hinauf. Mitsamt dem Knecht, der bei dem Pferd verweilt hatte, machte sich Hans wieder auf den Nachhauseweg. Wie erklärt man einer Mutter, dass sie ihren Sohn womöglich auf Jahre hin nicht mehr zu Gesicht bekommen wird?