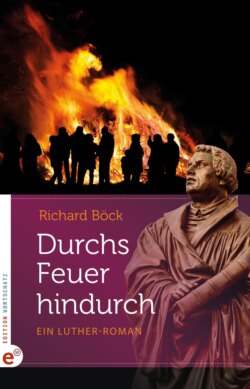Читать книгу Durchs Feuer hindurch - Richard Böck - Страница 15
Оглавление9.
So unheilig heilig
Die Monate vergingen wie im Flug und Martin legte in Wittenberg sein erstes theologisches Examen ab und erhielt den Titel »baccalaureus in biblia«. Zusätzlich zu seiner moralphilosophischen Vorlesung erhielt er den Lehrauftrag für einen biblischen Grundkurs an der Universität.
Inzwischen wirkte Martin gelöster. Nicht mehr so verkrampft wie in den Jahren zuvor. Zwar hatten sich einige Wogen geglättet, aber in ihm tobte noch immer ein Meer voller ungelöster Fragen. Das Schreckgespenst eines ungnädigen Gottes tauchte immer wieder vor ihm auf. Aber Dank der liebevollen seelsorgerlichen Begleitung durch von Staupitz versank er nicht mehr in Angst und Verzweiflung, wie noch während der Zeit in Erfurt.
Dort saßen die Verantwortlichen des Klosters zusammen und berieten über die Ordenspolitik. Vor ihnen lag ein Plan, der die klösterliche Lebensform in den verschiedenen Klöstern stärker vereinheitlichen sollte. Eine Minderheit, darunter die Erfurter Mönche, verweigerten ihre Zustimmung, wurden aber überstimmt. Sie beschlossen daher, Berufung einzulegen. Ein Pater wurde bestimmt, der in Rom ihren Wunsch vortragen sollte. Es dauerte nicht lange und man hatte sich für Martin als Begleitung des Procurators, Pater Nathin, entschieden. Obwohl Martin mitten in den Vorbereitungen auf seine Doktorarbeit steckte und er sich lieber seinen Studien widmen wollte, musste er gehorchen. Selbst seine Vorlesungen mussten dafür ausfallen.
Obwohl der Winter begonnen hatte, war man sich bewusst, dass diese Angelegenheit keinen Aufschub duldete. Daher mussten sich die beiden Mönche Mitte November auf den 1.200 Kilometer langen Weg machen. Und Rom war nur mühsam auf einem Weg über die Alpen zu erreichen.
Die beiden Geistlichen gingen, wie es für zwei Mönche Sitte war, hintereinander. Mit gesenktem Haupt und die Hände in ihren weiten Ärmeln verborgen. Um Übernachtungsmöglichkeiten brauchten sie sich keine Sorgen zu machen. Von einem Kloster zum nächsten führte sie ihr Weg. Es war ein Gewaltmarsch. Über den Passo del Settimo pilgerten sie weiter nach Mailand. Der Winter war nass und kalt, ihr Schuhwerk nur dürftig. Kälte kroch in sie und machte jeden Schritt zur Herausforderung. Aber Martin jammerte nicht, auch Pater Nathin biss die Zähne zusammen. Selbst Räuberbanden, die die Wege unsicher machten, schreckten die beiden Wanderer nicht. Sie vertrauten auf Gott und dass es am Abend eine warme Suppe im nächsten Kloster geben würde.
Als Martin mit seinem Mitbruder in Rom ankam, wunderte er sich, dass die Stadt nur 40.000 Einwohner zählte. Diese berühmte Stadt, das heilige Rom, hatte er sich anders, jedenfalls größer vorgestellt. Für ihn war Rom das Zentrum des Christentums, die Mutter aller Gläubigen, das Zentrum der Welt. Daher freute er sich sehr, hier an dieser heiligen Stätte zu sein. Neugierig beschritt Martin alle Pilgerwege und ließ sich die Reliquien zeigen. Er kaufte wie andere Gläubige Ablässe. Die Treppe zur Laterankirche rutschte er demütig auf den Knien hinauf. Auf jeder der 28 Stufen betete er ein Paternoster. Der Mönch Martin Luther tat alles, was andere Pilger für ihr Seelenheil ebenfalls unternahmen. Er tat dies alles, weil es dazu gehörte – alle es seit Generationen so machten. Bei alledem war er nicht blind. Im Gegenteil, er war ein aufmerksamer Beobachter des Lebens in der heiligen Stadt. So fielen ihm die beschämenden Zustände auf. Zum Beispiel hatte er Priester gesehen, die mit Prostituierten mitgingen. Selbst Kirchenleute, die sich selber über das Mysterium der Eucharistiefeier lustig machten. »Brot bist du und Brot bleibst du« soll gemurmelt worden sein. Viel lieber hätte er diese Dinge nicht gesehen und nicht gehört.
Nach vier Wochen erhielten die beiden Mönche die Antwort des Vatikans. Im Grunde war es keine Antwort. Einfach die Information, dass es dabei bliebe. Die Reformen würden durchgeführt. Was die beiden Augustinereremiten wollten, interessierte in Rom niemanden. So war die Mission der beiden Brüder beendet und gescheitert. Sie machten sich wieder auf den langen Rückweg. Es war jetzt Mitte Januar und tiefer Winter. Für den Rückweg wählten sie den Passo del Brennero, den Brennerpass.
Kaum ein Laut war zu hören, als die beiden Fratres durch die Schneelandschaft stapften. Wie sie gekommen waren, so gingen sie auch jetzt mit gesenkten Häuptern hintereinander her. Ab und zu hörte man den Flügelschlag eines Vogels, der die Flucht ergriff, nachdem er durch die Mönche aufgescheucht worden war, die fast in dem tiefen Schnee versanken. Schritt für Schritt ging es vorsichtig weiter. Auf den einsamen Bergpfaden hatten sie Zeit, über vieles nachzudenken. Martin schritt in Fußstapfen seines Mitbruders vorwärts. Den Blick so weit nach vorne gerichtet, dass er den Pfad nicht verfehlte. Obwohl sie schon den dritten Tag unterwegs waren, waren seine Gedanken immer noch in Rom und beschäftigten sich mit dem, was er dort gesehen und gehört hatte. Zutiefst verwirrt fragte er sich: »Dies soll das Herz, die Mitte der Christenheit sein? Diese Hektik. Selbst in den Andachten war es nicht möglich, zur Ruhe zu kommen. Nur ein Rennen und ein Hetzen, keine Stille und kein Trost.« Martin war bewegt und aufgewühlt. Seine Gedanken kreisten um Rom und um Erzählungen aus der Heiligen Schrift. Er musste daran denken, wie Jesus den Menschen begegnet war, und überlegte daher: »Wäre Jesus so mit den Menschen umgegangen wie die Kurienwächter in Rom mit uns umgesprungen sind, dann wären die Menschen damals schreiend weggelaufen und es würde kein Christentum geben!«
Auch musste er an die Geschichte mit den Jüngern denken, wie sie Kinder wegschicken wollten. Er hatte sie bei den Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas gelesen. Darin ermahnte Jesus seine herzlosen Jünger und nahm sich Zeit für die Kleinen. Ja, so stand es in der Heiligen Schrift: Er winkte die Kinder herbei und herzte sie. »Lasset die Kinder zu mir kommen«, befahl damals Jesus. »In Rom bin ich nicht geherzt worden,« dachte Martin, »aber gehetzt, von einem Ort zum anderen haben sie mich gejagt.« Martin konnte es immer noch nicht glauben, wie es dort zugegangen war. Auch die Dinge, die er über den Heiligen Vater gehört hatte, entsetzten ihn. Von Machtlüsternheit des Papstes sprachen die Menschen.
In Rom war alles möglich. Laster, Spott und fromme Gebete nebeneinander und durcheinander. Pilger wurden zur Eile angetrieben. Eigens dafür bestellte Vertreter der Kurie schritten ein, wenn ihnen ein Pilger zu lange an einer Stelle verharrte. Möglichst viele sollten ihre Ablässe kaufen, beichten und vor den vielen Heiligenbildern und Statuen beten können – und weitere Ablässe kaufen. Aber schnell, schnell sollte es gehen. Deshalb die gestrenge Überwachung und das Antreiben, damit jeder schnell beten und schnell Ablass kaufen konnte. All dies und noch mehr blieb ihm nicht verborgen.
Nach ihrem langen und mühsamen Marsch kamen die beiden Mönche in Augsburg an. Dort hatte Martin noch ein paar persönliche Besuche zu erledigen. Nun ging es weiter nach Nürnberg, und dann nach Erfurt. Dort mussten sie von ihrer Reise und ihren Gesprächen im Vatikan berichten. Die Enttäuschung war natürlich groß, dass die Delegation dort nichts erreicht hatte – all der Aufwand für nichts. Zumindest konnten die beiden erst mal ausruhen. Nach einiger Zeit schickten die Klosteroberen Martin wieder nach Wittenberg, um dort seine Doktorarbeit zu vollenden.
Als er im Herbst 1511 wieder nach Wittenberg kam, wurde er freudig empfangen. Fast ein Jahr war er weg gewesen, aber vergessen hatte ihn keiner. Auch Tölpel wedelte freudig mit dem Schwanz, als er Martin wieder erkannte.
Martin machte sich sofort an die Arbeit. Nach einem Jahr intensiver Arbeit stellte er seine Doktorarbeit fertig. Am 18. Oktober 1512 kam es zur Promotion zum Doktor der Theologie in der Schlosskirche. Der Fakultätsdekan Andreas Karlstadt nahm ihm feierlich den Doktoreid ab. Martin leistete den Eid, in Zukunft alles zu tun, um mit allen seinen Kräften treu die biblische Botschaft aus der Heiligen Schrift zu predigen und zu unterrichten.
Martin war überglücklich, dass er das geschafft hatte. Dieser große Tag sollte daher auch entsprechend gefeiert werden. Die Küche des Klosters hatte sich darauf eingestellt und leckere Speisen vorbereitet.
Martin hatte noch etwas mehr als eine Stunde Zeit. Daher ging er in sein Studierzimmer. In dem runden Turmzimmer fand er die nötige Ruhe. Mit Tölpel an seiner Seite wollte er wenigstens einige Minuten alleine sein und Gott danken, dass er trotz der vielen schweren Stunden seine Studien bewältigen konnte. Er faltete die Hände und betete: »Großer Gott, ich danke dir für diesen großen Tag. Du hast mich durch so viele schwere Stunden der Anfechtung geführt. Heute wurde mir die Auszeichnung »Doctor Theologiae« zuteil, ich danke dir, dass du mir Kraft und Geistesstärke geschenkt hast. In aller Demut bitte ich dich, dass ich ohne Rücksicht auf Menschenmeinungen dein Wort als heilig achte und alles in meiner Macht Stehende unternehme, um der Wahrheit zu dienen, um dir zu dienen. Schenke mir einen wachen Geist, dein Wort und deinen Willen zu erkennen. Ich danke dir für deine Nähe. Mit Eifer will ich deine Liebe den Menschen nahebringen. Im Namen Jesu. Amen.«
Martin hörte ein tiefes Schnaufen. Er sah sich um. Kein Mensch war zu sehen. Dann musste er lachen: »Du bist ja auch noch da, Tölpel!«
Es herrschten Ausgelassenheit und Gelächter an diesem Abend. Mitunter wurde es an den Tischen so laut, dass Martin seinen Tischnachbarn, Professor Karlstadt, nicht mehr deutlich verstehen konnte. Er rückte ihm deshalb ein Stück näher und fragte: »Was hatten Sie gesagt?« Dann gab es keinen Zweifel mehr. Martin hatte es tatsächlich richtig gehört: »Wann wirst du mich ablösen?« Gerade noch hatte Martin aus vollem Halse gelacht, nun nahm sein Gesicht ernstere Züge an: »Ihr Ansinnen ehrt mich. Aber ich glaube, dass so ein Tag in weiter, weiter Ferne liegt.« Karlstadt gab keine Antwort. Stattdessen stand er auf und hob seine rechte Hand. Gelächter und Stimmengewirr verstummten nach und nach. Als niemand mehr etwas sagte, schaute Karlstadt in die Runde und sprach feierlich: »Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Dies heute ist für mich nicht eines der üblichen Feste zu einer Doktorfeier.« Er machte eine kleine Pause, was die Aufmerksamkeit der Anwesenden erhöhte. Alle sahen jetzt, wie sich der Rektor an Martin wandte. In diesem Moment war lediglich das Knistern und Knacken des Kaminfeuers zu hören.
Karlstadt räusperte sich und fuhr fort: »Martin, wir sind unter deinem Katheder gesessen und haben gebannt zugehört. Du hast spannend erzählt und das Wort Gottes lebendig werden lassen. Erzählungen der Bibel, die wir schon unzählige Male vernommen haben, waren plötzlich lebendig. Deine Lust an der Bibel lässt du uns spüren. Es ist ein neues Schmecken der Heiligen Schrift, deine Theologie hat Kraft und Geist. Wie oft habe ich schon die Geschichte von der Ehebrecherin beim Evangelisten Johannes gelesen. Seit letzter Woche erst meine ich, sie richtig zu verstehen.« Karlstadt kam ins Schwärmen: »Ich, nein, entschuldigt, ich weiß, dass es vielen so geht … Es erscheint uns, dass du ein neues Licht auf die Worte Gottes geworfen hast. Wie verkehrt haben wir manches oft … wie soll ich sagen? … eingeschätzt ist, denke ich, das richtige Wort. Jetzt aber, in neuem Licht gesehen, ist Jesus nicht mehr der Weltenrichter. Nein, er vergibt der Ehebrecherin. Er vergibt ihr, einfach so. Ist das nicht wunderbar, Brüder und Kollegen? Was aber machen wir als Kirche? Wir verlangen …«
Als ob er verbotenes Terrain betreten hätte, hielt er plötzlich inne und schaute nachdenklich auf den Tisch vor sich. Doch jeder wusste, was er meinte. Jeder hatte die Kritik des alten und neuen Doktors am Ablass bereits mit eigenen Ohren vernommen.
Karlstadt atmete tief durch: »Ich wünsche dir, mein guter Martin, dass du weiterhin so treu und mutig das Evangelium predigst. Ich freue mich auf deine Vorlesung morgen.« Spontan klatschten die ersten, doch sogleich bat der Redner um Ruhe, indem er nochmals die Hand hob. In die Tischrunde schauend formulierte er langsam und mit Bedacht: »Dieser Mann hier«, er deutete auf Martin, der die Schultern gehoben und den Kopf eingezogen hatte, »dieser Mann hier wird eine neue Lehre bringen!«
Der Rektor nahm wieder seinen Platz ein. Man hätte nun eine Nadel fallen hören, so still, so angespannt still war es. Nur das Feuer knisterte weiter im Kamin. Alle blickten auf Martin. Als er die nachdenklichen und teilweise verwirrten Gesichter sah, musste er lachen: »Brüder«, fing er an, »lasst uns froh sein, lasst uns die guten Gaben Gottes genießen. Ergo bibamus!« Er hob seinen Becher und prostete in die Runde. Jeder war froh, dass Martin die auf einmal ernste Situation weggeprostet hatte. Einige Minuten später, die Gespräche waren wieder in vollem Gange, ertönten von der Eingangstüre her Klänge einer Laute. Martin hatte sich, als ihm die Gelegenheit günstig erschien, hinausgeschlichen und seine Laute geholt. Nun wurde das Fest noch fröhlicher. Jeder im Saal wusste, welch hervorragender Lautenspieler Martin war. Oft schon hatte er betonte, dass die »Musica« neben der Theologie seine liebste Leidenschaft sei. Er lachte und scherzte mit seinem Spiel. Seinem Kollegen und Rektor, den er seit diesem Abend duzen durfte, zwinkerte er schelmisch zu. Wie lange schon hatte niemand mehr den hart schaffenden Martin so fröhlich und ausgelassen gesehen. Wie anders und vor allem gelöster erging es ihm, seit er Gott als einen liebenden freundlich gesinnten Vater erkannt hatte.
Das gute Bier, das Essen und die ausgelassene Freude erhitzten die Gesichter. Auch Martins Gesichtsfarbe hatte im Laufe des Abends an Farbe zugelegt. Nach dem vierten oder fünften Lied legte Martin die Laute beiseite. Er musste mit keinem Zeichen zu erkennen geben, dass er etwas sagen wollte. Alle Augen waren ohnehin auf ihn gerichtet, kannte er doch etliche der Lieder auswendig und zog die Anwesenden mit seiner Freude in den Bann: »Ich will euch noch etwas sagen, was unseres Schöpfers ist«, hob er zu einer Rede an. »Unser Schöpfer will, dass wir uns am Leben erfreuen. Fromm sein und Freude am Leben sind keine Gegensätze! Wer dies behauptet, kennt die Heilige Schrift nicht. Ich wage zu sagen: Wer Weib, Wein und Gesang nicht schätzt, der hat etwas Gutes vom Leben verpasst!« Er hob seinen Krug: »Es ist zwar kein Wein drin, doch auch ein gutes Bier tut es. Prost! Freuen wir uns an den guten Gaben unseres Herrn!« Von allen Seiten wurde ihm zugeprostet und zugenickt. Fröhlichkeit, Lachen, Scherzen und frommer Glaube predigte und lebte Martin. Sie waren für ihn keine Gegensätze, sondern gehörten zusammen.
Nicht nur an diesem Abend, schon seit geraumer Zeit waren die Hörer seiner Vorlesungen froh, dass endlich einer gekommen war, der den Mut hatte, das Evangelium als frohe Botschaft zu verstehen. Martin wurde nicht müde, seinen Hörern die Liebe und Freude Gottes zu predigen. Aus der Drohbotschaft wurde eine Frohbotschaft. Über Wittenberg hinaus sprach sich herum, dass es da einen Gelehrten gab, dessen Vorlesungen über das Übliche hinausgingen. Seine Gedankengänge waren anders, witziger und trotzdem von ernsten Überlegungen durchdrungen. Diese Vorlesungen wurden zum Geheimtipp. Von weit her kamen sie, die Studenten und Theologen, die diese neue Lehre hören wollten. Doch immer wieder musste Martin betonen, dass es die alte Botschaft war, die er predigte. Denn so stand es schon immer in der Schrift. Nur hatten es die Theologie und die Kirche vergessen, den Menschen zu sagen. Er las ihnen aus dem Evangelium vor, wie Jesus die Kinder auf den Schoß nahm, sie herzte und dann segnete. Er predigte einer gespannt, lauschenden Hörerschaft, wie Gott den Menschen mit Leib und Seele zur Freude am Leben erschaffen hatte. Hatte nicht Jesus die Menschen von ihren Leiden geheilt? »Wozu?«, fragte Martin die Hörer. Dann ließ er seine Stimme anschwellen und rief: »Damit sie sich endlich an ihrem Leben, das ihnen der Herr gegeben hat, erfreuen können!« Und immer wieder betonte er, dass er die Bibel erforsche und alles, was er darin finden würde, weitersagen werde. Einen anderen Auftrag habe er nicht. Mit seiner bescheidenen und doch überzeugenden Art gewann Martin Autorität und Vertrauen. Er spürte den Zuspruch, wusste aber auch: Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Mit der Schar der Bewunderer wuchs auch die Schar der Neider. Die gefährlichsten von allen waren die, die mit ihren Predigten Geld verdienten. Darum wurde der neue Doktor der Theologie auch gewarnt, nicht zu offen und zu vertrauensselig zu predigen. Doch alle, die ihn kannten, diesen begeisterungsfähigen Mönch, Priester, Prediger und Gelehrten, wussten, dass er nicht anders konnte, als in dieser Art die Liebe Gottes den Menschen nahezubringen.
Der Abend verlief freudig und ausgelassen. Die Gesellschaft trank und ließ sich die aufgetischten Speisen schmecken. Lieder wurden gesungen und Martin war für diesen Abend, nachdem er die Worte Karlstadts vergessen hatte, einfach nur glücklich.