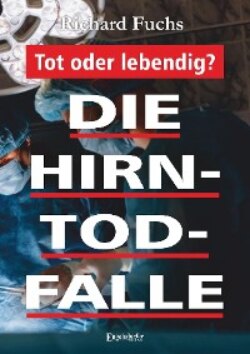Читать книгу Die Hirntod-Falle - Richard Fuchs - Страница 37
ОглавлениеDIE GEBURT DES »HIRNTODES«
»Der Tod als die Gränze der natürlichen Rechtsfähigkeit ist ein so einfaches Naturereignis, daß der selbe nicht, wie die Geburt, eine genauere Feststellung seiner Elemente nöthik macht.«
Friedrich Carl von Savigny (1779 – 1861), in: System des heutigen Römischen Rechts, Bd. 2, 1840, S. 17.
»Der von der Bundesärztekammer geforderte Nachweis von Koma, fehlende Atmung und Ausfall der sogenannten Hirnstammreflexe beweist – auch bei peinlicher Verfolgung aller Ausschlusskriterien – nicht den Ausfall sämtlicher Hirnfunktionen.«
Dr. med. Martin Klein, Arzt für Neurologie, Stellungnahme zur Anhörung des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages am 25. 9. 1996. Ausschussdrucksache 579/13.
Wann immer in einer rechtlichen Grauzone normative Fakten geschaffen werden, sind Ethikkommissionen als Dienstleistende mit Argumentationshilfen nicht weit, wie z. B. bei der Rechtfertigung der Gleichung Hirntod = Tod. Dennoch verbieten de facto und auch per definitionem sowohl der hippokratische Eid als auch die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, die das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert, das Töten von sterbenden Patienten. Das bestätigt auch das Strafgesetz. Jede andere Sichtweise würde auf eine sanktionierte Tötungshandlung hinauslaufen. Diese Feststellung hinderte den Gesetzgeber aber nicht daran, diese Hürden mit terminologischen Tricks zu überspringen: Nach seiner Ansicht sind noch lebende Organspender bereits »Verstorbene«, wie die folgende Argumentation zeigt.
Während des Gesetzgebungsverfahrens 1996 hatte das Bundesministerium des Innern in einem Schreiben51 die Bundesministerien für Gesundheit und für Justiz darauf aufmerksam gemacht, dass die Entnahme von Organen nur bei zweifelsfrei nicht mehr Lebenden gesetzlich zugelassen werden dürfe. Wer aber eine rechtlich logische Konsequenz erwartete, die sich aus dieser Aussage hätte ergeben können, sah sich getäuscht. Dr. Dieter Schnappauf, der Verfasser des Schreibens, empfahl nach allem vorher Gesagten im Hinblick auf die strittige Todesdefinition, man solle die Überschriften des entsprechenden Abschnitts im Gesetzentwurf eindeutiger formulieren als »Spende und Entnahme von Organen bei Verstorbenen«. Wenn die Definition des Todes offengelassen würde und der Lebensschutz des erstrebten Vorteils willen relativiert werde, sei die Wirkung, die davon ausgehe nicht nur »verfassungspolitisch fatal, sondern im Hinblick auf die vorgenannten Anforderungen aus dem Rechtsstaatsprinzip verfassungsrechtlich nicht haltbar«.
Die Empfehlung zeigte Wirkung, nicht nur als Formulierungshilfe für Wortbeiträge in den darauffolgenden Anhörungen, der 1., 2. und 3. Lesung des Transplantationsgesetzes, sondern vor allem bei der Abfassung des Änderungsantrages vom 24. 6. 199752, der frühestens einen Tag vor der Abstimmung im Deutschen Bundestag von den Abgeordneten zur Kenntnis genommen werden konnte. Die Tatsache, dass sich der überwiegende Teil der herbeigeeilten Abgeordneten erst kurz vor der Abstimmung im Foyer des Plenarsaals bei den dort ausgelegten Drucksachen bediente, lässt die Vermutung zu, dass ein Teil von ihnen nicht im Detail darüber informiert war, über welche Antragsinhalte er abzustimmen hatte. Die Details des Änderungsantrages aber machten deutlich, dass die Antragsteller den Empfehlungen von Dr. Schnappauf gefolgt waren.
»Es ist nicht Sache des Staates, zu entscheiden, wann das Leben des Menschen endet«
Zu der Frage, ob der Gesetzgeber generell befugt ist, hier Entscheidungen zu treffen, äußerten sich verschiedene Staatsrechtler kritisch, wie zum Beispiel Professor Hans-Ullrich Gallwas aus München in der Anhörung des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag am 28. Juni 1995: »Es ist nicht Sache des Staates, zu entscheiden, wann das Leben des Menschen endet, ob der Hirntote schon ein Toter oder noch ein Sterbender ist.« Und später heißt es: »Dem Staat ist wegen der Verfassung verwehrt, menschliches Leben zu bewerten und je nach dem Ausgang der Bewertung das Grundrecht des einen dem Grundrecht des anderen zu opfern.53 Der Staat verpflichtet sich vielmehr zum Schutz der Persönlichkeit umso intensiver, je geringer der zeitliche Abstand zum Todeszeitpunkt ist. Denn der Patient vermag sich nicht mehr zu wehren.« In Deutschland wurde während des Gesetzgebungsverfahrens 1995/96 ausführlich debattiert und auch berichtet. In Harvard, USA, war es 1968 ad hoc in Fragen der Todesdefinition zu einer schnellen Lösung gekommen.
Unbeschadet dieser Einwände verabschiedete am 25. Juni 1997 der Deutsche Bundestag mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit ein Transplantationsgesetz54, das die Entnahme und Verpflanzung von Organen regelt, umfassende Bestimmungen zur Organvermittlung enthält und ein Verbot des Organhandels. Mit der Verabschiedung des Gesetzes und der Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten Roman Herzog am 5. November 1997 wurde nun eine medizinische Praxis legitimiert, die weder das deutsche Straf- noch das Verfassungsrecht rechtfertigt. Die normative Kraft des Faktischen hatte gesiegt.
Wenn man nun in Deutschland das Kleingedruckte auf der Rückseite eines Organspendeausweises liest, fällt zumindest kritischen Leserinnen und Lesern auf, dass etwas nicht stimmen kann. Dort ist nicht mehr von einem sogenannten »Hirntod« die Rede, sondern vom wirklichen Tod des Menschen. Das ist ebenso falsch wie irreführend. Denn ein sogenannter irreversibel hirngeschädigter Mensch ist ein wehrloser sterbender Patient und nicht bereits ein Verstorbener.
USA: Der Report des Ad Hoc Commitee
In den USA wurden ethische Barrieren viel früher übersprungen und auch rechtliche Tabus gebrochen. Die normative Kraft des Faktischen – viele Herzen waren bereits transplantiert – forderte eine standesrechtliche Regelung, damit Ärzte straffrei bleiben, wenn sie durch Explantationen komatöse Patienten töten. Den Ausweg aus dem rechtlichen Dilemma fanden acht Monate nach der ersten Herzverpflanzung Dienstleistende aus Philosophie, Theologie und Medizin der Harvard Medical School, USA. Der Report des Ad Hoc Commitee war weltweit meinungsbildend. Der Begriff »ad hoc«, d. h. eigens zu diesem Zweck, bedeutet im englischen Umgangssprachgebrauch auch so viel wie »auf die Schnelle, oberflächlich, ohne zu vertiefen«. In dem Report von 1968 wird empfohlen, sterbende Patienten mit schlagendem Herzen explizit im Interesse der Transplantationsmedizin, für tot zu erklären. Pragmatisch heißt es gleich im ersten Satz:
»Unsere primäre Absicht ist, das irreversible Koma als neues Todeskriterium zu definieren. Es gibt zwei Gründe für die Notwendigkeit einer Definition:
1. Fortschritte der wiederbelebenden und unterstützenden Maßnahmen haben zu verstärkten Bemühungen geführt, diejenigen zu retten, die hoffnungslos verletzt sind. Manchmal haben diese Bemühungen nur einen teilweisen Erfolg, so dass das Ergebnis ein Individuum ist, dessen Herz fortgesetzt schlägt, während das Gehirn irreversibel geschädigt ist. Die Bürde ist groß für die Patienten, die einen permanenten Verlust ihres Intellekts erleiden, ebenso für ihre Familien, für die Krankenhäuser und für diejenigen, die Krankenhausbetten benötigen, die schon von diesen komatösen Patienten belegt sind.
2. Obsolete Kriterien zur Definition des Todes können zu Kontroversen bei der Beschaffung von Organen für Transplantationen führen.«
Seit dieser Zeit dient das »Hirntod«-Konzept als Scheinlegitimation für das Töten sterbender Menschen durch den Akt der Organentnahme. Weder das Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School in den USA noch die Bundesärztekammer in Deutschland konnten ihre Hypothese, der »Hirntod« sei der Tod des Menschen, bis heute wissenschaftlich begründen. Dennoch übernahm auch die Rechtslehre die interessengesteuerte Argumentation der Transplantationsmedizin. Im Jahre 1968 verabschiedeten die USA auch ein einheitliches Gesetz zur Organspende (Uniform Anatomical Gift Act). Die Harvard-Kriterien verlangten zunächst allerdings »totere Tote« im Verhältnis zu den heute gültigen Todeskriterien. Vier Merkmale zur Feststellung des Hirntodes wurden festgelegt: (1) keine Rezeptivität und Reaktivität, (2) keine spontanen Bewegungen und Atmung, (3) keine Reflexe und (4) flaches Elektroenzephalogramm (EG).55 Hirntote sollten also zu keiner einzigen Bewegung mehr fähig sein dürfen. Insofern ist es irreführend, wenn sich die Bundesärztekammer auf den Harvard-Report beruft. Das Ausbleiben aller Reflexe war 1968 zunächstein zentrales Todeskriterium, da das Rückenmark nach dieser Definition morphologisch zum Gehirn gezählt wurde. Weil die strenge Regelung das erwartete Aufkommen potenzieller »Organspender« negativ beeinflusste, verabschiedete man sich von den Kriterien noch im selben Jahr.
Heute gelten insgesamt bis zu 17 mögliche Bewegungen beim Mann und 14 bei der Frau als mit dem Status einer Leiche vereinbar.6 Schweden, Dänemark, Polen, Deutschland und Italien waren die letzten europäischen Länder, deren Bevölkerung, aber auch ein großer Teil der Mediziner, Juristen und Theologen, sich dem Hirntod-Diktat widersetzten.
Wer hat das Urheberrecht an dem Hirntod-Konzept?
In »Der entseelte Patient« (Berlin 2004) schreibt die Kulturwissenschaftlerin Prof. Dr. Anna Bergmann:
»An dem Durchbruch dieser Todesdefinition war maßgeblich der deutsche Neurochirurg Wilhelm Tönnis (1898 – 1978) beteiligt. Seit 1937 leitete er in Berlin die Abteilung für Tumorforschung und experimentelle Pathologie des Kaiser-Wilhelm-Instituts. In seiner Funktion als beratender Neurochirurg beim Chef des Sanitätswesens der Luftwaffe war seine Forschung in die medizinischen Verbrechen im Nationalsozialismus eingebettet. In den sechziger Jahren arbeitete Tönnis in der Bundesrepublik Deutschland als Direktor der Abteilung für Tumorforschung und experimentelle Pathologie des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung an der Wiederbelebbarkeit von hirnverletzten Patienten. Die 1963 von ihm und seinem Mitarbeiter Reinhold A. Frohwein aufgestellten Kriterien für einen Behandlungsabbruch bzw. den »cerebralen Tod« eines an der Lungenmaschine noch beatmeten Komapatienten wurden, wie Gesa Lindemann herausgearbeitet hat, für die Durchsetzung des heute gültigen Hirntodkonzepts bedeutsamer als alle neurophysiologischen Beweisführungen amerikanischer Hirnforscher zusammen. (…) Diese Forschungen ebneten den Weg für den Eintritt in eine neue experimentelle Phase der Transplantationsmedizin, deren Gelingen durch die Verwendung von Organen aus einem lebenden Körper erfolgversprechender erschien als bisherige Verpflanzungsversuche mit Herztodleichen.«56
Die Literatur der Transplantationsmedizin gesteht anderen Medizinern das Erstgeburtsrecht zu. Die französischen Wissenschaftler Pierre Mollaret (1898 – 1987) und Michael Goulon prägten vier Jahre zuvor, 1959, den Begriff »coma depassé (endgültiges Koma). Sie bezeichneten damit den irreversiblen Ausfall der Hirntätigkeit. Erst mit der Einführung der künstlichen Langzeitbeatmung konnte der Zustand coma depassé beobachtet werden. Die Autoren setzten coma depassé allerdings nicht mit dem Tod des Menschen gleich, geschweige denn, dass sie einen Zusammenhang mit der Transplantationsmedizin sahen. Vor der Erfindung der Herz-Lungen-Maschine im Jahr 1952 galt der irreversible Kreislaufstillstand als Kriterium des Todes.