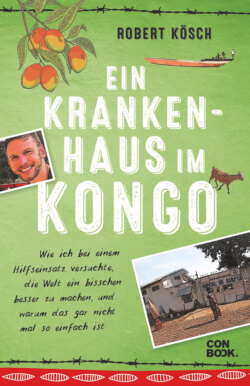Читать книгу Ein Krankenhaus im Kongo - Robert Kösch - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ankunft in Baraka
ОглавлениеDer Toyota Land Cruiser kam schnaubend zum Stehen, fast so, als wäre er froh, dass die Strapazen der letzten vier Stunden nun endlich hinter ihm lagen. Tapfer hatte sich der weiße Geländewagen durch die Serpentinen der strahlend grünen Berge gekämpft und die nur aus Schlaglöchern bestehende blutrote Sandpiste bezwungen. Die ständige Ruckelpartie hatte meinen sonst so zuverlässigen Stahlmagen beängstigend nah an seine Belastungsgrenze gebracht, und jetzt hatte auch er sich eine Auszeit verdient. Kurz nach Sonnenaufgang waren wir im hektischen Bukavu aufgebrochen, hatten die Berge überwunden, und nun blickten wir auf einen riesigen blauen Spiegel, der sich im Horizont verlor. Nicht die kleinste Welle war auf dem Tanganjikasee zu sehen. Es war atemberaubend schön. Wir waren in Uvira angekommen, einer Stadt am nördlichen Ende des Sees, die an Burundi grenzte. Baraka war noch 90 Kilometer entfernt, aber für die Straße RN5 gab es seit Monaten keine Sicherheitsfreigabe. Zu häufig war es dort schon zu bewaffneten Überfällen gekommen. Wir würden daher auf ein Boot von Ärzte ohne Grenzen umsteigen, das uns ohne Risiko nach Baraka bringen würde. Es war ein ordentliches Motorboot mit zwei kräftigen 150-PS-Motoren und ausreichend Platz für zehn Leute. Zahllose Pakete, gefüllt mit Spritzen und Ampullen, sowie mein riesiger, tonnenschwerer roter Koffer wurden vorsichtig verladen, und dann ging die Fahrt auch schon auf dem Wasserweg weiter.
Ich musste mich kneifen, es war einfach unglaublich: Ich war mitten im Kongo und donnerte mit unglaublichem Speed über den spiegelglatten See. Noch glich die Reise eher einem großen Abenteuer, und einzig mein schneeweißes T-Shirt mit dem roten Logo von Ärzte ohne Grenzen erinnerte mich daran, dass ich hier nicht als Tourist unterwegs war, sondern einen Job zu erledigen hatte. In großen Buchstaben stand dort ›MSF‹ geschrieben, die internationale Abkürzung für Médecins Sans Frontières. Das T-Shirt hatte den Zweck, uns als Helfer auszuweisen und die Werte der Hilfsorganisation zu unterstreichen: unabhängig, unparteilich und neutral. Diese Werte sollten uns besser schützen, als eine kugelsichere Weste es könnte.
Als mir die Gischt ins Gesicht spritze, musste ich an den Abschied von Katharina denken. Wir waren an der S-Bahn-Station gestanden, hatten uns fest im Arm gehalten und verzweifelt versucht die Tränen zurückzuhalten, um es dem anderen nicht noch schwerer zu machen. Katharina hasst Abschiede und hatte keine große Szene gewollt. Mit leiser, erstickter Stimme hatte sie mir das Versprechen abgerungen, dass ich auf mich aufpassen und ja gesund und in einem Stück zurückkommen solle. Ich hatte es ihr versprochen, und dann hatten wir beide auf einmal losgeheult. Irgendwann hatten wir die Umarmung gelöst, sie war aufs Rad gestiegen, hatte sich tränenüberströmt umgedreht und war weitergefahren zur Uni. Und ich war in die S-Bahn gestiegen, und die Reise hatte begonnen.
Das Boot wurde langsamer, und der Kapitän zeigte auf die ersten Häuser am Ufer und rief auf Französisch: »Voilà, c’est Baraka. On est là.« Mein Wohnort für die nächsten zwölf Monate. Es hatte Tage gedauert und Züge, Busse, Flugzeuge, allradgetriebene Geländewagen und ein Boot gebraucht, um an diesen Ort zu gelangen, der meiner Welt so unglaublich fern war.
Eine riesige Schar neugieriger Kinder reckte ihre Hälse nach dem Neuankömmling aus. Sie trugen zerrissene T-Shirts und hatten weder Schuhe noch Flipflops an den Füßen. Doch alle lachten, schrien und zeigten ihre strahlend weißen Zähne. Herzlich willkommen in Baraka!
Mit Sack und Pack wurde ich in ein paar Minuten vom Strand bis zu meinem Quartier gebracht. Doch war die Fahrt lang genug, um meine Sinne komplett zu überfluten. Es stank nach verbranntem Plastik, überall herrschte geschäftiges Treiben, aus Boxen dröhnte völlig übersteuerte Musik, Hühner und Ziegen versuchten dem Geländewagen auszuweichen, und das Ganze bei 37 Grad im Schatten. Vor einem türkisfarbenen Metalltor kamen wir zum Stehen. Ein verwaschenes MSF-Logo war an der Mauer zu erkennen, das gleiche wie auf meinem T-Shirt. Da öffnete sich schon das Tor, und zwei Kongolesen begrüßten mich mit »Karibu«.
Vor einem grauen Gebäude unter einer großen Palme standen die beiden internationalen Mitarbeiter Alessandro und Filippo, zwei Italiener in ihren Dreißigern. »Herzlich willkommen in Papaya!« Papaya? Alessandro musste meinen fragenden Blick gesehen haben und fügte schmunzelnd hinzu, dass die Base Papaya genannt wurde. Das klang unkompliziert und locker – irgendwie unerwartet, aber nett. »Ach, und Karibu heißt auf Swahili ›willkommen‹, das ist neben der Amtssprache Französisch die am häufigsten gesprochene Sprache in Süd-Kivu.«
Mit Alessandro hatte ich bereits im Vorfeld telefoniert, er war der Projektleiter für das neue Krankenhaus und somit mein Chef. Filippo würde nächste Woche den Heimweg antreten, und ich würde seinen Posten als Verantwortlicher für Finanzen, Personal und die Logistik der Base übernehmen.
Filippo führte mich am Haus vorbei in einen kleinen Hof, in dem ein Zitronenbaum stand. Dort war ein Anbau mit drei Zimmern, davor jeweils eine kleine Terrasse. Es wirkte wie ein Apartmenthotel in Lloret de Mar. Mein Zimmer war circa zehn Quadratmeter groß und ausgestattet mit einem wuchtigen Bett mit Moskitonetz, einem wackligen Schreibtisch und einem Schrank, dessen Holztüren so verzogen waren, dass man sie nicht schließen konnte. Stolz präsentierte mir Filippo das direkt angeschlossene Bad: Die Fliesen hingen schief an der Wand, der Toilettensitz war verbeult, der Spiegel hatte einen Riss, und die Duscharmatur wirkte nicht gerade robust. »In den meisten MSF-Projekten teilt man sich Dusche und Toilette mit anderen. Hier in Papaya leben wir im Luxus! Jeder hat sein eigenes Bad.«
Das also war mein Reich für die nächsten zwölf Monate.
»Komm erst mal an, dann zeige ich dir die Base.«
Papaya selbst war etwas mehr als 800 Quadratmeter groß und von hohen Mauern umgeben, die zusätzlich mit NATO-Draht gesichert waren. Man hätte fast meinen können, man wäre im Knast! Der kleine Ausguck am Tor, von dem man gut über die Straße schauen konnte, verstärkte diesen Eindruck zusätzlich. Die freundlichen Mitarbeiter jedoch machten sehr schnell klar, dass man hier eher in einer Oase als in einem Gefängnis war. Im Haupthaus gab es vier Schlafzimmer, ein riesiges Wohn- und Esszimmer, eine kleine Küche mit angeschlossener Speisekammer sowie einen Raum für Waschmaschine, Bügelbrett und Kühlschrank. Wie auch mein Badezimmer war alles Stückwerk, aber es machte einen freundlichen, unkomplizierten Eindruck. In einem kleinen Schränkchen war die Medikamentenbox mit Malariaprophylaxe, Verbandsmaterialien, Fieberthermometer und – zu meiner Überraschung – Kondomen. Die würde ich wohl eher nicht benötigen …
Die Büroräume waren im vorderen Teil: ein größerer Raum für Logistik, Personal und Finanzen und im ersten Stock ein Meetingraum sowie ein kleineres Büro für Alessandro und seine Assistentin. Mein Weg zur Arbeit dauerte also keine halbe Minute!
Dann präsentierte mir Filippo am Eingangstor die kongolesische Version von The Beast. Es war Liebe auf den ersten Blick, als er mir Rhino vorstelle. Wie der Name vermuten lässt, sah der Geländewagen ebenso massiv und kräftig aus. Es handelte sich um einen Toyota Land Cruiser in der Pick-up-Version, also mit großer Ladefläche. Die Reifen wirkten riesig und machten den Eindruck, dass sie den Kampf mit den kongolesischen Straßen nur zu gerne aufnehmen wollten. Es gab nur einen Haken an dem allradgetriebenen Ungetüm: Ich durfte es nicht fahren! Dafür hatten wir aber vier Fahrer, die so eingeteilt waren, dass das Fahrzeug rund um die Uhr und auch am Wochenende abfahrbereit war. Sie waren bestens darin ausgebildet, die Fahrzeuge durch tiefen Matsch zu steuern und im Zweifel auszugraben. Autofahren in Baraka war mit Autofahren in Hamburg nicht im Ansatz zu vergleichen.
Dann kümmerten wir uns um das Wichtigste für junge Menschen im 21. Jahrhundert: das WLAN-Passwort. Die Frage, welches WLAN ich auswählen musste, erübrigte sich, da es nur ein einziges gab. Und auf einmal war ich mit meiner bekannten Welt verbunden und konnte Katharina bequem per WhatsApp schreiben. Für uns war eine passable Internetverbindung Grundvoraussetzung für die Zeit im Kongo gewesen. Hätte ich nicht vernünftig per WhatsApp oder Skype telefonieren können, wäre ich zu Hause geblieben.
Um mich nicht noch mehr mit Informationen und Eindrücken zu überfrachten, stand heute glücklicherweise nur noch das Sicherheitsbriefing für internationale Mitarbeiter – auch Expats genannt – auf dem Plan. Mit der eigentlichen Übergabe würden wir erst morgen anfangen. Alessandro legte einen dicken Ordner vor mich auf den Tisch, den Local Security Plan (LSP). Das war also das ›tragfähige Sicherheitskonzept‹, von dem das Auswärtige Amt gesprochen hatte. Daneben legte er einen unhandlichen schwarzen Klotz, aus dem eine Antenne herausragte. »Ab sofort musst du das Funkgerät immer eingeschaltet bei dir haben. Auch nachts.«
»Warum brauchen wir überhaupt diese Funkgeräte? Warum nutzen wir nicht einfach nur die Handys?«
»Mit den Funkgeräten sind wir unabhängig und nicht auf das das Mobilfunknetz angewiesen. Bei Störungen oder absichtlichem Abschalten seitens der Regierung haben wir immer noch ein funktionsfähiges Kommunikationsnetz. Und vor allem ist es schnell – du wirst es hassen und lieben!«
Ich hatte keine Ahnung, was Alessandro mit dem letzten Satz meinte.
Von morgens 6 Uhr bis abends 18 Uhr durften sich die Expats weitestgehend frei in der sogenannten green zone bewegen, also auch zu Fuß und allein. Ab 18 Uhr nur noch mit den Fahrzeugen, und um 22:30 Uhr musste jeder in der Base sein. Ohne Wenn und Aber. Jede Bewegung musste vorher dem Radio Room in Mango mitgeteilt werden, sodass man lückenlos nachverfolgen konnte, wo man sich befand. Mango?
»Ach, Mango, das ist der Name der anderen MSF-Base in Baraka. Die zeigen wir dir morgen.«
Fahrten außerhalb der Stadt mussten mindestens einen Tag vorher angemeldet werden, und vor Abfahrt musste eine Sicherheitsfreigabe eingeholt werden. Der Projektleiter in Mango und sein Assistent bewerteten jeden Tag das aktuelle Geschehen und passten entsprechend die Maßnahmen an. Der Rest stehe im Local Security Plan: Protokolle, wie man sich bei einer potenziellen Evakuierung oder bei einem bewaffneten Überfall zu verhalten haben und wie man Sicherheitsvorfälle meldet. Sicherheit und Risikominimierung wurden hier offensichtlich großgeschrieben! So viele Dinge, die man beachten musste und nicht falsch machen durfte. Hoffentlich würde ich mir den Sicherheitsplan in Zukunft nicht mehr so genau anschauen müssen.
Punkt 18 Uhr war es schlagartig dunkel geworden. Wir waren nur 450 Kilometer Luftlinie vom Äquator entfernt, und anstatt gemächlich unterzugehen, fiel die Sonne einfach nur wie ein Stein hinter den Horizont. Aber es war immer noch heiß, bestimmt über 30 Grad, und zu dritt machten wir es uns auf der Terrasse gemütlich und tranken ein kühles Bier.
Was man denn hier für Sport treiben könne, fragte ich die beiden. Sport ist so etwas wie mein Lebenselixier. Beim Sport kann ich alles vergessen, bin ich maximal fokussiert und lebe ich ganz im Moment. Umso wichtiger war es für mich, dass ich mich in der Ferne regelmäßig bewegen konnte. Es war offensichtlich, dass es hier keinen Rennradverein oder Tennisclub gab. Aber irgendwas musste man ja machen können.
»Also Kongwa, ein Wärter aus Mango, geht gerne joggen. Der nimmt immer internationale Mitarbeiter mit. Aber er soll verdammt schnell sein«, warnte mich Filippo.
Schnell griff ich zum Telefon, wählte seine Nummer – morgen früh um 6 Uhr würde er mich abholen.
Mein Kopf rauchte von den ganzen Eindrücken des Tages, also zog ich mich in mein kleines Zimmer zurück, das sich noch ganz fremd anfühlte. Als ich den Kalender der Hamburger Stammtisch-Jungs aus dem Koffer kramte, fiel mir ein kleines, in Geschenkpapier eingewickeltes Paket auf, das ich auf keinen Fall selbst eingepackt hatte. Ach, Katharina, sie war immer für diese kleinen süßen Überraschungen gut. Gespannt riss ich das bunte Papier auf, und ein kleines schwarzes Notizbuch kam hervor. Der Einband war elegant und makellos, die Seiten glatt und ordentlich. Ich löste vorsichtig den Gummibandverschluss und schlug die erste Seite auf. Ich erkannte die gleichmäßige Schrift meiner Frau:
›Lieber Robert, ich wünsche dir viel Spaß beim Schreiben dieser noch fast leeren Seiten und bin sehr gespannt, wie das Buch in einem Jahr aussieht. Es soll dir für alte und neue Erinnerungen dienen. Deine Katharina‹
Ich blätterte durch das Heft. Jedes Seitenpaar entsprach einer Kalenderwoche, mit viel Platz für Notizen und Gedanken. Ganz leer war das Büchlein aber nicht. Auf einigen Seiten waren bereits kleine Fotos eingeklebt. Bilder von guten Freunden, verrückten Urlaubstagen und himmlischen Momenten. Sie war wirklich zu gut für mich.
Ich nahm meinen Stift und schrieb die ersten Worte in das noch jungfräuliche Heft: ›Das Abenteuer beginnt!‹
Wie das Buch wohl in einem Jahr aussehen würde?