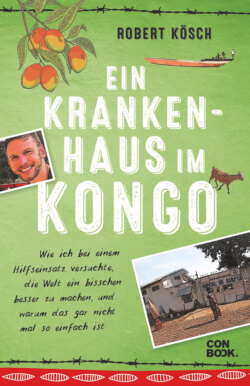Читать книгу Ein Krankenhaus im Kongo - Robert Kösch - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Flugtag
ОглавлениеHatte ich auch wirklich nichts vergessen? Wieder und wieder ging ich die Checkliste durch. Der knapp 40 Kilogramm schwere rollbare Feuerlöscher war auf Rhinos Ladefläche verstaut, der rot-weiße Windsack lag auf der Rückbank, und das Satellitentelefon war sicher in meinem Rucksack verpackt. Nachdem Filippo wie geplant vor ein paar Tagen den Heimweg angetreten war, war ich nun allein verantwortlich für die Buschpiste in Malinde und die gesamte Logistik rund um den heutigen Versorgungsflug. Ich hatte nicht schlecht gestaunt, als man mich gefragt hatte, ob ich mir diesen Job zutrauen würde. Einen kleinen Flugplatz im Busch zu managen war zwar überhaupt nicht in meiner job description gestanden, aber ich liebte Flugzeuge, und es klang spannend und aufregend. Heute wäre ich also Reiseleitung, Gepäckabfertiger, Fluglotse und technischer Notdienst in einer Person. Fühlte ich mich dazu gut vorbereitet? Nein. War ich aufgeregt? Ja!
Franck, unser Chauffeur, startete den Wagen, und Akas und ich schnallten uns an. Wie im Protokoll vorgesehen, meldete ich dem Radio Room per Funk unsere 35-minütige Fahrt nach Malinde. In spätestens 60 Minuten müsste ich an der Piste sein, um den Wetterbericht durchzugeben und zu überprüfen, ob auf der nicht asphaltierten Piste gelandet werden konnte. Wenn Regenfälle einen Teil der Piste weggeschwemmt hätten, müssten wir noch Ausbesserungen vornehmen. Filippo hatte mir während der Übergabe einige schockierende Bilder von tiefen Furchen in der Landebahn gezeigt. Wir waren noch mitten in der Regenzeit, hoffentlich hatten wir heute Glück mit dem Wetter. Am Vortag hatten wir bereits 20 Tagelöhner kontaktiert, die uns in so einem Fall helfen würden. Wir hatten also keine Zeit zu verlieren.
Gesprächig war ich während der ruckeligen Fahrt nicht. Ein Zeichen dafür, dass ich wirklich aufgeregt war. Genauso wenig nahm ich die atemberaubende hügelige Landschaft wahr: ein unendliches Meer aus unterschiedlichsten Grüntönen, die rostbraune Straße und den tiefblauen Himmel. Stattdessen ging ich im Kopf gebetsmühlenartig den geplanten Ablauf durch und schaute ständig auf die Uhr, um zu sehen, ob wir ja nicht zu spät waren.
Auf einmal wurde das Auto langsamer und kam schließlich hinter einer Schlange von Lkws zum Stehen. Stau im Kongo? Das konnte eigentlich nicht sein, denn dafür gab es schlicht zu wenige Fahrzeuge. Es musste also etwas passiert sein! Ein Unfall, eine Demonstration oder ein Überfall? Per Funk gab ich diese Unregelmäßigkeit direkt weiter und bat um Erlaubnis, unser Fahrzeug verlassen und mehr Informationen einholen zu können. Denn ohne Absprache einen spontanen Spaziergang einzulegen war aufgrund der angespannten Sicherheitslage nicht erlaubt.
Überall wimmelte es von Menschen. Manche witterten bereits eine Geschäftsmöglichkeit und verkauften Zuckerrohr und andere Leckereien an die wartenden Lkw-Fahrer. Ein Trupp der FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo, also des kongolesischen Militärs) war ebenfalls da und schien zu patrouillieren. Warum sie dafür nicht nur das standardmäßige AK-47-Maschinengewehr, sondern ein anderthalb Meter langes panzerbrechendes Geschütz brauchten, war mir ein Rätsel. Was war hier nur los?
Zu Fuß gingen Akas und ich die staubige Straße entlang, während mir zahllose Augenpaare folgten. Als einziger Weißer war ich hier mal wieder die Attraktion. Dann sahen wir die Stauursache: Ein heillos überladener Lkw steckte im wahrsten Sinne des Wortes in einer uralten, einspurigen Brücke fest! Der Fahrbahnbelag bestand aus tischgroßen Stahlplatten, von denen einige fehlten. Alle kannten die fehlenden Platten und umfuhren in der Regel geschickt die klaffenden Löcher. Doch dieser Lkw-Fahrer kam wohl nicht aus der Region. Ein Passieren der Brücke war für die nächsten Stunden komplett ausgeschlossen. Panik machte sich in mir breit! In 30 Minuten müsste ich eigentlich an der Piste sein, und eine andere Route gab es nicht. Was tun?
Das erste Mal in Eigenverantwortung den Flugplatz managen – das hätte ja wirklich besser laufen können. Ich telefonierte und funkte hektisch mit dem Flugkoordinator und Walter, dem logistischen Leiter in Bukavu, um zu klären, wie wir die Situation lösen könnten. Denn wenn ich nicht rechtzeitig am Flugplatz wäre, könnte der Flieger nicht landen. Ganz zu schweigen davon, dass es auch wenig Sinn ergäbe, denn wohin sollten dann ankommende Passagiere und Cargo transportiert werden?
Meine beiden kongolesischen Kollegen dagegen waren ruhig und entspannt. Sie hatten bereits Zuckerrohr gekauft, lehnten an der Autotür und aßen genüsslich die süße Mahlzeit. Die Minuten vergingen, und keine Lösung war in Sicht. Akas kommentierte die Situation und mein Verhalten freundlich mit zwei einfachen Wörtern, die sich wie ein roter Faden durch meine Mission ziehen sollten: »Pole pole!« Eine Redewendung auf Swahili für ›Keine Eile, das wird schon‹. Er und Franck hatten diese Einstellung bereits perfektioniert, ich dagegen war meilenweit davon entfernt.
Die Straße glich mittlerweile einem spontanen Basar. Überall waren Menschen, es roch nach gekochtem Essen, alle riefen irgendwas durcheinander, und Motorräder schlängelten sich laut hupend zwischen den rostigen Lkws hindurch. Da tauchte ein weißer, gepanzerter Hummer H1 der UN auf. Die Blauhelme der MONUSCO (Mission der Vereinten Nationen für die Stabilisierung in der Demokratischen Republik Kongo) steuerten zielsicher auf mich zu. Ich kam mir vor wie im Film, gepanzerte Militärfahrzeuge hatten wenig mit meiner bisherigen Lebensrealität zu tun. Der pakistanische Kommandant erkundigte sich, was hier eigentlich los sei und ob bei uns alles in Ordnung wäre. Es schien, als wäre meine weiße Hautfarbe ein Indikator dafür, dass ich wohl Ahnung hätte. Ich war froh, als die Blauhelme nach ein paar gewechselten Sätzen wieder abzogen. Nicht alle Teile der Bevölkerung waren glücklich über die Präsenz der UN, zumal sie mit den FARDC kooperierten. Und um die Unabhängigkeit von MSF zu unterstreichen, wollten wir nicht den Anschein erwecken, dass wir mit den Vereinten Nationen unter einer Decke steckten.
Dann schallte mein Name durch das Funkgerät. Nach einem kurzen Gespräch mit Walter hatten wir eine Lösung gefunden: Ein weiteres MSF-Fahrzeug aus Kimbi, dem Nachbarprojekt, befand sich auf der anderen Seite der Brücke. Akas und ich müssten uns also nur einen Weg zu Fuß über die mittlerweile völlig verstopfte Brücke bahnen und anschließend in das andere Fahrzeug steigen. Franck dagegen würde bei unserem Wagen bleiben und Rückmeldung geben, wenn der Weg wieder frei wäre. Und man hatte den Flug um zwei Stunden nach hinten verschoben, um die Situation zu entspannen.
Den schweren Feuerlöscher und den Windsack im Schlepptau, schoben wir uns quälend langsam durch die Menschenmassen. Dann quetschten wir uns zwischen Lkw und Brückenpfeiler hindurch, wobei der sperrige Feuerlöscher um ein Haar in die braunen Wassermassen des Mutambala-Flusses gefallen wäre. Erleichtert und schweißgebadet stieg ich in das Fahrzeug auf der anderen Seite der Brücke. Drei Minuten später waren wir schon in Malinde, einem winzigen Dorf, das ausschließlich aus kleinen roten Lehmhütten bestand. Dagegen wirkte Baraka wie eine schillernde Metropole. Kurz bevor wir links zur Piste abbogen, sah ich aus dem Augenwinkel eine weiß verputzte Hütte, die merkwürdig fehl am Platz wirkte. Ich musste zweimal hinschauen, da ich nicht glauben konnte, was ich dort erblickte: Über der Eingangstür stand in großen blauen Buchstaben ›Salon Barça‹ und daneben prangte das Wappen des FC Barcelona, das man bis ins kleinste Detail an die Wand gepinselt hatte. Also hatte es die Globalisierung doch bis Malinde geschafft.
An der Piste angekommen, wurden wir von ein paar blökenden Ziegen begrüßt, die mitten auf der Landebahn standen. Eine von ihnen verrichtete ungeniert ihr Geschäft. Überall sah man Leute, die Körbe und sogar Harken auf dem Kopf balancierten und sich auf den Weg zu den direkt angrenzenden Feldern machten. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass hier zwischen den Plantagen gleich ernsthaft ein Flugzeug landen sollte. Glücklicherweise hatte es in den letzten Tagen nicht geregnet, sodass die Piste in einem annehmbaren Zustand war. Die Sonne stand hoch am Himmel, und die Sicht war ausgezeichnet. Ich telefonierte mit dem Flugkoordinator, der Flieger konnte kommen. Gemeinsam mit Akas stellten wir den Windsack auf und positionierten die 20 Tagelöhner in knallgelben Warnwesten entlang der Piste, um Tiere und auch Kinder vom landenden Flugzeug fernzuhalten.
Parallel dazu hatte sich auch die Situation auf der Brücke entspannt. Es war mir ein Rätsel, wie die Menge es geschafft haben soll, den tonnenschweren Lkw mit vermutlich gebrochener Achse ohne Kran aus dem Loch der Brücke zu wuchten. Aber sie hatten es irgendwie hinbekommen, sodass der Verkehr wieder rollte und der Rückweg von Malinde nach Baraka frei war.
Dann knarzte es auch schon aus dem Funkgerät, der Pilot war im Anflug und fragte nach der Landefreigabe. Ich meldete mich mit »Malinde Ground Control«, nannte Windrichtung und -stärke und gab die Landebahn frei. Aus dem Augenwinkel sah ich nun eine Rinderherde parallel zur Piste laufen. Zwei Viehhirten kontrollierten mit langen Holzstöcken, dass keines der Tiere aus der Reihe tanzte. Mein Adrenalinspiegel stieg. Warum konnte diese Herde nicht einfach 30 Minuten später vorbeikommen? Eine Kuh auf der Piste, Minuten vor der Landung, wäre der absolute Super-GAU. Nicht auszudenken, was passierte, wenn das Flugzeug mit einer Kuh kollidierte!
Der Flieger war nun gut zu sehen, und das dröhnende Motorengeräusch breitete sich über der sonst so ruhigen Landschaft aus. Da passierte es. Wie in Zeitlupe verließ ein Jungtier die übrige Herde, schüttelte sich und rannte zielstrebig in Richtung Piste. Die Tagelöhner drehten die Köpfe, sahen die potenzielle Gefahr, fingen an zu schreien und warfen mit Steinen nach dem Tier. Mein Herz fing wie wild an zu schlagen. Sofort griff ich zum Funkgerät und rief hektisch, dass sich Tiere auf der Piste befänden und auf keinen Fall gelandet werden könne. Mit überraschender Lockerheit antwortete der Pilot: »Okay, sieh zu, dass die Tiere verschwinden, und dann kommen wir runter.« Zwei Minuten später war der Spuk vorbei, und die Maschine kam mit einer riesigen Staubwolke sicher auf der Piste zum Stehen. Die Let L-410 mit ihren zwei Turboprop-Triebwerken wirkte wie von einem anderen Stern. Ein schnaufendes Ungetüm, das aus dem Himmel kam.
Abgelenkt von der Kuh-Aktion hatte ich gar nicht mitbekommen, dass sich nun eine Horde von circa 100 Kindern in der Nähe der Piste tummelte. In sicherer Entfernung sprangen sie aufgeregt umher und verdrehten sich die Hälse nach dem Flieger. Viele haben vermutlich noch nie in einem Auto gesessen, was für ein Abenteuer musste da ein Flugzeug sein?
Per Handschlag begrüßte ich den grinsenden Piloten, einen circa 60-jährigen Südafrikaner, der vom Rauchen stark verfärbte Zähne hatte. Seine weiße Uniform mit den vier Streifen auf den Schulterklappen wollte nicht so recht in die Umgebung passen. Ich entschuldigte mich für das Hin und Her mit den Kühen, aber er zuckte nur mit den Schultern: »Wir sind hier im Kongo, das ist doch ganz normal.«
Dann wurden die ankommenden Kollegen begrüßt, die Kartons mit medizinischen Instrumenten und Ersatzteilen für die Generatoren aus dem Flieger entladen, auf unsere Geländewagen verteilt und die Frachtpapiere unterzeichnet. 15 Minuten später wurden die Triebwerke gestartet, der Flieger beschleunigte unter ohrenbetäubendem Lärm und hob schließlich sanft in den wolkenlosen Himmel ab. Wir hatten es geschafft. Doch bevor es zurück nach Baraka gehen konnte, musste ich mich erst noch aus dem Pulk von Kindern befreien, der mich mittlerweile belagert hatte. Sie lachten und grinsten, wollten meine albern aussehende weiße Haut anfassen und fragten nach Keksen und anderen Süßigkeiten.
Auf dem Heimweg bewunderte ich den fantastischen Blick auf den azurblauen Tanganjikasee, die riesigen, schattenspendenden Mangobäume und lachte mit Akas und Franck über diesen wilden Tag. Am Ende hatte alles geklappt, nur komplett anders als geplant. Pole pole!