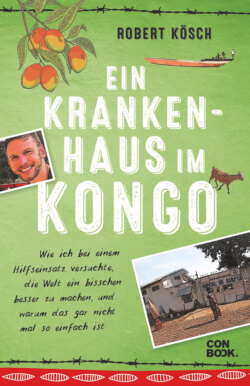Читать книгу Ein Krankenhaus im Kongo - Robert Kösch - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein (fast) perfekter Sonntag
ОглавлениеAuf dem Vorbereitungskurs in Bonn hatte man mir in schillernden Farben vorgeschwärmt: Sonntage in Baraka seien paradiesisch! In den letzten Wochen hatte man mich stets vertröstet: Das Wetter spiele nicht mit, es sei einfach zu windig. Heute dagegen stand die Äquatorsonne senkrecht am Himmel, knallte auf uns herab, und nicht das kleinste schattenspendende Wölkchen war zu sehen. Und viel wichtiger: Nicht der leistete Windhauch war zu spüren, stattdessen schwitzen wir wie unter einer riesigen Käseglocke. Heute gab es keine Ausreden! Wir würden zum Baden auf den See hinausfahren! Endlich würde sich zeigen, ob an dem Gerücht tatsächlich etwas dran war. Voller Vorfreude stopfte ich Handtuch, Badehose, Sonnencreme und Wasserflasche in meinen Rucksack. Es war mir unbegreiflich, warum Alessandro lieber zu Hause in Papaya bleiben wollte.
Gut gelaunt stand ich mit Kappe und Sonnenbrille am Tor und wollte los. Der See ruft! Doch Silvie meinte nur, dass ich so nicht rauskönne. Hä? Ich hatte das Funkgerät doch dabei, was hatte ich jetzt schon wieder vergessen? Silvie zeigte auf meine kurze Hose. Als Mann trage man im Kongo lange Hosen, die mindestens über das Knie gehen. Nur beim Sport könne man eine Ausnahme machen. Also wieder zurück ins Zimmer und bei 37 Grad in die lange Hose.
Am Strand angekommen, wurden wir wie üblich von den Kindermassen umzingelt. Was die Mzungus wohl wieder vorhatten? Strand war allerdings kaum das richtige Wort. Überall waren vom Sonnenlicht verblichene Plastikteile zu sehen, zerrissene Taue lagen wie tote Schlangen umher, und einige Männer wuschen ihre Mopeds. Die Kids turnten um uns herum, planschten im Wasser und hatten einen Heidenspaß.
Von dem Wasser in Ufernähe sollten wir uns besser fernhalten, hatte uns Clare, unsere Ärztin, beim medizinischen Briefing vor ein paar Wochen ermahnt. Denn mit Bilharziose war nicht zu spaßen. Der winzige Parasit kann sich in den Fuß bohren und von dort genüsslich durch den menschlichen Körper graben, Leber und Venen befallen und Eier ablegen. Juckreiz, Fieber, Durchfall waren da noch die angenehmeren Folgen. Von den jährlich 250 Millionen Infizierten sterben 200.000 Menschen, und es gibt keinen Impfstoff.
Dann kam das MSF-Boot und fuhr nah an den Strand heran. ›Amani‹ war in dicken Buchstaben an die Bordwand geschrieben. Na klar, wenn Autos und selbst Generatoren einen Namen hatten, durfte ein Boot natürlich nicht namenlos bleiben. Es war das gleiche Boot, mit dem ich im Januar von Uvira nach Baraka gedüst war. Nun standen wir vor einer schwierigen Aufgabe. Wie sollten wir ohne Kontakt mit dem teuflischen Wasser auf Amani gelangen? Es gab keinen Steg oder gar eine Kaimauer. Ein größerer Stein würde uns als Brücke dienen müssen. Es sah irgendwie bescheuert aus, wie wir vorsichtig balancierend vom Strand auf den Stein sprangen, um dann mit einem beherzten Schritt ins Boot zu gelangen. Und um uns herum tobten die Kids ausgelassen durchs Wasser. Clare versuchte vergebens, mit den Frauen zu sprechen, die dabei waren, das Seewasser in die gelben Kanister zu füllen.
Dann gab Guillaume, unser Kapitän, Gas, und das Schnellboot hievte sich aus der trüben Brühe, nahm Fahrt auf und kam ins Gleiten. Der Fahrtwind blies uns allen kräftig um die Nase, und die Beschleunigung drückte uns sanft in die Sitze. Ich schaute zu Rosy und Noor, die auch mit dabei waren. Sie bekamen das Grinsen einfach nicht aus dem Gesicht. Mit jedem Meter weg von der dreckigen Küste wurden sowohl Baraka als auch die Arbeit und die Probleme kleiner, bis sie nur noch eine kleine Randnotiz waren, die aus der Ferne nicht zu entziffern und nicht mehr greifbar war. Nach zehn Minuten rasanter Fahrt stellte Guillaume den Motor ab, und es war sofort atemberaubend still. Die Farbe des Wassers war azurblau, der Unterschied zum Himmel kaum auszumachen. Die Oberfläche glich einem Spiegel, es gab überhaupt keine Wellen. Stille Wasser gründen tief, sehr tief in diesem Fall. Unser kleines Boot schwamm mitten auf dem tiefsten See Afrikas und dem zweittiefsten See der Welt. 1.470 Meter waren es bis zum Grund. Irre! Die Presqu’île, eine Halbinsel, war nur noch wenige Kilometer entfernt und lockte mit ihren paradiesischen Sandstränden.
Wie kleine Kinder konnten wir es nicht erwarten, in das Wasser zu springen. Der fiese Parasit sollte hier draußen eigentlich kein Problem sein, oder doch? Das blaue Nass war zu verführerisch! Beherzt sprang ich von Bord und hinein ins Glück. Die Sonnenstrahlen tanzten unter Wasser wild durcheinander, und aller Staub war weggewaschen. Wir planschten, lachten und schwammen in der riesigen Badewanne um die Wette. Hier draußen waren wir frei! Nach der ersten Baderunde wurden Bücher hervorgekramt, Proviant geplündert und das ein oder andere Bier getrunken. Aus der Bluetooth-Box klang die entspannte Stimme von Jack Johnson. Urlaub pur!
Aber was bedeutet eigentlich der Name Amani? Guillaume klärte uns auf. Es war das swahilische Wort für Friede. Das passte wie die Faust aufs Auge. In Papaya war ich umgeben von dicken Mauern und Stacheldraht. Und draußen folgten mir zu jedem Zeitpunkt unzählige Augenpaare, und Kinderarme zerrten an mir. Ruhe war nirgends zu finden. Aber hier draußen auf dem See, da war Friede pur. Man konnte die Seele baumeln lassen. Die Gerüchte waren also wirklich wahr. Die Sonntage in Baraka waren paradiesisch.
Und dennoch blieb ein fader Beigeschmack. Denn während ich auf das ferne Baraka blickte, wurde mir einmal mehr klar, dass wir hier in einer Blase lebten. Man musste sich nichts vormachen, wir waren privilegiert. Extrem privilegiert. Wir konnten uns auch den Luxus leisten und nur so zum Spaß auf den See fahren. Hatten wir ein schlechtes Gewissen? Wäre es besser, nicht auf den See zu fahren? Die Kontraste waren allgegenwärtig. Und damit mussten wir uns abfinden und zurechtkommen. Man ist nur in der Lage zu helfen, wenn man selbst physisch und mental fit ist.
Nach diesem Urlaubsnachmittag ging es weiter nach Mango. Es war ein festes Ritual, dass sich alle internationalen Mitarbeiter Sonntagabend gemeinsam zum Kochen trafen. Heute würde es Fisch geben. Und was für einen Brummer Gianina besorgt hatte! Das Monster war knapp einen halben Meter lang und stammte natürlich aus dem See, in dem wir vorhin noch geplanscht hatten. Aus der Musikbox erklang Gute-Laune-Musik, Mamadou legte eine kleine Tanzeinlage ein, und Noor, Rosy und ich schnitten Zwiebeln, Auberginen und Zucchini. Ohne dass einer einen festen Plan vorgab, packten alle mit an und suchten selbst nach Aufgaben. So wurde draußen unter dem großen Sonnensegel der lange Tisch gedeckt und eine Lichterkette gespannt. Es wirkte alles so festlich, dabei war es nur ein normaler Sonntag. Vielleicht lag genau darin das Geheimnis, dass man sich selbst den Alltag versüßt.
Dann saßen wir gemeinsam mit den 14 Expats um die gedeckte Tafel, und Gianina trug den dampfenden und köstlich duftenden Fisch heraus. Ich kam mir vor wie im Film: Ich saß in Flipflops im Kongo in einer MSF-Base und stieß mit Kollegen an, die irgendwie eher Freunde waren. Dann machte auf einmal mein Funkgerät einen langen, durchdringenden Piepton. Wie aus einem Munde riefen Noor und Rosy »Drink!« und fingen an zu lachen! Ich verstand mal wieder gar nichts. Was hatte ich jetzt verpasst?
Noor klärte mich auf. In ihrer vorherigen Mission hatten sie ein Trinkspiel gespielt, bei dem man immer trinken musste, wenn das Funkgerät piept, weil die Batterie leer wurde. Genau mein Humor. Wir würden noch viel Spaß haben. Und während über vergangene Missionen gesprochen wurde, sagte Rosy: »Es sind die Begegnungen mit den Menschen, die deine Mission ausmachen werden.«
Dann zerfetzte auf einmal ein ratterndes Geräusch das Lachen und Geschichtenerzählen. Wir schauten uns besorgt an. Was war das? Diejenigen, die vorher auf Missionen im Jemen, in Afghanistan und Irak waren, kannten die Geräusche nur zu gut. Eine Maschinengewehrsalve. Der Lautstärke nach zu urteilen, waren die Schüsse nur wenige Hundert Meter entfernt. Als Vorsichtsmaßnahme gingen wir sofort in das Haus. Mein Herz schlug schnell, wohingegen der Rest sehr entspannt wirkte und sich nicht allzu große Sorgen zu machen schien. Der Sicherheitsverantwortliche sprach mit unseren Wärtern, die immer jemanden kannten, der wiederum jemanden kannte, der Bescheid wusste. Die modernen Buschtrommeln waren schnell, nach ein paar Minuten hatten wir Klarheit: Kriminelle hatten einen M-Pesa-Mitarbeiter unter seinem roten Sonnenschirm mit den Schüssen einschüchtern wollen, um so Geld zu erpressen.
Als sich alles beruhigt hatte und ich später am Abend sicher in Papaya ankam, sprach ich mit den Wärtern über die Situation. Dobis meinte nur: »C’est le Congo. C’est compliqué. Solche Dinge passieren hier. Das ist traurig, aber eine Realität.« Ob ich mich an solch eine Realität gewöhnen könnte? Vielleicht war es doch nur ein Gerücht, dass die Sonntage in Baraka paradiesisch waren.