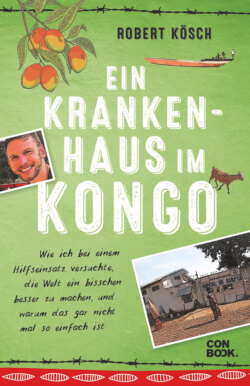Читать книгу Ein Krankenhaus im Kongo - Robert Kösch - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein leerer Werkzeugkasten
ОглавлениеEndlich war Wochenende, und ich hatte etwas Zeit, die auf mich einprasselnden Eindrücke sacken zu lassen. Ich lag in Mango in der Skybar auf weichen Kissen und blickte über die staubigen Dächer der Stadt. Die erste Woche in Baraka hatte mein gesamtes Leben komplett auf den Kopf gestellt und jede noch so große bisherige Veränderung wie eine Kleinigkeit aussehen lassen. Der große Unterschied bestand darin, dass einfach ALLES anders war. Nichts war hier wie zu Hause. Nichts war vertraut. Selbst der Gang aufs Klo folgte anderen Regeln. Das benutzte Papier kam nicht etwa in die Schüssel, sondern in einen kleinen Mülleimer daneben. Wenn ich nur einen Fuß auf die Straße setzte, war ich für alle Menschen hier DIE Attraktion. Es verging kaum eine Minute, in der nicht jemand »Mzungu« rief und auf mich zeigte. Kinder rannten sofort zu mir und wollten meine weißen Hände und Arme anfassen, um zu überprüfen, ob die sich auch so komisch anfühlten, wie sie aussahen. Ich war ein Alien! Dabei war es nicht nur die Hautfarbe, sondern auch die Körpergröße. Mit meinen 1,93 Metern hatte sich in Hamburg noch niemand den Hals nach mir verdreht. In Baraka dagegen war ich ein Riese, ein Gigant, ein Außerirdischer. Der längste meiner Kollegen reichte mir gerade mal bis zur Schulter! Unter den 150.000 Einwohnern gab es nur sechs Menschen mit weißer Hautfarbe. Und die arbeiteten alle bei Ärzte ohne Grenzen. Somit konnte man an meiner Hautfarbe erkennen, wo ich arbeite – verrückt! Egal wohin ich ging, egal was ich machte, jeder schaute mich an und rief mir nach. Es wirkte zwar nicht einschüchternd, aber es war unglaublich ungewohnt, so im Fokus zu stehen.
Ich fühlte mich wie ein kleines Baby, das erst einmal lernen musste zu krabbeln, sich aufzusetzen und dann irgendwann auf wackeligen Beinen die ersten Schritte zu wagen. Ich fühlte mich gar nicht mehr wie ich. Ich dachte, ich hätte schon einiges erlebt und könnte mich schnell auf Neues einstellen. Zwischen Schule und Studium war ich als Flugkurier um die Welt geflogen und hatte mich schnell in Ländern wie Mexiko und Trinidad und Tobago zurechtfinden müssen. Auslandssemester in Frankreich und drei Monate Praktikum in Peking, Abenteuerurlaube in Sri Lanka und Benin und eine Fahrradtour von Hamburg über Kaliningrad nach Riga. In meinen ramponierten Reisepass waren schon ein paar Stempel gedruckt worden. Ich dachte, mich könnte nichts so schnell schocken. Flexibel und anpassungsfähig, so schön hieß es ja immer im Lebenslauf. Mit der Zeit hatte ich mir einen Werkzeugkasten angelegt, mit dessen Hilfe man die meisten Situationen gut anpacken konnte. Und wenn mal nicht das rechte Werkzeug zur Hand war, wurde eben ein anderes zweckentfremdet. Hatte bislang immer geklappt.
Und jetzt war ich hier am Ende der Welt, und meine Werkzeuge wollten auf einmal nicht mehr funktionieren. Sie waren total ungeeignet. Konnte ich sonst mit ein paar eloquenten Sätzen den Anschein erwecken, etwas zu verstehen, so stammelte ich nur brutal entstellte französische Teilsätze und wirkte wie der letzte Depp. In der Schule und im Studium war ich mit dem Motto ›Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit‹ im Zweifel immer gut durchgekommen. Das wollte hier irgendwie nicht mehr funktionieren. Bislang hatte ich mir eingebildet, gut einschätzen zu können, ob eine Situation gefährlich war und ich handeln musste. Hier war ich verloren, wenn jemand auf der Straße etwas herumbrüllte. Ich würde den unnützen Werkzeugkasten also ausleeren und mühsam wieder neu füllen müssen.
Und irgendwie schien ich der Einzige zu sein, dem es so ging. Alle anderen Expats wirkten ruhig und gelassen. Problemlos liefen sie durch die Straßen, quatschten in tadellosem Französisch mit den Einheimischen, kannten alle Regeln in- und auswendig – nur bei mir war es offensichtlich komplett anders. Meine Welt stand Kopf! Und ich musste mir eingestehen, dass mein Selbstbewusstsein mehr als nur einen Kratzer abbekommen hatte.
Ich versuchte mir etwas Zeit zu geben, was eigentlich nicht meine Art war. Die Dinge mussten sofort funktionieren. Aber ich hatte noch meine Rettungsleine nach Hause. Dank der wirklich ausgezeichneten Internetverbindung konnten Katharina und ich problemlos täglich miteinander telefonieren – sogar mit Video! Was für ein Genuss, inmitten der Andersartigkeit des Kongos eine so bekannte Stimme zu hören und ein vertrautes Gesicht zu sehen.
Um Freunde und Familie an meinem Abenteuer teilhaben zu lassen, erstellte ich noch eine WhatsApp-Gruppe mit dem Titel ›Robert im Kongo‹. Als ich die ersten Bilder von Barakas Strohhütten, den Weiten des Tanganjikasees und meinem winzigen Zimmer in Papaya in die Gruppe schickte, wurde mir seltsamerweise klar, dass ich tatsächlich mit Ärzte ohne Grenzen im Kongo war. Es war kein Traum, keine nebulöse Idee, sondern Realität. Und obwohl ich völlig überfrachtet war von Eindrücken, war ich doch genau dort, wo ich sein wollte.
Am Sonntagabend telefonierte ich noch mit meinem jüngeren Bruder Lukas, der seit einem Jahr im chinesischen Shenzhen lebte. Bei ihm war schon der nächste Tag angebrochen, er lebte also irgendwie in der Zukunft. Die Internetverbindung zwischen den beiden Kontinenten war perfekt. Die Stimme war laut und klar und das Video ruckelfrei, ein kleines Wunder. Aber uns trennten nicht nur 9.600 Kilometer, mehrere Zeitzonen und der indische Ozean, sondern gefühlt auch Jahrhunderte. In Shenzhen fuhren zu diesem Zeitpunkt schon 90 Prozent der Autos rein elektrisch, während es in Baraka keine asphaltierten Straßen gab. In China lag der Rekord für den schnellsten Bau eines 57-stöckigen Wolkenkratzers bei 19 Tagen. In Baraka dagegen hatten weite Teile der Bevölkerung Sorge vor dem nächsten Regenguss, der das selbst gebaute Lehmhaus wegspülen könnte. Während mein Bruder am Wochenende im High-Speed-Train mit 300 Kilometern die Stunde in die nächste Metropole ballerte und dabei ein 4K-Video streamte, zuckelte ich mit 15 km/h nach Kalundja und war froh, wenn wir nicht im Matsch stecken blieben. Er lebte wirklich in der Zukunft.
Dann erzählte er von einem neuartigen Virus, das in Wuhan ausgebrochen war. Die Stadt sei komplett abgeriegelt worden, aber mittlerweile gab es auch die ersten Fälle bei ihm in Shenzhen. Temperaturkontrollen an U-Bahn-Stationen, Maskenpflicht in den Zügen, und die meisten Geschäfte seien bereits geschlossen. Das Land steuerte auf einen Lockdown zu. Sorgen machte Lukas sich nicht, aber er konnte es nicht fassen, wie schnell sich alles in den letzten Wochen entwickelt hatte. Für mich klang das unfassbar weit weg. Immerhin war ich hier im Osten des Kongos, völlig von der Außenwelt isoliert. Ich verbuchte das Ganze unter »irgendein Virus in China« und schenkte dem nicht viel mehr Beachtung als einem umgefallenen Sack Reis.