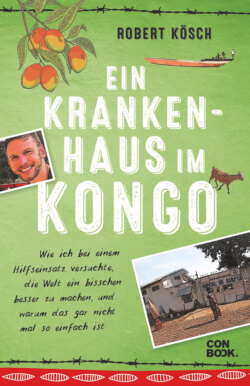Читать книгу Ein Krankenhaus im Kongo - Robert Kösch - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Alles neu
ОглавлениеTrotz des mehrtägigen Vorbereitungskurses in Bonn vor knapp einem Monat, stundenlangen E-Learnings, diversen Briefings in Berlin und Amsterdam und den Einweisungen in der Coordination in Bukavu fühlte ich mich wie ein Kind, das eben erst Fahrradfahren gelernt hat und jetzt bei der Tour de France starten sollte. Aber immerhin war da noch Filippo, der mir das kleine und das große MSF-Einmaleins beibringen würde. Wir hatten eine Woche, bis er zurück nach Italien reisen würde. Es gab viel zu lernen!
Wir starteten mit einem groben Überblick der Aktivitäten von Ärzte ohne Grenzen in Baraka. Es gab zwei Stützpunkte, die jeweils nur sechs Minuten Fußweg auseinanderlagen: Mango und Papaya. Mango unterstützte das bereits existierende Krankenhaus, das Centre de Santé (Gesundheitszentrum), das Malaria-Camp Cent Lits, das Cholerabehandlungszentrum sowie diverse Gesundheitsstützpunkte im Umland, die vom sogenannten Outreach-Team mit Booten und Geländewagen angefahren wurden. Zudem waren in Mango Werkstätten, Schulungsräume, Büros – ein riesiges Projekt mit mehr als 150 nationalen Mitarbeitern und zwölf internationalen Mitarbeitern, den Expats. Das Projekt existierte seit 2003.
Papaya dagegen war deutlich jünger. Es war erst im Herbst 2019 (also dem europäischen) gebaut bzw. umgebaut worden. Vorher war es ein Hotel gewesen. Es sollte die Base für das Team sein, das das neue Krankenhaus wenige Kilometer nördlich im Stadtteil Kalundja bauen sollte. In Papaya arbeiteten drei internationale Mitarbeiter, Alessandro, Filippo und ich, sowie 18 nationale Mitarbeiter, die alle Kongolesen waren und aus der Region kamen:
•sieben Wärter: Amigo, Dobis, Gentil Amani, Jeancy, Mathias, Mattathias und Silvie;
•vier Fahrer: Cedric, Franck, Papa Amuri und Rams;
•zwei Reinigungskräfte: Etoile und Josephine;
•eine Köchin: Clementine;
•zwei Logistiker: Akas und Francois;
•eine Mitarbeiterin für Finanzen und Personalangelegenheiten: Marie;
•eine Assistentin für die Projektleitung: Tabita.
Viele Namen, die ich sofort wieder vergessen hatte, mir aber möglichst schnell merken wollte. Akas und Marie waren dabei meine direkten Kollegen, mit ihnen saß ich im Büro und würde ich in Zukunft viel Zeit verbringen. Noch waren wir einander unbekannt, doch das würde sich schnell ändern. Als Allround-Manager wäre ich für die Finanzen, das Personal und die Logistik der Base verantwortlich. In den kommenden Monaten würden dann weitere internationale Mitarbeiter kommen: Architekten, Bauingenieure, Experten für Wasser und Hygiene, Bauleiter und so weiter. Ich würde ein paar Wochen brauchen, um die Software sowie die diversen Prozesse zu verstehen und selbstständig anzuwenden. Für alles schien es ein Protokoll zu geben, durch das man sich durchkämpfen musste.
Nachmittags begannen wir mit dem Logistikteil. Wie ich morgens schon beim Joggen festgestellt hatte, gab es in Baraka quasi keine Infrastruktur. Wir mussten also weitestgehend autark operieren. Woher kam unser Strom? Was für Back-up-Systeme hatten wir? Was passierte mit unserem Müll? Woher bekamen wir unser Wasser? Wie wurde es aufbereitet? Fragen über Fragen.
In Deutschland hatte ich mich ehrlich gesagt nie gefragt, wo unser Wasser herkommt. Man dreht den Hahn auf, und es kommt eben je nach Bedarf kaltes oder warmes Wasser raus. Alle paar Monate muss man die Wasseruhr ablesen, und dann bekommt man eine Rechnung zugeschickt. Fertig. In einem Ort ohne Wasserleitungen und Kanalisation war das schon etwas schwieriger. Als Filippo mir das Frischwassermanagement von Papaya erklärte, war ich sehr erstaunt:
Im Centre de Santé, das nur einen Steinwurf entfernt lag, hatte MSF vor Jahren einen Brunnen gebaut. Per Funk baten unsere Wärter die Jungs vom Gesundheitszentrum, die Pumpe anzuschalten. Diese würde dann Wasser aus dem Brunnen durch ein eigens dafür eingerichtetes Rohr knapp 180 Meter zu uns in einen riesigen Tank pumpen. Nach Absprache mit den Behörden hatte man einfach einen langen Graben in die sandige Straße gebuddelt, das Rohr versenkt und anschließend wieder zugeschippt. Wenn der große Tank voll war, funkte man erneut die Kollegen im Gesundheitszentrum an und bat freundlich, die Pumpe auszuschalten. In einem nächsten Schritt aktivierte man eine weitere Wasserpumpe, die in Papaya stand. Sie pumpte das Wasser in einen kleineren, circa 3.000 Liter fassenden Tank, der auf zweieinhalb Metern Höhe angebracht war und so für den nötigen Wasserdruck sorgte. Dabei wurde das Wasser noch mit Chlor versehen. Wenn man nun den wackligen Wasserhahn aufdrehte, sprang automatisch eine zusätzliche Pumpe an, die den Wasserdruck verstärkte. Was für ein irrer Aufwand, aber die aktuell beste Lösung! Die Alternative der Einheimischen hatte ich morgens gesehen: langes Warten an den öffentlichen Brunnen und dann schweres Schleppen des kostbaren Guts. Tag für Tag. Dagegen lebte ich in Papaya im Paradies: fließendes Wasser aus dem Hahn. In Zukunft würde ich die Dusche nach dem Joggen noch mehr genießen!
»Robert pour Akas«, krächzte es aus dem Funkgerät.
Puuh, was musste ich jetzt noch mal machen, um diesen Anruf zu beantworten? Verzweifelt versuchte ich mich an die gestrige Einweisung zu erinnern.
»Robert pour Akas«, erklang das blecherne Geräusch erneut.
Da erinnerte ich mich: »Akas pour Robert, bouge canal trois.« Ich wechselte auf Kanal drei und versuchte angestrengt zu erraten, was er mir mitteilen wollte. Meine Französischkenntnisse, der kongolesische Akzent kombiniert mit einer schlechten Funkverbindung gestalteten das Gespräch zu einem Ratespiel.
Zum Abendessen gingen wir rüber zu Mango, um die dortigen Kollegen kennenzulernen. Beziehungsweise wir wurden von Franck hinübergefahren, denn nach 18 Uhr durften wir ja nicht mehr zu Fuß unterwegs sein. In Mango war einfach alles größer. Während wir in Papaya mit Rhino nur ein Fahrzeug hatten, standen hier bestimmt zwölf Geländewagen auf dem riesigen Hof, dazu sogar ein großer Lkw. Alle Fahrzeuge hatten swahilisch klingende Namen: Kinga, Tanganjika, Pamoja etc. Passenderweise hieß der Lkw Tembo, was Elefant bedeutet. Die Expats lebten in sogenannten Tukuls, kreisrunden Hütten, die mit Stroh bedeckt waren und sehr gemütlich aussahen. Eine der besten Sachen in Mango war die Skybar! Eine wackelige Holztreppe führte auf das Dach eines kleinen Häuschens. Bänke mit dicken Polstern luden zum Verweilen ein, und ein einfaches Dach spendete Schatten während der sonnigen Stunden am Tag. Ein Ort zum Lesen, Entspannen und Yogamachen. Da 90 Prozent der Häuser in Baraka ebenerdig waren, hatte man bereits im ersten Stock einen tollen Blick auf die Hügelkette, die sich hinter Stadt erhob.
Das internationale Team war unglaublich divers! Die Kollegen kamen aus Mexiko, Kanada, USA, Haiti, Guinea, Kamerun, Italien, UK und Kenia. Im wahrsten Sinne des Wortes ein wirklich bunter Haufen. Es waren etwa gleich viele Frauen und Männer. Und es waren nicht nur junge Leute dabei, einige waren schon über 60 Jahre alt. Auch hier versuchte ich mir krampfhaft die vielen neuen Namen zu merken: Noor, Mamadou, Rosy, Clare, Gianina, aber es waren einfach zu viele.
Nach dem Essen saßen wir noch zusammen und unterhielten uns. Filippo zog ein vergilbtes Heftchen hervor, auf dem in Französisch ›Traditionelle Medizin‹ stand. Der Untertitel lautete ›Behandeln Sie Ihre Krankheiten zu geringen Kosten‹ – wenn das mal kein schlagendes Verkaufsargument war! Er gab uns eine Kostprobe der kongolesischen traditionellen Medizin: Schwache Spermien etwa könnten mit einer Mixtur aus dem Saft dreier Kokosnüsse, einer Packung Milch und einem Ei erfolgreich behandelt werden. Auch eine schmerzhafte Menstruation gehörte mit diesem Ratgeber der Vergangenheit an: Ein Esslöffel Lehm solle in einem halb gefüllten Wasserglas gut verrührt werden; eine Zitrone und etwas Salz hinzugeben und täglich während der Regel trinken. Wenn das nicht hilft, kein Problem, einfach zusätzlich vier Stücke einer Papayawurzel in drei Litern Wasser eine Stunde lang kochen lassen. Morgens und abends davon ein Glas trinken, bis Besserung einsetzt. So einfach war das! Gegen Krebs hatte der Ratgeber leider kein Wundermittel parat. Stattdessen solle man sich gedulden und auf Gott vertrauen. Wir blätterten durch das Heftchen und mussten schmunzeln. Aber irgendwie blieb einem dabei auch das Lachen im Halse stecken.