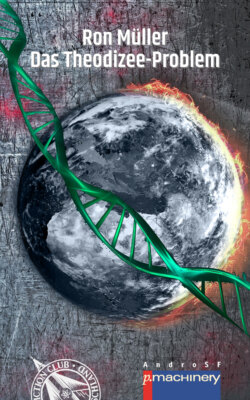Читать книгу DAS THEODIZEE-PROBLEM - Ron Müller - Страница 8
Оглавление6
»Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden den zweiten Tag unseres Kongresses mit einem Vortrag beginnen, der definitiv hohe Wellen schlagen wird.«
Mit tiefer Männerstimme dröhnte der Satz durch das Kongresszentrum, das bis auf den letzten Platz besetzt war.
»Ich kenne Herrn Martens Ausführungen bereits und seine Sicht der Dinge hat mir gelinde gesagt schlaflose Nächte bereitet. Ich denke, Ihnen wird es genauso gehen. Lassen Sie die Argumente auf sich wirken. Sie haben mit unserer Arbeit auf den ersten Blick wenig zu tun, aber wenn William Marten recht behält, stehen wir vor ernsten Problemen. Doch ich will nicht vorgreifen. Nur noch eine Anmerkung. Der Beitrag musste stark eingekürzt werden, da er sich bedauerlicherweise eine Kieferverletzung zugezogen hat. Er konzentriert sich somit nur auf das Wesentliche. Umso erfreulicher, dass er trotz alledem hier ist. Ich übergebe also das Wort an William Marten.«
Der Applaus zog Marten auf die Hauptbühne des europäischen Luft- und Raumfahrtkongresses.
»Ich danke für die Einladung«, begann er. »Es freut mich, heute vor diesem Kreis sprechen zu dürfen, gerade weil alle von Ihnen weitaus mehr von der Raumfahrt verstehen als ich. Deshalb ist die Frage, was ich hier zu suchen habe, durchaus berechtigt. Aber wie bereits angedeutet kann ich zur Diskussion tatsächlich beitragen. Beispielsweise durch die Information, dass das, woran Sie fieberhaft arbeiten, nicht der erste Anlauf für eine Besiedlung eines benachbarten Planeten ist. Vor dreißig Jahren hat es eine ähnliche Planung gegeben, damals im Rahmen eines dänischen TV-Projekts mit einem eigenen Fernsehkanal, der Tag und Nacht jeden Schritt der Bewohner übertragen sollte. Das Vorhaben ist in einem sehr frühen Stadium aus moralischen Erwägungen gestoppt worden. Kein Produzent wollte verantworten, dass dort oben jemand ernsthaft erkrankt und mangels ausreichender medizinischer Versorgung vor laufenden Kameras zugrunde geht. Ich vermute, die Sache war zu kurz in den Medien und ist zu lange her, als dass sie einem von Ihnen noch in Erinnerung ist. Oder irre ich?«
Er ließ den Blick durch die Zuschauerreihen schweifen und hielt sich die Wange, in der es zu schmerzen begann.
»Ich bin durch einen Zufall darauf gestoßen, als mir vergangenes Jahr ein Beitrag in einem Fachblatt aus dieser Zeit in die Hände fiel, der das Thema einer generationsübergreifenden Gefangenschaft anriss. Für mich eine hochspannende Sache, mit der ich daraufhin die letzten Monate zugebracht habe. Für Sie wohl nicht ganz so spannend, da Sie als Praktiker die technische Umsetzung weit mehr interessieren dürfte als das, was der Typ auf der Bühne gerade über Gefangenschaft faselt.«
Marten grinste in sich hinein. Ihm war völlig klar, dass jeder Zweite im Publikum so dachte.
»Aber manchmal sollte man die Praktiker frühzeitig bremsen, damit sie nicht mit zu viel Enthusiasmus eine Idee verfolgen, die von Anfang an keine Zukunft hat – denn verehrte Zuhörer, lassen wir die Katze aus dem Sack: Die Kolonie, die Sie im Sonnensystem planen, egal wie groß die Population ist, wird nach spätestens vier Generationen keine positive Fortpflanzungsprognose mehr haben.«
Marten genoss den Anblick fassungsloser Gesichter und vereinzelte Zurufe. Nur sein Unterkiefer machte ihm heftigst zu schaffen. Wenn er den Mund beim Sprechen nicht allzu weit öffnete, ging es, aber das ließ sich bei dieser Veranstaltung unmöglich durchhalten. Während er weitersprach, zog er die Geldbörse hervor und fing an, darin zu kramen.
»Verstehen Sie mich richtig. Ich finde Ihr Vorhaben großartig und würde mir wünschen, dass es gelänge. Aus meiner fachlichen Sicht jedoch kann es nur scheitern. Denn nach zwei Generationen kommt die Fortpflanzung zwar noch nicht zum Erliegen, aber die Populationsentwicklung wird derart zurückgehen, dass ein dauerhaftes Überleben ihrer Probanden nahezu unwahrscheinlich ist.«
Die Proteste der Zuschauer wurden lauter.
Martens hatte zwischen dem Kleingeld gefunden, wonach er suchte, und zog ein winziges Tütchen hervor.
»Einen Augenblick.«
Er riss es an der schmalen Seite auf und sog das darin befindliche Gel heraus.
»Es schmeckt beschissen«, hatte ihm der Inhaber der Boxhalle versichert, als dieser ihm das Schmerzmittel in die Hand gedrückt hatte. »Bevor du auch nur darüber nachdenkst, das Zeug runterzuschlucken, ist es längst dabei, in deiner Birne einen Schalter umzulegen. Und danach läufst du einen Marathon, selbst wenn ich dir vorher den Fuß breche.«
Obwohl Marten den Typen mit dem permanenten Schweißgeruch grundsätzlich für einen Schwätzer hielt, so hatte er dieses Mal nicht zu viel versprochen.
Mit dem letzten Tropfen auf der Zunge begann der Schmerz aus den Knochen zu weichen und er spürte, wie das hoch dosierte Mittel wirkte.
Ich muss langsam erwachsen werden und mich nicht jedes Mal herausfordern lassen, dachte er, während er das Tütchen verschwinden ließ und sich wieder dem Publikum zuwandte. Wenn es jemand mit zehn Kilo weniger auf den Rippen ohne Probleme schafft, mir den Kiefer mit einer geraden Linken anzubrechen, dann sind meine aktiven Zeiten eindeutig zu lange her. Bin schließlich keine achtzehn mehr.
Eine Viertelstunde später verließ Marten die Bühne und kurz darauf den Saal.
Er ging davon aus, dass er zwar viele im Publikum erreicht hatte, aber nachdenklich stimmen konnte er wohl nur die Wenigsten. Doch das kümmerte ihn nicht – sein Auftrag war es zu informieren, nicht zu bekehren.
Im Foyer befanden sich eine Frau an der Garderobe, ein älterer Mann im Eingangsbereich und zwei Herren in dunklen Anzügen, die auf ihn zukamen.
»Folgen Sie uns«, sagte einer von beiden mit einer Selbstsicherheit, die keine Gegenwehr zuließ.
»Einen Teufel werde ich«, entgegnete Marten empört.
»Es geht um Ihre Arbeit.«
»Ich kenne Sie nicht einmal«, regte sich der Psychologe auf und bekam einen Regierungsausweis vors Gesicht gehalten.
»Wir brauchen mehr Informationen zu dem, was Sie im Vortrag angesprochen haben.«
»Dann lesen Sie meine Studie, so wie ich es jedem da drinnen angeboten hatte. Laden Sie sie herunter. Sie ist frei verfügbar.«
»Lassen Sie das! Sie werden persönlich benötigt.«
»Kein Interesse!«
Marten ließ die Männer stehen und machte sich auf, das Kongresszentrum zu verlassen.
»Ich habe zu Hause einen Teenager. Der stellt mich schon vor genug Probleme. Da brauche ich Ihre nicht auch noch.«
»Sind Sie sicher?«
Die Frage klang bedrohlich.
»Wenn Sie jetzt gehen, sehen wir uns in kürzester Zeit unter anderen Umständen wieder.«
»So motivieren Sie niemanden, junger Mann«, erwiderte Marten, zog sich Atemfilter und Cape über und verließ das Foyer.
Ihm blieben an diesem Tag noch zwölf Minuten, die er im Freien zubringen konnte – zwei, um bis zur RegioMed eine Straße weiter zu gelangen, und zehn für den Heimweg.
Die RegioMed-Stellen waren ursprünglich geschaffen worden, um die flächendeckende ärztliche Versorgung vor allem in ländlichen Gebieten sicherzustellen. Nun drei Jahrzehnte und ein Kassensterben später verkörperten sie den beklagenswerten Rest, der vom staatlichen Gesundheitswesen übrig geblieben war – kleine Geschäftsstellen mit einem Mitarbeiter, der in einem Schalter saß, der Tag und Nacht geöffnet hatte. Einer auf fünfzigtausend Einwohner. Wer einen Arzt brauchte, ging als Erstes dorthin, trug der Person hinter der schusssicheren Scheibe das Problem vor und bekam in seltenen Fällen einen Behandlungsschein. Mit diesem stellte man sich dann in einer der heruntergekommenen Arztpraxen in der Nähe vor. Ein Verfahren, bei dem der Staat zumindest ein Viertel der Kosten für eine Handvoll diagnostischer Maßnahmen und einige Medikamente übernahm. Den Rest musste jeder selbst zahlen.
In Martens Fall bedeutete dies, dass drei Tagesgehälter für die Untersuchung seines Unterkiefers als Eigenanteil fällig werden sollten, wobei der Arzt nichts anderes tun würde, als den Knochen abzutasten und sich von der Funktion der Kiefergelenke zu überzeugen. Eine Computertomografie bei einem Verdacht auf eine Fraktur würde die Kosten verdoppeln. Käme dabei heraus, dass der Bruch operativ versorgt werden müsste, wäre dies für ihn finanziell nicht machbar. Genauso wie der Abszess in Martens Stirnhöhle, den er seit der Scheidung nicht entfernen lassen konnte. Das Gleiche galt für die Nierenpunktion, die er vor sich herschob, seitdem seine Werte nicht mehr stimmten. Allerdings war er mit den Jahren nicht mehr sicher, ob er die Diagnose, die hinter den Beschwerden stand, wirklich wissen wollte. Es gab nur drei Erkrankungen, die zu den Symptomen passten. Zwei waren zu annähernd hundert Prozent heilbar, aber die Therapiekosten machten einige Jahresgehälter aus und lagen außerhalb seiner Reichweite. Variante drei hieß Krebs und würde unweigerlich eine nicht zu stoppende Maschinerie von Konsequenzen nach sich ziehen: Im ersten Schritt müsste Marten akzeptieren, dass ihm die Mittel für die Tumortherapie fehlten. Rücklagen hatte er nicht und jede Bank verweigerte ihm einen Kredit mit einem Krebseintrag in den Daten. Also würde er dem Karzinom Tür und Tor öffnen und es im Grunde genommen auffordern, im Körper Metastasen zu streuen. Während er monatelang darauf wartete, sollte es ihm gesundheitlich immer unmöglicher werden zu arbeiten. Es wäre nur eine Frage der Zeit, bis er vollständig ausfiel. Und dann? Dann wäre die Kündigung unausweichlich und würde ihm langfristig jegliche Existenzberechtigung nehmen. Wenig später würde er ebenso wie seine Ex-Frau aus dem System fallen.