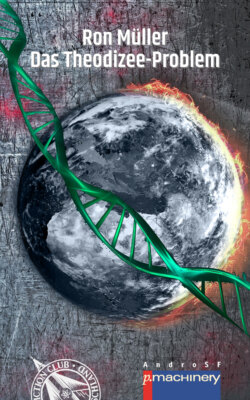Читать книгу DAS THEODIZEE-PROBLEM - Ron Müller - Страница 9
7
ОглавлениеGeschafft ließ sich Marten in den Sessel fallen und riss ein Tütchen des Schmerzgels auf.
»Bist du wieder da?«, fragte er, als die Wohnungstür leise geöffnet wurde.
»Kann dir doch egal sein«, kam es von Zoe zurück, die versuchte, in ihr Zimmer zu verschwinden.
»Mädchen, jetzt warte mal. SO LÄUFT DAS NICHT! Entweder finden wir einen gemeinsamen Nenner, oder wir lassen das Ganze hier.«
»Mann, was willst du denn von mir?!«
Trotzig blieb die Schwarzhaarige stehen.
»Ich habe wirklich Verständnis für deinen Unmut, für die Pubertät und alle anderen widrigen Umstände, aber …« Marten war anzusehen, dass er sich vor Schmerzen kaum auf das Gespräch konzentrieren konnte. »Allerdings geht es mir gerade auch nicht besonders. Ich hatte mittags einen Abstecher in die Boxhalle gemacht, um den Kopf freizubekommen, und mich von Steve zu einer kleinen Runde verleiten lassen. Er hat mir eine Fraktur irgendwo beim Kiefergelenk verpasst. Also nimm dir meinetwegen ein Bier – gern auch etwas anderes, wenn dich das runterbringt. Aber wir beide haben ein ernsthaftes zwischenmenschliches Problem, welches wir entweder jetzt aus der Welt schaffen, oder mein früheres Schlafzimmer wird ab morgen wieder mein Schlafzimmer. Verdammter Mist, tut das weh!«, fluchte Marten und drückte das Schmerzmittel aus der Verpackung.
Als Zoe in der Tür stand und von einem Lagerbier kostete, entkrampften sich allmählich die Falten zwischen seinen Augenbrauen und er konnte wieder klare Gedanken fassen.
»Da hat jemand den Steve unterschätzt, was?«, grinste die Dreizehnjährige.
»Ich hatte nur einen schlechten Tag.«
Marten wusste, dass das gelogen war, aber etwas Gegenwehr von ihm war für den Gesprächsverlauf durchaus förderlich.
»Genau!«, belächelte sie ihn. »Hast du dir mal Steves Arme angesehen und mit deinen verglichen?! Der ist bestimmt drei Mal die Woche im Fitnessstudio. Brauchst du Tiefkühlgemüse?«
Er nickte und sah, wie Zoe im Flur verschwand. Kurz darauf hatte sie die Brieftasche des Vaters in der Hand und erleichterte sie um einen Schein.
Ohne den Hauch eines schlechten Gewissens kam sie mit einer Packung Erbsen zurück, mit der Marten die rechte Wange kühlte.
»William?«
Er hatte im vergangenen Jahr den Zeitpunkt verpasst, etwas dagegen zu tun, dass seine Tochter ihn mit dem Vornamen ansprach. Aus Gründen, die er jetzt nicht mehr nachvollziehen konnte, ließ er es damals durchgehen. So lange, bis es zu spät war.
»Was denn?«
»Das Internet ist tot.«
»Sicher?«
»Es geht seit dem Nachmittag bei niemandem in der Nachbarschaft.«
»Okay. Kümmere mich morgen drum. Hab die nächsten Tage frei.«
»Die Polizei kannst du auch vergessen.«
»Wie meinst du das?«
»Vorn am Eckhaus hat man heute eingebrochen. Die Familie kam vorhin zu uns, weil sie dachten, ihr Telefon sei kaputt. Aber es liegt nicht an den Telefonen. Es geht überhaupt keine Polizeinummer mehr.«
»Das ist merkwürdig.«
Marten stand auf, um sich aus der Vitrine ein Glas zu holen und einen Scotch einzuschenken.
»William?«
»Hmm.«
»Die Nachbarn haben auch gesagt, dass gerade reihenweise Leute aus dem System fallen.«
Marten wusste genau, worauf die Bemerkung hinauslief.
Wie oft haben wir das bereits besprochen, Zoe? Wie oft?
Es war der Frühling nach dem Judgement Day, als die Geburtenrate erstmals auf null Komma fünf sank. Ein halbes Baby auf zwei Erwachsene bedeutete, dass die Bevölkerung mit jeder neuen Generation auf ein Viertel schrumpfte. Zehn Jahre später erschien bei der Quote sogar die erste Null hinter dem Komma. Und als wäre das nicht schon dramatisch genug, kam die Masse des Nachwuchses mit genetischen Fehlern auf die Welt. Der Sozialkollaps 2035 war die logische Konsequenz. Immer mehr Rentner, immer weniger Menschen im arbeitsfähigen Alter und kaum gesunde Kinder. Selbst als wochenlange Proteste folgten, gab es keinen Weg, um das Renten- und Arbeitslosigkeitsversicherungssystem zu halten. Der Sozialstaat war unwiederbringlich gescheitert.
Bis zu diesem Punkt handelte es sich bereits um harte Rahmenbedingungen, die für den Einzelnen nur einen Rest an Planungssicherheit boten, solange man ein gewisses Alter nicht überschritten hatte. Man musste nur arbeitswillig sein und von Anfang an privat vorsorgen.
Der endgültige Genickbruch stand jedoch erst bevor und kam vonseiten der Krankenkassen. Deren völlig überalterter Versichertenstamm beanspruchte immer mehr Leistungen und erbrachte nur noch einen Bruchteil der früheren Einnahmen. Als das Kassensterben 2039 einsetzte und es darum ging, wenigstens einen bundesweiten Versicherungsträger am Leben zu erhalten, funktionierte dies nur mit einem schmerzhaften Einschnitt. Er bestand darin, dass die aus dem System ausschieden, die zu teuer wurden. Kurzum: Wer die Diagnose Krebs oder etwas Vergleichbares bekam, verlor zuerst seine Krankenkasse und aus gesundheitlichen Gründen zwangsweise auch irgendwann den Job. Was blieb, war eine Wohnung, für die das entsprechende Einkommen fehlte. Im Regelfall überschrieben die Betroffenen diese dann einer Agentur, die das Inventar verkaufte und so einen Betrag erzielte, mit dem es möglich war, sich einige Wochen über Wasser zu halten. Oft reichte das, denn die Erkrankten lebten nicht viel länger.
Ein Jahr später war auch die letzte Kasse zahlungsunfähig und das Gesundheitssystem verlor als Institution seine Berechtigung. Das, was im Sprachgebrauch als System übrig blieb, war das, was sich daraufhin entwickelt hatte – ein Markt, auf dem der Großteil der ärztlichen Leistungen bar bezahlt wurde und auf dem der Staat nur noch einen verschwindend geringen Anteil der immens angestiegenen Kosten übernahm. Das, was an medizinischem Fortschritt in den vergangenen zweihundert Jahren das Leben der Bevölkerung verlängert hatte, wurde auf einen Schlag für den überwiegenden Teil nicht mehr finanzierbar. Der Alzheimer-Impfstoff kostete ein durchschnittliches Jahreseinkommen, eine Blinddarm-OP die Hälfte. Den meisten Menschen war es von da an unmöglich, an einer umfangreichen ärztlichen Versorgung teilzuhaben. Damit reduzierte sich deren Lebenserwartung auf das Niveau des neunzehnten Jahrhunderts. Es profitierten nur noch die vom System, die über das entsprechende Vermögen verfügten. Alle anderen schieden über kurz oder lang aus.
Zoe wusste, wie das System funktionierte. Sie war intelligent genug zu erkennen, in welchen Situationen Personen herauszufallen drohten und wann es kein Zurück mehr gab. Doch selbst wenn sie das Prinzip verstanden hatte, hieß das noch lange nicht, dass sie es auch akzeptierte – denn seit zwei Jahren fehlte die Begründung, warum es ihre Mutter getroffen hatte. Ohne Vorankündigung. Ohne ein Wort der Erklärung. Sie hatte sich nicht einmal verabschiedet.
Das machte es Zoe unmöglich, den Verlust zu akzeptieren. Deswegen machte sie ihn immer dann zum Thema, wenn ein Gespräch auch nur ansatzweise in die Richtung ging.
»Du hast doch damals gesagt, dass du nach der letzten Nachricht von Mama auf deiner Mailbox keine Ahnung hattest, wo sie war.«
»Genau«, antwortet Marten, obwohl er lieber eine Grenze gezogen und ein für alle Mal klargestellt hätte, dass er diese Fragen nicht länger ertrug. »Ihre Handynummer hatte sie beim Provider abgemeldet und die Wohnung wurde zu dem Zeitpunkt gerade abgewickelt. Ich hatte lediglich die Freigabe, deine persönlichen Sachen zu holen. Es gab keinerlei Möglichkeit, an sie ranzukommen.«
»Weshalb hast du sie nicht hierher geholt?«
»Hörst du mir denn zu? An sie war überhaupt kein Rankommen. Und Zoe, wir waren seit Ewigkeiten getrennt«, sagte Marten und verschwieg, wie abwegig er diesen Gedanken fand. »Deine Mutter und Hilfe annehmen? Das hat noch nie zusammengepasst. Warum sollte das ausgerechnet an so einem Punkt anders sein? Sie ist einfach gegangen.«
»Sag schon, hättest du sie aufgenommen, wenn sie gefragt hätte?«
Zoes Stimme schlug bereits wieder ins Schrille um, so wie am Morgen, kurz bevor sie zur Schule aufgebrochen war.
»Sicher«, log Marten und nippte am Scotch. Am liebsten wäre ihm jetzt ein Doppelter auf Ex gewesen und gleich darauf ein zweiter. Aber seit er mit einer Schulpflichtigen zusammenlebte, gehörten solche Trinkgewohnheiten der Vergangenheit an.
»Warum gehen wir in keinen Distrikt?«, wechselte Zoe das Thema.
Nicht schon wieder. Ich ertrage das nicht mehr!
Wie gern hätte Marten diese Diskussion im Keim erstickt, die er mit seiner Tochter inzwischen im Wochentakt führte. Ein Leben im Distrikt kam für ihn nicht infrage. Alle aus dem Bekanntenkreis, die beschlossen hatten, in die Kolonie zu gehen, waren von da an komplett von der Bildfläche verschwunden. Kein Anruf, keine Nachricht. Nie wieder.
»Kannst du damit endlich aufhören?!«
»Heute war der Ausflug ins Museum.«
»Okay.«
»Liam ist immer nur still hinterher getrottet. Genau wie die letzten Tage schon. Selbst wenn man ihn angesprochen hat, sagte er kaum was. Am Ende ist er dann nicht mit uns zurückgefahren, sondern seine Mutter hat ihn abgeholt. Da gab’s ein kurzes Gespräch mit dem Lehrer und plötzlich hieß es, dass wir zukünftig nur noch zu sechst in der Klasse sind.«
»Vielleicht ziehen sie ja woanders hin?«, antwortete Marten.
»HÄLTST DU MICH FÜR BESCHEUERT?!«
Zoes Augen füllten sich mit Tränen, denen nur ein Wimpernschlag fehlte, damit sie auf die Wangen fielen.
»Es zieht überhaupt niemand um! NIE ZIEHT JEMAND UM! Mann, wir waren letztes Jahr noch acht in der Klasse.«
»Zoe«, beschwichtigte der Vater.
»Willst du eigentlich darauf warten, dass ich auch krepiere?«
»Jetzt dramatisiere doch nicht. Weißt du denn, ob er sich an die Ausgangszeiten gehalten hat? Womöglich lief er regelmäßig länger als die fünfundvierzig Minuten draußen herum. War er ständig mit Filter und Cape unterwegs? Hat er beides täglich getauscht? Besitzen die Eltern in ihrem Haus eine vernünftige Luftfilteranlage? Es gibt so viele Dinge, mit denen er oder seine Familie eine Verstrahlung selbst verursacht haben könnte. Was denkst du, warum ich diese Sachen immer wieder predige!«
Marten sprach das Gasnetz erst gar nicht an, weil wohl niemand in Zoes Klasse das Vermögen hatte, um sich daran anschließen zu lassen – auch wenn das das Beste war, was man tun konnte.
Mit dem Jahrtausendwechsel wurden kommunale Gasnetze für die Versorgung der Bevölkerung zunehmend uninteressant. Kaum jemand kochte noch mit Gas und immer weniger nutzten die fossilen Brennstoffe für die Heizung. Aber die Leitungen lagen in der Erde, obwohl sie keine wirtschaftliche Bedeutung mehr hatten. Damals ahnte niemand, dass sie ein Milliardengeschäft ermöglichen würden. Denn mit dem Judgement Day stieg die Nachfrage nach strahlungsfreier Atemluft dramatisch an. Luftfilteranlagen in den Wohnungen schafften es zwar, die Radioaktivität zu mindern, aber sie konnten sie nicht gänzlich beseitigen. Dies war nur möglich, wenn sich eine Familie zu horrenden Preisen an das Gasnetz anschließen ließ, durch das ab Mitte der Zwanzigerjahre reine Atemluft floss. Sie strömte kontinuierlich aus und erzeugte in den Räumen einen minimalen Überdruck. Sobald es dann kleinere Undichtigkeiten zum Beispiel an den Fenstern gab, sorgte der Überdruck dafür, dass Luft immer nur nach außen und nie in die Wohnung hineinströmte. In Verbindung mit einer Eingangsschleuse im Flur und konsequenter Dekontamination der Kleidung konnte die Strahlungsbelastungen in den eigenen vier Wänden im Vergleich zu herkömmlichen Haushalten auf unter zwölf Prozent reduziert werden.
»WEIL DIR NICHTS BESSERES EINFÄLLT!«, schrie Zoe. »Denn du hast auch keine Ahnung, wie man verhindert, dass neun von zehn Leuten an Krebs verrecken! Ist es so schwer zu begreifen, dass ein Distrikt die einzige Lösung ist?!«
Es machte Marten wahnsinnig, dass er emotional so tief in der Auseinandersetzung mit seiner Tochter steckte. Würde ihm ein Außenstehender die Situation schildern und hätte er ausreichend Abstand zu den Beteiligten, könnte er problemlos einen professionellen Rat geben, wie man mit einem Teenager dieses Kalibers umgehen sollte. Doch so wie er in den Fall verwickelt war, nutzte ihm weder sein Studium etwas noch die Berufserfahrung. Alles wühlte ihn derart auf, dass er kaum sachlich bleiben konnte. Das spürte er ein ums andere Mal, seit Zoe bei ihm lebte.
»Und was hat man in der Kolonie für eine Perspektive?«, fragte er. »Wie beschissene Laborratten im Käfig. Ohne freien Willen. Das hat doch nichts mit Leben zu tun.«
»WOHER WEISST DU DAS? WARST DU SCHON MAL DORT?«, schrie sie.
»DAS WEISS MAN EBEN!«, brüllte er zurück.
»Aber wenigstens ist es ein Leben!«, giftete Zoe ihn an. »Nimmst du wirklich in Kauf, dass ich irgendwann genauso wie Liam draufgehen werde?«
»VERZIEH DICH IN DEIN ZIMMER«, schrie Marten. »Und dann denke mal darüber nach, was ich dafür kann, dass deine Mutter sich sang- und klanglos verpisst hat. ICH KANN ES NICHT MEHR HÖREN!«