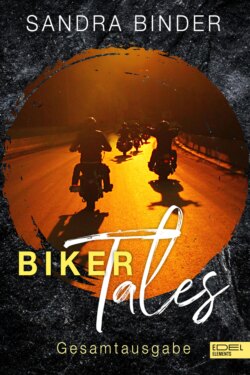Читать книгу Biker Tales - Gesamtausgabe - Sandra Binder - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Chapter Three – Dead Memories
Оглавление»Du siehst furchtbar aus.« Maya blieb am Eingang zu Beas Abteil stehen, schaute abwägend auf sie herab und verschränkte die Arme vor der Brust. »Hast du heute Nacht überhaupt geschlafen?«
»Bestimmt volle zwei Minuten.« Bea rieb sich die müden Augen. »Ich glaube, ich habe einen Kater.«
Allerdings weniger vom Wodka als von Charlie. Konnte man einen Gefühlskater haben?
Dieses Mal werde ich es dir nicht so leicht machen, vor dir selbst zu fliehen.
Bea hörte noch immer seine rauen Worte, als stünde er direkt neben ihr. Vor ihrem inneren Auge erschien sein Gesicht; sie sah den verlangenden Blick in seinen Augen, roch seinen entflammbaren Duft und schmeckte eine Mischung aus Rauch und Whisky auf ihrer Zunge. Die Erinnerung ließ einen wohlig warmen Schauer durch ihren Körper sprudeln.
Die gesamte Nacht lang hatte sie sich im Bett gewälzt und konnte nicht aufhören, daran zu denken und seine Berührungen nachzuspüren. Wie war es möglich, dass sich etwas so Falsches so verdammt gut anfühlte?
Sie riss sich von den Gedanken los und schaute zu Maya auf. Hitze schoss in ihre Wangen beim Anblick des Grinsens auf dem Gesicht ihrer Kollegin.
»Was hast du gestern gemacht?«, fragte diese mit wackelnden Brauen. »Und wieso hast du mir nicht Bescheid gesagt, dass du ausgehst?«
»Ich bin nicht ausgegangen. Ich war im Demons’ Courtroom.«
Maya schlenderte zu Beas Schreibtisch, setzte sich auf die Tischkante und musterte sie neugierig. »Du bist also Charlie begegnet. Und dann habt ihr zwei alten Saufkumpane ein paar Drinks gekippt und in Erinnerungen geschwelgt?«
»Nicht direkt.« Bea massierte sich die Stirn und dachte an die Stunden in der Bar. Die Erinnerung fühlte sich unwirklich an, wie ein Traum. Sie konnte schlichtweg nicht fassen, wie unmöglich und kindisch sie sich verhalten hatte. Sie schämte sich für ihr Flirten mit Joshua und den Versuch, Charlie eifersüchtig zu machen. Wie alt war sie? Sechzehn?
Eine Erwachsene wäre auf ihn zugegangen, hätte ihn freundlich begrüßt, vielleicht ein wenig Smalltalk gehalten, aber mit Bestimmtheit erklärt, dass sie sich für ihr früheres Verhalten schämte, sich geändert hatte und die Freundschaft nicht wieder aufleben lassen wollte. Sachlich und vernünftig. Stattdessen hatte sie sich aufgeführt wie eine prämenstruale Zicke und sich am Ende nicht nur von ihm küssen lassen, sondern sich auch regelrecht an ihn geklammert wie eine Ertrinkende. Wenn das nicht peinlich war … und so atemberaubend scharf, dass ihr bei der Erinnerung noch immer höllisch heiß wurde. Heiß, aber dennoch peinlich. Immerhin war er ein Outlaw, verdammt nochmal!
Ganz davon abgesehen, dass eine Beziehung zu einem Kriminellen niemals für sie infrage käme, wäre sie für ihn sowieso nur eine von vielen Frauen. Biker waren nicht unbedingt dafür bekannt, bekennend monogam zu sein. Das hatte Bea am gestrigen Abend selbst gesehen. Und sie hasste es, wie sehr sie dieser Umstand verletzte.
Schluss mit den angestaubten Schulmädchengefühlen!
»Was war denn dann los?« Maya sah mit ihren großen, grünen Kulleraugen ein bisschen aus wie ein Welpe, der darauf wartete, dass Frauchen den Ball warf. »Lass dir nicht alles aus der Nase ziehen.«
»Na ja, ich weiß nicht recht, was gestern Abend in mich gefahren ist. Vielleicht war es ein Glas Wodka zu viel oder es ist diese Hitze hier. Jedenfalls hat mich so ein ekelhafter Perversling betatscht, Charlie hat ihn daraufhin, ähm, verjagt und dann haben wir uns gestritten … Am Ende hat er mir die Schlüssel abgenommen und mich nach Hause gefahren.«
Bea beschloss, es bei dieser kurzen Zusammenfassung zu belassen. Sie hatte absolut keine Lust darauf, ihr irrationales Verhalten oder die idiotischen Gefühle mit einer fast Fremden zu besprechen. Auch wenn sie Maya mehr vertraute als irgendeinem anderen Menschen in den letzten Jahren, war es ihr doch zu intim.
Überraschenderweise lachte ihre Kollegin auf. »Ha, der Klassiker! Schade, dass ich nicht dabei war – ich hätte gern mal wieder die alte Bea in Aktion erlebt.«
Bea blinzelte sie schockiert an. »So war das nicht. Ich bin nicht mehr dieser Mensch!«, entgegnete sie etwas energischer als beabsichtigt.
»Okay.« Maya hob abwehrend die Hände. »Wenn du meinst.«
Erst jetzt merkte Bea, dass sie ihren Bleistift so fest umklammerte, dass sie sich ihre eigenen Fingernägel in die Handfläche bohrte. Langsam legte sie den Stift neben ihrer Tastatur ab, dann massierte sie sich die Stellen, an denen ihre Nägel Abdrücke hinterlassen hatten.
»Weißt du, ich habe nie kapiert, was das zwischen euch war.« Maya richtete den Blick auf die graue Wand, die Beas und ihren Arbeitsplatz voneinander trennte, wirkte jedoch, als sehe sie dort etwas völlig anderes. »Wart ihr Freunde, du und Charlie? Geliebte? Spint-Nachbarn mit Extras? Ich konnte das nie ganz einschätzen.«
»Ich auch nicht«, gab Bea zu und konnte sich ein leises Lächeln nicht verkneifen. »Leidensgenossen trifft es wohl am ehesten. Wir waren nur zwei Kinder, denen das Leben einen bösen Streich gespielt hat, hineingeboren in unfaire Lebensumstände, an denen wir nichts ändern konnten. Wir waren von der gleichen Art, wussten, was im anderen vorgeht. Deshalb haben wir uns wortlos verstanden.« Seufzend senkte Bea den Blick auf ihre Hände. »Charlie war der einzige Mensch, dem ich vertraute. Umso härter traf es mich, dass ich nicht mit ihm zusammen sein durfte. Ich dachte damals, das sei symptomatisch für mein Leben. Ich kannte es nicht anders.«
»Ich habe einmal gesehen, wie Rektor Brown euch zusammen im Treppenhaus erwischt hat.« Maya sog die Luft durch die Zähne und schnitt eine Grimasse. »Ich dachte, dem Typen fliegt gleich der Kopf weg, so zornesrot war der. Und ich glaube, es kam sogar ein bisschen Rauch aus seinen Ohren.«
Bea lachte humorlos auf. »Dieses Arschloch hatte mich vom ersten Tag an auf dem Kieker. Er konnte mich nicht ausstehen, weil er dachte, ich sei ein schlechter Umgang für seinen Adoptivsohn. Ich. Für den Kerl, der einer Horde motorradfahrender Outlaws vorsteht.«
Kichernd winkte Maya ab. »Der alte Brown konnte niemanden ausstehen. Der war gedanklich in Vietnam hängengeblieben und hat versucht, an einer öffentlichen High School knallhart Disziplin und Ordnung durchzusetzen. Ich frage mich heute noch, wie jemand einen sichtlich traumatisierten Veteranen auf unschuldige Kinder loslassen konnte.«
»Wenn du fachlich gut bist, interessiert es niemanden, wie es in dir aussieht.« Bea zuckte mit den Schultern – das kannte sie von ihrem Vater. »Er war zu keinem besonders nett, das weiß ich, aber mich hat er eine Spur stärker gehasst als alle anderen. Vermutlich war das mein Erbe. Nachdem mein Vater ihm den Bau der neuen Turnhalle eingestellt hatte, wurden die Kramers für ihn zu schleimigen Maden. Wir waren der Feind. Und wenn Charlie bloß in meine Richtung schielte, gab es Ärger.« Bea schüttelte seufzend den Kopf. »Vielleicht war es besser, dass wir nicht mehr Zeit miteinander verbringen konnten. Charlie hat stets das Düsterste in mir hervorgerufen. Wenn ich nur daran denke, was ich für ihn alles angestellt habe … Er tat mir nicht gut.« Heute noch nicht, fügte sie in Gedanken hinzu. Es war, als sei sie in seiner Gegenwart ein anderer Mensch, und das noch Jahre später.
Maya kniff die Brauen zusammen und verschränkte die Arme vor der Brust. Dann schüttelte sie den Kopf. »Ich habe das immer anders gesehen.«
»Ach, ja?« Bea lehnte sich in ihrem Schreibtischstuhl zurück und musterte ihre Kollegin neugierig.
»Für mich wart ihr zwei Menschen, die – komme, was da wolle – zusammenhielten und füreinander einstanden. Niemals hätte einer von euch etwas über den anderen kommen lassen. Deshalb hat sich keiner je getraut, etwas gegen euch zu sagen oder zu unternehmen, denn man wusste genau, dass man damit den vollen und gewaltigen Zorn des anderen heraufbeschwor. Ihr habt euch beschützt wie Löwen.« Sie lächelte Bea ungewohnt schüchtern an. »Wenn ich ehrlich bin, habe ich euch immer beneidet. Ich wollte das auch, jemanden, der so verlässlich an meiner Seite steht und sich aus vollem Herzen für mich einsetzt. Ich wünsche mir das heute noch. Ich meine, wer nicht?«
Obwohl Bea bei Mayas Worten eine merkwürdig sanfte Wärme in der Brust spürte, lachte sie auf. »Ach, es war nicht derart tiefschürfend«, sagte sie und wusste im selben Moment, dass ihre Worte schlicht gelogen waren. »Wir waren jung und wütend.« Betont unbekümmert winkte sie ab. »Heute sind wir klüger. Zumindest manche von uns. Charlie und ich stehen jetzt auf unterschiedlichen Seiten des Systems, und zurück bleiben nur tote Erinnerungen.«
Sie war nicht sicher, ob sie versuchte, Maya oder sich selbst etwas einzureden. Erinnerungen waren nun einmal nicht tot, wenn sie in der Gegenwart auf schwarzen Harleys durch die Gegend cruisten. Und so sehr sie sich dagegen wehrte, sie musste sich eingestehen, dass Charlie dem Jungen von damals gewaltig ähnelte. Es lag an seiner Art zu reden, daran, wie er Ernstes ins Lächerliche zog, wie er die Arme vor der Brust verschränkte, wenn ihm etwas nicht passte und vor allem an der Art, wie er sie ansah …
Automatisch dachte Bea zurück an die Schulzeit. An die längsten und ehrlichsten Unterhaltungen, die sie in ihrem Leben geführt hatte. An die Treffen an geheimen Orten, während sie den Unterricht schwänzten, damit sie nicht zusammen erwischt wurden. Sie schob die Gedanken fort und versuchte stattdessen, Maya in ihrem Gedächtnis wiederzufinden. Ohne Erfolg. Es tat ihr leid, dass sie sich nicht an die Frau erinnern konnte. Obwohl diese andersherum noch verdammt viel wusste. Bea hatte eben nie etwas für jemand anderen als Charlie und seinen besten Freund Chris übrig gehabt. Es stimmte, sie war jung und wütend gewesen. Und ihre Mitschüler mussten das oft ausbaden.
»Sag mal, Maya … war ich in der Schule gemein zu dir?«
Maya zuckte mit den Schultern. »Ein bisschen.«
»Dachte ich mir. Das tut mir ehrlich leid. Wieso bist du jetzt so nett zu mir?«
»Na, ich war ja nichts Besonderes – du warst zu jedem gemein.« Sie grinste, dann legte sie eine Hand auf Beas Schulter. »Viele haben das nicht mitgekriegt, aber ich habe gesehen, wie deine Eltern waren. Du hattest es schwer und nur versucht, auf eine – zugegeben, etwas unorthodoxe – Weise die Kontrolle über dein Leben zu behalten. Das kann ich dir einfach nicht übel nehmen. Ich habe auch verstanden, warum du abgehauen bist.«
Bea konnte nicht anders, sie war beeindruckt. Maya war anscheinend einer dieser aufmerksamen Menschen, die mehr wahrnahmen als der Rest der Welt. Umso verwunderlicher, dass sie bei Dingen, die sie selbst betrafen, derart blind war. Sie merkte nicht einmal, dass ihr Kollege Daniel verliebt in sie war, dabei hatte Bea es auf den ersten Blick gesehen.
»Ich wusste, ich würde noch wütender werden, wenn ich hierbliebe«, erwiderte sie. »Ich hätte immer mehr Ventile gesucht, um Dampf abzulassen, und letztendlich wäre ich kriminell geworden und im Knast gelandet. Ich bin abgehauen, weil ich ein anständiger Mensch werden und die Chance auf eine bessere Zukunft haben wollte.«
»Hat nicht besonders gut funktioniert, was?«
»Der Plan pausiert nur. Und daran bin gar nicht ich schuld, sondern der betrügerische Mistkerl, mit dem ich mich verlobt habe und der mich ruiniert hat. Aber diesen Rückschlag werde ich verkraften. Ich habe schon weit härtere Schläge eingesteckt. Und wenn ich mich von nun an von Outlaws, Alkohol und Bars fernhalte, komme ich sogar ohne weiteren Ärger hier durch.«
Maya gab ein merkwürdiges Brummen von sich. »Ich will dir ja echt nicht reinreden in deinen Friede-Freude-Eierkuchen-Plan, aber ich denke du hast eine falsche Vorstellung. Charlie und der MC, die sind …«
»Was ist denn hier los?« Hal Peters, der Amtskotzbrocken, erschien am Eingang von Beas Abteil und bedachte die Frauen mit einem abschätzigen Blick. »Sie sind hier nicht im Frisörsalon, Ladys, tratschen können Sie in Ihrer Freizeit.« Er fuhr sich durch die tiefschwarz gefärbte Tolle, bevor er mit einem süffisanten Lächeln auf Bea zu ging. »Ich habe vor geraumer Zeit ein Diktat an ihr Postfach weitergeleitet. Sie sollten sich die Arbeitshaltung, die sie hier an den Tag legen, lieber nicht angewöhnen. Das wird oben gar nicht gern gesehen, haben wir uns verstanden?« Damit drehte er sich um und stolzierte davon. »Ich will den Text bis zur Mittagspause auf meinem Schreibtisch haben!«
Bea schluckte die Wut hinunter und atmete tief durch. »Arrogantes Arschloch«, murmelte sie.
»Wow, du hast dich wirklich verändert.« Als sie fragend zu Maya aufblickte, fügte diese hinzu: »Früher hätte niemand ungestraft so mit dir geredet.«
»Was schlägst du denn vor, was ich tun soll? Ihn in seinen Spint sperren? Oder ihn in den Brunnen auf dem Schulhof schubsen?« Sie hielt kurz inne, denn die Vorstellung war zu witzig. »Ich bin erwachsen geworden. Und Erwachsene regeln ihre Angelegenheiten zivilisiert.«
Nickend erhob sich Maya vom Schreibtisch. »Ich wusste gar nicht, dass ›erwachsen‹ und ›zivilisiert‹ Synonyme für ›memmenhaft‹ sind. Außerdem bist du nicht seine Sekretärin.« Langsam schlenderte sie aus Beas Abteil. »Welches Fossil spricht heute überhaupt noch Diktate ein?«
Bea winkte ab und setzte die Kopfhörer auf, um sich um ihre Arbeit zu kümmern. Maya wusste nicht, wovon sie da redete. Niemand wollte die alte, jähzornige, aufsässige Bea wiederhaben. Am allerwenigsten Bea selbst.
*
Nach der Arbeit wollte Bea noch beim Supermarkt vorbeifahren, denn im Kühlschrank ihrer Mutter befanden sich nur noch Essiggurken, Sprühkäse und irgendetwas, das vielleicht einmal Schinken gewesen sein könnte. Allerdings war sie gedanklich derart blockiert, dass sie die Ausfahrt verpasste und dies erst an der Ortsgrenze bemerkte. Sie beschloss, die Gelegenheit zu nutzen, drehte nicht um, sondern fuhr einfach weiter, bis sie vor und hinter sich nichts als Straße, Sand, Felsen und Gestrüpp sah. Mitten in der Einöde hielt sie am Straßenrand und stieg aus.
Die Luft hier draußen schien heißer und rauer; Bea konnte die feinen Sandkörnchen nach kürzester Zeit auf ihrer erhitzten Haut spüren. Sie schälte sich aus ihrem Blazer und warf ihn auf den Beifahrersitz, dann entfernte sie sich vom Pick-up und der Straße, wanderte hinein in die Wüste, wobei sie zwei Felsen in Torbogenform als Orientierung benutzte.
Als sie die Straße nicht mehr sehen konnte, machte sie halt, setzte sich auf einen Felsen und starrte in die weite Ferne des Red Sand Valley. Es hatte seinen Namen nicht wegen des roten Sands bekommen. Das Gelände sah in Wahrheit eher aus wie ein beigebrauner Teppich, auf dem sich hin und wieder ein vertrocknetes Büschel Gras oder ein Kaktus fand. Nein, der rote Sand war eine Metapher für blutige Erde, denn diese Gegend, so hieß es, diente früher als riesiger Friedhof für Minenarbeiter. Wahrscheinlich war der Ort deswegen so farb- und trostlos. Und aus diesem Grund fraß er wohl auch quälend langsam die Seelen der Menschen, die in ihm lebten.
Bea vermisste die Parks von New York: Den saftig grünen Rasen, die schillernd blauen Seen und die Bäume, deren Blätter sich im Herbst in ein prächtiges Farbenmeer verwandelten. Immer, wenn ihre Gedanken zu laut wurden und ihr Leben drohte, sie zu erdrücken, war sie durch die Natur spaziert. Manchmal brauchte sie diese Ruhe, die Einsamkeit, um zurück zu sich selbst zu finden und sich daran zu erinnern, was sie wirklich wollte. Es war, als könnte sie sich selbst nur dann hören, wenn alles andere still war. Aber stiller als in der Wüste, das musste Bea zugeben, war es vermutlich nirgends.
Dennoch fand sie heute keinen richtigen Draht zu sich. Sie war in den letzten Tagen so gewaltsam mit ihrem alten Ich konfrontiert worden, dass es nun beinahe schien, als lebten zwei Personen in ihrem Körper. Es war unheimlich, welche Zwiegespräche sie in Gedanken führte und wie oft sie sich widersprach. Dabei wusste sie genau, was richtig und was falsch für sie war. Das Gemeine war nur, dass es verdammt viel schwerer war, das Richtige zu tun.
Manchmal fragte sich Bea, ob das normal war. Ob es tatsächlich derart anstrengend war, sich das Leben aufzubauen, das sie sich wünschte, oder ob sie irgendetwas falsch machte. Sie hatte bereits alles versucht und immer wieder war sie gescheitert. Dabei wollte sie nur ein hübsches Häuschen, einen guten Mann, einen respektablen Job, eine Familie … Millionen von Menschen hatten das. Aber Bea konnte tun, was sie wollte, sie erreichte ihr Ziel nicht. Es war, als rannte sie gegen einen Sturm an, und jedes Mal, wenn sie ihrem Traum nahe kam und nach einem Zipfel davon greifen wollte, wurde sie von einer Böe zurückgeschleudert. Entweder erwiesen sich die Männer als Fehlgriffe oder die Jobs. Wieso war das nur alles so schwer? Verlangte sie zu viel?
Schnaubend schüttelte Bea den Kopf. Nein. Diese Gedanken machte sie sich nur, weil sie hier war. Am liebsten wäre sie in den Pick-up gestiegen und davongefahren, weit weg. Aber wo sollte sie schon hin ohne Geld, ohne Rücklagen, dafür mit einem Berg von Schulden? Verdammter Jacob. Bea hatte das Betriebswirtschaftsstudium nur begonnen, weil er ihr versprochen hatte, sie finanziell zu unterstützen. So wie er versprochen hatte, sie zu heiraten. Stattdessen hatte er sie betrogen, aus der Wohnung geworfen, sie wegen Körperverletzung angezeigt und ihr eine detaillierte Aufstellung ihres ›Darlehens‹ bei ihm zugeschickt. Er war an dieser Misere schuld, nicht sie. Und bis sie diesen Mist nicht ausgestanden hatte, konnte sie nirgendwo anders hin. Sie hatte keine Wohnung, ihre Freunde waren alle mehr Jacobs Freunde als ihre, sie fand einfach keinen Job in New York, und die Stadt war ein verdammt teures Pflaster. Sie musste die Konfrontation mit ihrer Vergangenheit wohl oder übel ertragen.
Sie erinnerte sich daran, wie sie am Busbahnhof in New York stand, all ihre Habe in einem viel zu kleinen Koffer und drauf und dran, in eine Stadt zurückzukehren, die für sie seit Jahren nicht mehr existiert hatte. Sie hatte tagelang nach einer anderen Lösung gesucht, aber es war die einzige Option gewesen, wenn sie nicht unter einer Brücke schlafen und sich aus Mülleimern ernähren wollte. Also hatte sie die Zähne zusammengebissen, den Widerwillen hinunter geschluckt und sich eingeredet, sie könnte sich zwischen ihrem alten Kinderzimmer und ihrer Arbeitsstelle bewegen, ohne mit anderen Menschen groß in Berührung zu kommen. Wie naiv sie doch gewesen war …
Allerdings hatte sie wirklich nicht damit gerechnet, Charlie wiederzusehen. In den vergangenen acht Jahren hatte sie sich so lebhaft und detailliert ein Leben für ihn zusammenfantasiert, dass sie es am Ende tatsächlich geglaubt hatte. Sie war der festen Überzeugung gewesen, er hätte geschafft, woran sie sich so erbittert versuchte, und lebte mit einer Südstaatenschönheit und zwei süßen, blonden Kindern in einem friedlichen Vorort. Offenbar hatte er das Ziel aber nicht erreicht. Und es sah nicht danach aus, als würde er das jemals. Konnte man überhaupt aus einer Bikergang aussteigen? Wohl eher nicht.
Bea musste akzeptieren, dass sie ihn dieses Mal nicht retten konnte. Es war ohnehin nicht mehr ihre Aufgabe. Aber für sie selbst war es noch nicht zu spät, erinnerte sie sich. Sie war erst sechsundzwanzig und hatte noch Jahre Zeit, um ihren Platz in der Welt zu finden.
Sie bemerkte, wie sich das Licht allmählich veränderte und schräg auf den Sand und die Felsen traf. Da die Dämmerung kurz bevorstand, sollte sie sich lieber auf den Rückweg machen. Denn hier wurde es rasend schnell dunkel, und weit und breit befand sich keine Lichtquelle. Bea wusste nicht genau, wie lange sie hier gesessen und gegrübelt hatte, doch als sie sich erhob, protestierten ihre Muskeln. Etwas steif marschierte sie zurück zur Straße.
Sie hatte gehofft, hier draußen den nötigen Abstand zu finden, um ihre Gedanken ordnen zu können, aber in der verdammten Stille schrien sie nur noch lauter durcheinander.
Als sie am Auto ankam, war es bereits dunkler geworden, und mit der Sonne sank auch die Temperatur. Bea stieg in den Pick-up und schlüpfte in den Blazer, den sie zuvor auf den Beifahrersitz geworfen hatte. Dann steckte sie den Schlüssel ins Zündschloss und drehte. Ein klägliches Rattern war alles, was erklang.
»Komm schon, tu mir das nicht an, bitte«, murmelte Bea und versuchte es weiter, aber der Wagen wollte nicht anspringen.
»Scheiß Schrottkarre!« Bea schlug mit der flachen Hand gegen das Lenkrad. »Das musste irgendwann passieren.«
Sie kramte in der Handtasche, die auf dem Beifahrersitz lag, nach ihrem Handy. Wie sie erwartet hatte, gab es in dieser Einöde keinen Empfang. Nachdenklich trommelte sie mit den Fingern auf dem Lenkrad und sah sich unbehaglich um.
Der Fußweg nach Wolfville dauerte bestimmt zwei Stunden. Auf halber Strecke wäre es stockfinster, und vermutlich würde sie zu Fuß ein wunderbares Ziel für Kojoten und Schlangen abgeben. Großartig. Die einzige Möglichkeit bestand darin, zu warten, bis auf dieser gottverlassenen Straße endlich jemand vorbeikam. Bei ihrem Glück wäre das garantiert ein Perverser oder ein Serienkiller.
Seufzend stieg sie wieder aus, stellte sich an die Straße und schaute zuerst auf die eine, dann auf die andere Seite. Einige Male ging sie um den Wagen herum, lief mal in die eine, dann in die andere Richtung, und lenkte sich ab, indem sie Countrysongs vor sich hin summte. Es kam ihr wie eine Ewigkeit vor, bis sie endlich die Lichter eines herannahenden Fahrzeugs erkannte. Allerdings waren es drei Scheinwerfer, die da auf sie zu kamen.
Bea konnte sich ein Augenrollen nicht verkneifen, als sie das dazu passende Knattern hörte. Es waren drei Motorräder, die in Richtung Wolfville unterwegs waren. Und dass der Biker, der vorausfuhr, Charlie war, wusste sie schon, bevor er nah genug war, um ihn zu erkennen.
Seufzend lehnte sich Bea an den Pick-up und beobachtete, wie Charlie seine beiden Begleiter vorbei winkte und neben ihr anhielt. Er stellte den Motor aus, setzte den Helm ab und schob die Sonnenbrille auf den Kopf. Dabei beäugte er den Pick-up und warf Bea lediglich einen kurzen Seitenblick zu.
»Ist er stehen geblieben?«, wollte er wissen, während er von seinem Bike abstieg.
»Springt nicht mehr an.«
Charlie schaute sich kurz um. »Wieso hast du hier draußen angehalten?«
»Ich wollte mir die wunderschöne Gegend ansehen«, scherzte Bea.
»Du solltest nicht allein durch die Wüste wandern.«
»Danke für den Tipp.«
Bea musterte ihn aufmerksam. Er wirkte zerstreut, als wäre er gedanklich mit etwas völlig anderem beschäftigt und müsste alle Willenskraft aufwenden, um sich der Situation hier annehmen zu können.
»Bist du etwa zufällig hier vorbeigekommen?«, hakte sie nach.
Er machte einen Bogen um sie und ging zur Fahrerseite. »Wir wollten eben zurückfahren, da habe ich einen Anruf bekommen, dass hier ein verlassener Pick-up stehen soll«, sagte er, dann öffnete er die Tür und schwang sich auf den Fahrersitz. »Und da dieser Abschnitt ohnehin auf unserem Weg lag …«
»Vor euch kann man nichts verbergen, hm?«
Er ignorierte sie. Oder hörte sie nicht, das konnte Bea nicht genau sagen. Am liebsten hätte sie gefragt, was mit ihm los war, verkniff es sich allerdings.
Charlie drehte den Schlüssel im Zündschloss – mit dem gleichen Erfolg wie Bea zuvor. Dachte er etwa, sie sei zu dämlich, um ein Auto zu starten?
Na, toll – nach nur zwei Minuten hatte er es geschafft, dass sie wieder wütend auf ihn war. Wieso löste dieser Mann nur solche heftigen Reaktionen bei ihr aus? Obwohl er kaum etwas tat? Im Grunde war es sehr freundlich von ihm gewesen, anzuhalten und ihr zu helfen. Warum also wollte sie ihn am liebsten gegen den Pick-up schubsen?
Charlie stieg wieder aus, öffnete die Haube und warf einen Blick in den Motorraum. Mit konzentrierter Miene schraubte er hier etwas auf und klopfte dort an etwas herum. Und ignorierte Bea dabei.
Das hatte sie gewollt. Getrennte Wege. Es war also völlig irrational und absurd, wütend auf ihn zu sein, weil er nur Augen für das Auto hatte. Verdammt, sie war es trotzdem. Und das machte sie zusätzlich wütend auf sich selbst. Dazu kam, dass sie bei seinem Anblick ausschließlich an seine fordernden Lippen und seine kraftvollen Hände auf ihrem Körper denken konnte …
Nach einer Weile knallte er die Motorhaube zu und trat neben sie. »Ist wahrscheinlich bloß das Relais. Don kennt den Schrotthaufen. Ich vermute sogar, er steht öfter in seiner Werkstatt als in der Einfahrt deiner Mom.«
Er sah sie immer noch nicht an. Sein Blick suchte die Gegend ab, während er sein Handy aus der Innentasche der Kutte zog, wohl um zu prüfen, ob er Empfang hatte. Mit einem Stirnrunzeln steckte er es zurück, da erhaschte Bea einen Blick auf das Holster, das er unter dem Leder trug – und die Pistole, die darin steckte: eine kleine, fast unscheinbare, schwarze Waffe.
Beas Herz krampfte sich unwillkürlich zusammen. Sie konnte den Blick nicht von der Stelle abwenden, an der die Pistole saß. Wieso trug er eine Waffe? Wo kam er her? Weshalb war er heute derart gedankenverloren? Und warum redete er mit ihr wie ein entfernter Bekannter, der sie zufällig auf der Straße getroffen hatte?
»Sobald wir in der Stadt sind, rufe ich ihn an. Er soll den Pick-up abschleppen und schauen, ob er ihn nochmal zum Laufen kriegt.«
»Wo warst du heute?«, fragte sie unvermittelt.
Das brachte Charlie endlich dazu, ihren Blick zu erwidern. Nun konnte sie sehen, wie erschöpft er war.
Er kniff die Brauen zusammen, überlegte wohl, worauf sie hinauswollte, entschied sich schließlich aber offenbar dafür, vage zu antworten. »Vegas.«
»Hast du einen umgelegt? In Vegas?«, platzte es aus ihr heraus, bevor sie sich bremsen konnte.
Charlie blinzelte sie fragend an. »Was?«
»Irgendwas ist los mit dir, das sehe ich doch. Du bist total abgelenkt.« Sie deutete auf die ausgebeulte Stelle an seiner Kutte. »Und du hast eine Waffe bei dir. Trotz Nevadas liberalem Waffengesetz ist es illegal, eine versteckte Pistole zu tragen. Außer du hast eine Genehmigung. Hast du eine?«
Er musterte sie einen Moment lang irritiert, bevor sich sein rechter Mundwinkel hob. Wie widersinnig, dass diese kleine Bewegung Bea beruhigte. »Bist du ein Cop? Darf ich mal deine Marke sehen?«
»Das ist nicht witzig, Charlie.« Sie verschränkte die Arme vor der Brust und schaute ihm durchdringend in die Augen. »Wieso trägst du eine Waffe?«
»Als ob ich darauf irgendetwas antworten könnte, das dir passt. Oder was du mir glauben würdest.« Er ging zu seinem Bike und schwang sich auf den Sitz. »Also, was ist, Officer? Verhaftest du mich jetzt oder fährst du mit in die Stadt?«
Bea lehnte sich an den Pick-up und schaute stur geradeaus an ihm vorbei. »Mit dir fahre ich nirgendwohin.«
»Herrgott, Bea, mir steht die Scheiße bis zum Hals, ich habe jetzt keinen Nerv für die Yankee-Zicke in dir. Könntest du einfach wieder normal sein und dir die Diva-Allüren verkneifen?«
Die Ansprache kam nicht nur unerwartet, er wirkte auch ungewöhnlich ernst und wütend, was Bea einen Schauder über den Rücken laufen ließ; es musste ihn etwas belasten, wenn er derart ungeduldig war.
Automatisch hob sie das Kinn. »Ich bin normal. Du bist der, der mit einer Knarre durch die Gegend fährt.«
»Schön. Dann bleib hier.« Er startete die Harley, setzte seinen Helm auf und warf ihr einen spöttischen Blick zu. »Der böse Outlaw besorgt der Prinzessin einen Abschleppwagen. Warte einfach hier.« Da Bea nur finster dreinschaute, fügte er hinzu: »Normale Menschen bedanken sich übrigens, wenn ihnen jemand hilft.«
Daraufhin gab er Gas und ließ sie stehen. Vielleicht nicht ganz zu Unrecht.
Bea schaute seinem Rücklicht hinterher, bis es in der Ferne verschwand. Kurz darauf bemerkte sie, wie kalt und dunkel es inzwischen geworden war und verfluchte sich, weil sie sich erneut wie ein trotziger Teenie verhalten hatte, deshalb nun allein in der Pampa stand und auf einen Abschleppwagen wartete, der vielleicht erst in zwei Stunden kommen würde.
Wieso verhielt sie sich nur so? In Charlies Nähe schien sich ihr rationaler Verstand abzuschalten.
Seufzend ging sie zur Fahrerseite des Pick-ups und setzte sich auf den Sitz. Im Inneren des Wagens war wenigstens noch ein Rest Wärme gespeichert. Sie lehnte sich zurück, schloss die Augen und versuchte, an gar nichts zu denken. Ohne Erfolg.
Es machte sie beinahe wahnsinnig, nicht zu wissen, was Charlie beschäftigte. Und wieso er eine Waffe trug. Ein leiser Hauch von Sorge strich durch ihre Gedanken: Steckte er in Schwierigkeiten? War er in Gefahr?
Schnaubend schüttelte sie den Kopf. Er war die Schwierigkeiten. Er war die Gefahr. Es sollte sie verdammt nochmal sehr viel mehr ängstigen und erschüttern, dass dieser Outlaw eine Pistole unter der Kutte trug. Und vor allem sollte sie diesen winzigen Teil von sich, der, der dem alten Freund noch vertraute, endlich zum Schweigen bringen!