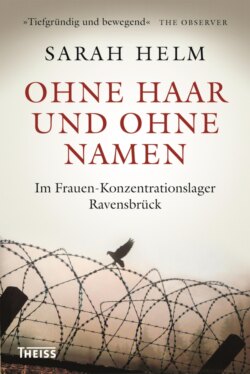Читать книгу Ohne Haar und ohne Namen - Sarah Helm - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
|XI|Prolog
ОглавлениеVom Berliner Flughafen Tegel braucht man kaum mehr als eine Stunde bis nach Ravensbrück. Als ich im Februar 2006 zum ersten Mal dorthin fuhr, schneite es heftig und ein Lastwagengespann hatte sich auf dem Berliner Ring quer gestellt, darum dauerte es länger. Heinrich Himmler fuhr oft nach Ravensbrück, selbst bei ähnlich scheußlichem Wetter. Der Reichsführer SS hatte Freunde in der Gegend und inspizierte das Lager auf dem Weg dahin.1 Nur selten fuhr er wieder weg, ohne neue Befehle gegeben zu haben. Einmal ordnete er an, die Suppe für die Gefangenen solle mehr Wurzelgemüse enthalten. Ein anderes Mal sagte er, das Töten gehe nicht schnell genug.
Ravensbrück war das einzige Frauenkonzentrationslager, das die Nationalsozialisten errichteten. Es trägt den Namen des kleinen Dorfs bei der Stadt Fürstenberg und liegt etwa 90 Kilometer nördlich von Berlin, nicht weit von der Autobahn nach Rostock. Frauen, die bei Nacht ankamen, glaubten manchmal, an der Küste zu sein, weil der Wind salzig schmeckte; sie spürten auch Sand unter den Füßen. Bei Tageslicht sahen sie dann, dass das Lager an einem See lag und von Wald umgeben war. Himmler ließ seine Lager gern mitten in der Natur anlegen, den Blicken möglichst entzogen. Noch heute ist das Lager den Blicken entzogen. Die dort verübten Verbrechen und der Mut der Opfer sind vielen unbekannt.
Ravensbrück wurde im Mai 1939 eröffnet, kaum vier Monate vor Kriegsbeginn, und sechs Jahre später von den Russen befreit – es war eines der letzten Lager, das die Alliierten erreichten. Im ersten Jahr gab es dort weniger als 2000 Gefangene, fast alle Deutsche. Viele waren inhaftiert worden, weil sie gegen Hitler waren – etwa Kommunistinnen und Zeuginnen Jehovas, die in Hitler den Antichrist sahen. Andere waren nur deshalb verschleppt worden, weil die Nazis sie als minderwertig ansahen und aus der Gesellschaft entfernen wollten: Prostituierte, Straftäterinnen, Obdachlose und Sinti und Roma. Später befanden sich im Lager Tausende Frauen, die in den von Deutschland besetzten Ländern verhaftet worden waren. Viele gehörten dem Widerstand an. Auch Kinder wurden dorthin gebracht. Ein kleiner Anteil der Gefangenen – etwa zehn Prozent – waren jüdisch, aber das Lager war nicht für Juden geplant worden.
In Ravensbrück waren bis zu 45.000 Frauen gleichzeitig inhaftiert; in den sechs Jahren seines Bestehens durchschritten etwa 130.000 Frauen die Tore. Sie wurden dort geschlagen, ausgehungert, durch Zwangsarbeit getötet |XII|oder vergiftet, hingerichtet oder vergast. Schätzungen über die Gesamtzahl der Toten liegen zwischen 30.000 und 90.000. Die genaue Zahl liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen, aber es sind so wenige SS-Dokumente über das Lager erhalten, dass man es niemals mit Sicherheit wissen wird. Die weitgehende Zerstörung von Beweisen in Ravensbrück ist ein weiterer Grund, warum die Geschichte des Lagers so unbekannt geblieben ist. In den letzten Tagen des Lagers wurden außer den Toten auch alle Gefangenenakten im Krematorium oder auf Scheiterhaufen verbrannt. Die Asche der Toten warf man in den See.
Ich erfuhr zuerst von Ravensbrück, als ich an einem Buch über Vera Atkins schrieb, die im Zweiten Weltkrieg Offizierin des britischen Geheimdienstzweigs Special Operations Executive (SOE) war. Gleich nach dem Krieg begann Vera ganz allein nach englischen Frauen zu suchen, die für die SOE mit dem Fallschirm über dem besetzten Frankreich abgesprungen waren, um die Résistance zu unterstützen; viele von ihnen wurden vermisst. Vera folgte ihren Spuren und entdeckte, dass mehrere in Gefangenschaft geraten und in Konzentrationslager gebracht worden waren.
Ich versuchte ihre Suche zu rekonstruieren und begann mit ihren persönlichen Papieren, die in braunen Pappkartons im Haus ihrer Schwägerin Phoebe Atkins in Cornwall lagerten. Auf einem Karton stand das Wort „Ravensbrück“. Darin waren handschriftliche Notizen zu Befragungen von Überlebenden und SS-Verdächtigen – ein Teil der frühesten Beweismittel über das Lager. Ich blätterte darin. „Wir mussten uns nackt ausziehen und wurden rasiert“, sagte eine Frau zu Vera. Es gab „eine Säule von beißendem blauen Rauch“.
Eine Überlebende sprach vom Lagerkrankenhaus, wo „Syphilisbakterien in die Wirbelsäule injiziert wurden“. Eine andere erinnerte sich an Frauen, die aus Auschwitz, nach einem Todesmarsch durch den Schnee, ins Lager kamen. Ein männlicher SOE-Agent, der in Dachau inhaftiert war, schrieb, er habe von Frauen aus Ravensbrück gehört, die in einem Bordell des KZ Dachau arbeiten mussten.
Mehrere Gesprächspartner erwähnten eine junge Aufseherin namens Binz mit „hellem Bubikopf“. Eine andere Aufseherin war Kindermädchen in Wimbledon gewesen. Laut einem britischen Ermittler war unter den Gefangenen „die Creme der Frauen Europas“ gewesen, so die Nichte von General de Gaulle, eine frühere britische Golfmeisterin und zahlreiche polnische Gräfinnen.
Ich suchte nach Geburtsdaten und Adressen, um herauszufinden, ob es noch lebende Gefangene – oder auch Aufseherinnen – gab. Irgendjemand hatte Vera die Adresse einer Mrs. Chatenay gegeben, „die von der Sterilisierung der Kinder in Block 11 weiß“. Eine Ärztin namens Louise Le Porz |XIII|hatte in ihrer sehr detaillierten Aussage angegeben, das Lager wäre auf einem Landgut gebaut worden, das Himmler gehörte, und sein privates Schloss hätte sich in der Nähe befunden. Ihre Adresse war Mérignac im Département Gironde, aber ihrem Geburtsdatum nach war sie vermutlich tot. Eine Frau aus Guernsey namens Julia Barry wohnte in Nettlebed, Oxfordshire. Andere Adressen waren viel zu ungenau. Von einer russischen Überlebenden hieß es, sie arbeitete vermutlich „auf der Mutter-Kind-Station, Bahnhof Leningrad“.
Ziemlich weit unten im Karton fand ich handgeschriebene Listen von Gefangenen, von einer Polin hinausgeschmuggelt, die im Lager Notizen, Skizzen und Pläne gemacht hatte. „Die Polinnen hatten die besten Informationen“, stand auf einem Zettel. Die Frau, von der die Listen stammten, war schon lange tot, aber einige der Adressen befanden sich in London und die Frauen waren noch am Leben.
Bei meiner ersten Fahrt nach Ravensbrück nahm ich die Skizzen in der Hoffnung mit, mich damit zu orientieren. Als der Schnee aber immer dichter fiel, fragte ich mich, ob ich das Lager überhaupt erreichen würde.
Viele scheiterten, Ravensbrück zu erreichen. Rotkreuzmitarbeiter, die im Chaos der letzten Kriegstage versuchten, dorthin zu kommen, mussten umkehren, so stark war der entgegenkommende Strom der Flüchtlinge. Einige Monate nach Kriegsende fuhr auch Vera Atkins hin, um ihre Untersuchung zu beginnen, wurde aber an einem sowjetischen Kontrollpunkt gestoppt. Das Lager befand sich in der Sowjetischen Besatzungszone und der Zugang für Alliierte anderer Nationalität war beschränkt. Inzwischen war Veras Suche nach den vermissten Frauen Teil einer größeren britischen Untersuchung über das Lager geworden. Sie führte zu den ersten Ravensbrück-Prozessen, die ab 1946 in Hamburg stattfanden.
In den 1950er Jahren, als der Kalte Krieg begonnen hatte, lag Ravensbrück hinter dem Eisernen Vorhang, der die Überlebenden in Ost und West trennte und die Geschichte des Lagers spaltete.
Im Osten wurde das Lager zu einer Kultstätte für die kommunistischen Heldinnen und in der ganzen DDR benannte man Straßen und Schulen nach ihnen.
Im Westen entschwand Ravensbrück buchstäblich dem Blick. Westliche Überlebende, Historiker und Journalisten kamen nicht einmal mehr in die Nähe des Ortes. Die ehemaligen Gefangenen hatten Mühe, ihre Geschichten in ihren Heimatländern zu veröffentlichen. Beweismittel waren schwer zugänglich. Die Protokolle der Hamburger Prozesse wurden als „geheim“ eingestuft und blieben 30 Jahre lang gesperrt.
„Wo lag es?“ war eine der häufigsten Fragen, die man mir stellte, als ich über Ravensbrück zu schreiben begann, oder: „Warum gab es ein besonde |XIV|res Frauenlager? Waren die Frauen jüdisch? War es ein Todeslager? War es ein Arbeitslager? Ist noch jemand am Leben?“
In den Ländern, aus denen viele Opfer des Lagers stammten, versuchten Gruppen von Überlebenden, die Erinnerung wachzuhalten. Schätzungsweise 8000 Französinnen, 1000 Niederländerinnen, 20.000 Sowjetbürgerinnen und 36.000 Polinnen waren inhaftiert. Doch die Geschichte blieb im Dunkel, in jedem Land aus anderen Gründen.
In England, woher nur 20 Gefangene kamen, ist das Unwissen ebenso erstaunlich wie in den USA. Engländer haben vielleicht vom ersten Konzentrationslager Dachau gehört und vielleicht von Bergen-Belsen, weil es von britischen Truppen befreit wurde und der Schrecken, den sie dort vorfanden und filmten, im englischen Bewusstsein auf ewig Narben hinterließ. Ansonsten weckt nur Auschwitz, als Synonym für die Vergasung der Juden, echten Widerhall.
Nachdem ich Veras Unterlagen gelesen hatte, informierte ich mich, was über das Frauenlager geschrieben worden war. Mainstreamhistoriker – fast immer Männer – sagten fast nichts dazu. Sogar Bücher, die nach dem Ende des Kalten Kriegs über die Lager geschrieben worden waren, schienen eine ausschließlich männliche Welt zu beschreiben. Dann lieh eine Freundin, die in Berlin arbeitete, mir eine dicke Aufsatzsammlung, verfasst von zumeist deutschen Forscherinnen. In den 1990er Jahren hatten feministische Historikerinnen eine eigene Sichtweise entwickelt. Dieses Buch versprach, Frauen aus der Anonymität zu entlassen, die in dem Begriff „Häftling“ liegt. Zahlreiche weitere Studien zumeist von Deutschen folgten, die Teilaspekte von Ravensbrück „wissenschaftlich“ untersuchten, was die Geschichte zu ersticken schien. Auch ein „Gedenkbuch“ wurde erwähnt, was sehr viel interessanter klang, und ich versuchte mit der Autorin in Kontakt zu treten.
Ich war auch auf eine Handvoll Memoiren von Gefangenen gestoßen, hauptsächlich aus den 1950er und 1960er Jahren, die auf den hinteren Regalen von öffentlichen Bibliotheken standen und oft sensationslüsterne Umschläge hatten. Der Umschlag der Memoiren von Micheline Maurel, einer französischen Literaturlehrerin, zeigte ein üppiges Quasi-„Bond-Girl“ hinter Stacheldraht. Ein Buch über Irma Grese, eine der Aufseherinnen in Ravensbrück, trug den Titel The Beautiful Beast. Die Sprache darin wirkte altmodisch und zunächst unwirklich. Da war die Rede von „Lesbierinnen mit gefühllosen Gesichtern“ oder von der „Rohheit“ deutscher Gefangener, die „zu Gedanken über die üblen Eigenschaften dieser Rasse anregte“. Diese Texte waren verwirrend; anscheinend wusste niemand, wie die Geschichte zu erzählen wäre. Im Vorwort zu einem dieser Bücher schrieb der französische Schriftsteller François Mauriac, Ravensbrück wäre „ein Gräuel, |XV|das die Welt zu vergessen entschlossen ist“. Vielleicht sollte ich über etwas anderes schreiben. Ich besuchte Yvonne Baseden, die einzige Überlebende, die ich damals kannte, um ihre Meinung zu hören.
Yvonne war eine von Vera Atkins‘ SOE-Agentinnen gewesen, die bei der Hilfe für die Résistance in Frankreich gefangen genommen und nach Ravensbrück verschleppt worden war. Yvonne hatte stets bereitwillig über ihre Arbeit im Widerstand gesprochen, aber immer, wenn ich Ravensbrück ansprach, hatte sie gesagt, sie „wisse nichts“, und das Thema gewechselt.
Dieses Mal sagte ich ihr, ich wolle ein Buch über das Lager schreiben und hoffte, sie könnte mir mehr erzählen, aber sie schaute erschrocken auf.
„Oh nein“, sagte sie, „das können Sie nicht tun.“
Ich fragte, warum. „Es ist zu schrecklich, können Sie nicht über etwas anderes schreiben? Was wollen Sie Ihren Kindern über Ihre Arbeit erzählen?“
Ob sie nicht meinte, die Geschichte sollte erzählt werden? „Oh doch. Niemand weiß etwas von Ravensbrück. Niemand wollte jemals etwas wissen, seit dem Augenblick, als wir zurückgekommen sind.“ Sie blickte aus dem Fenster.
Als ich ging, gab sie mir ein kleines Buch. Es waren erneut Memoiren, mit einem besonders schrecklichen Umschlagbild aus verrenkten Gestalten in schwarz-weiß. Yvonne sagte, sie hätte es nicht gelesen, und schob es zu mir. Es war, als wolle sie es loswerden.
Als ich zu Hause war, fiel der finstere Umschlag herunter und enthüllte ein schlichtes blaues Buch. Ich las es in einem Stück. Es stammte von der jungen französischen Anwältin Denise Dufournier und war ein einfacher und bewegender Bericht vom Aushalten unter schlimmsten Umständen. Die „Gräuel“ waren nicht der einzige Teil der Geschichte von Ravensbrück, der vergessen zu werden drohte; mit dem Kampf ums Überleben war es ebenso.
Wenige Tage später sprach eine französische Stimme von meinem Anrufbeantworter. Es war Dr. Louise Le Porz (nun Liard), die Ärztin aus Mérignac, die ich für tot gehalten hatte. Nun aber lud sie mich ein, nach Bordeaux zu kommen, wo sie jetzt lebte. Ich könnte so lange bleiben, wie ich wollte, schließlich wäre über so vieles zu reden. „Aber Sie sollten sich beeilen. Ich bin 93.“
Bald darauf erreichte ich Bärbel Schindler-Saefkow, die Autorin des „Gedenkbuchs“. Bärbel, die Tochter einer deutschen Kommunistin im Lager, erarbeitete eine Datenbank der Gefangenen. Um die noch in den entlegensten Archiven verborgenen Namen aufzunehmen, war sie weit umhergereist. Sie schickte mir die Adresse von Valentina Makarova, einer weißrussischen Partisanin, die den Todesmarsch aus Auschwitz überlebt hatte. Valentina schrieb zurück und schlug vor, ich sollte sie in Minsk besuchen. |XVI|Als ich mich den entfernteren Vororten näherte, ließ der Schnee nach. Ich sah ein Schild nach Sachsenhausen, den Standort des Männerkonzentrationslagers, und wusste, dass ich auf dem richtigen Weg war. Sachsenhausen und Ravensbrück waren eng verbunden. Im Männerlager wurden sogar die Brote für die Frauen gebacken und täglich auf dieser Straße herübergefahren. Zunächst bekam jede Frau abends einen halben Laib Brot. Bei Kriegsende bekamen sie bestenfalls noch eine Scheibe und die „unnützen Esser“, wie die Nazis jene nannten, die sie loswerden wollten, bekamen gar nichts.
SS-Männer, Aufseherinnen und Gefangene wurden häufig zwischen den Lagern hin und her geschoben, weil Himmlers Verwaltungsleute die Ressourcen maximal ausnutzen wollten. Im Krieg wurde bald eine Frauenabteilung in Auschwitz eröffnet – später auch in anderen Männerlagern – und Ravensbrück stellte die Aufseherinnen und bildete sie aus. Später wurden einige SS-Offiziere aus Auschwitz nach Ravensbrück versetzt. Auch Gefangene wurden zwischen den beiden Lagern ausgetauscht. So blieb Ravensbrück als Frauenlager besonders, teilte aber mit den Männerlagern die typischen Eigenschaften eines KZ.
Himmlers SS-Imperium war gewaltig. Während des Kriegs gab es über ganz Deutschland und Polen verstreut rund 15.000 Lager, einschließlich temporärer Arbeitslager und der tausend Außenlager, die mit den großen Konzentrationslagern verbunden waren.2 Die größten und schrecklichsten waren die 1942 für die Endlösung gebauten Lager. Bis Kriegsende waren schätzungsweise sechs Millionen Juden ermordet worden. Die Fakten des Völkermords an den Juden sind heute so bekannt und sie sind so überwältigend, dass viele meinen, Hitlers Vernichtungsprogramm habe sich allein gegen die Juden gerichtet.
Menschen, die nach Ravensbrück fragen, sind häufig überrascht, dass die meisten dort ermordeten Frauen keine Jüdinnen waren.
Heutzutage differenzieren Historiker zwischen den Lagern, aber Etiketten können täuschen. Ravensbrück wird oft als „Sklavenarbeitslager“ bezeichnet, was den Schrecken des Geschehenen reduziert und vielleicht auch zu seiner Marginalisierung beigetragen hat. Gewiss war es ein wichtiger Ort der Sklavenarbeit – Siemens, der Elektrogigant, hatte dort eine Fabrik –, aber die Sklavenarbeit war nur eine Station auf dem Weg in den Tod. Die damaligen Gefangenen nannten Ravensbrück ein Todeslager. Die französische Überlebende und Ethnologin Germaine Tillion nannte es einen Ort der „langsamen Menschenvernichtung“.3
Auf der Fahrt nach Norden verlief die Straße zwischen weißen Feldern und dann zwischen Bäumen. Ab und zu kam ich an aufgegebenen LPGs vorbei, Überbleibseln aus sozialistischen Zeiten.
|XVII|Im Wald hatte es Schneeverwehungen gegeben und der Weg war schwer zu finden. Frauen aus Ravensbrück wurden oft in die verschneiten Wälder geschickt, um Bäume zu fällen. Der Schnee haftete an ihren Holzschuhen, sodass sie auf Schneepolstern liefern, wobei ihre Fersen beim Gehen hin- und herrutschten. Aufseherinnen führten Schäferhunde an der Leine, die sich auf die Frauen stürzten, wenn sie hinfielen.
Die Namen der Dörfer im Wald kamen mir aus den Memoiren vertraut vor. Altglobsow war das Dorf, aus dem die Aufseherin mit dem blonden Haar – Dorothea Binz – stammte. Dann wurde der Kirchturm von Fürstenberg sichtbar. Von der Ortsmitte aus war das Lager unsichtbar, aber ich wusste, dass es gleich auf der anderen Seite des Sees lag. Gefangene erwähnten, dass sie den Kirchturm sahen, wenn sie aus dem Tor des Lagers traten. Ich fuhr am Bahnhof Fürstenberg vorbei, wo so viele schreckliche Zugreisen geendet hatten. In einer Februarnacht kamen hier Soldatinnen der Roten Armee von der Krim an, eingepfercht in Viehwaggons.
Auf der anderen Seite von Fürstenberg führte eine von den Gefangenen gebaute Kopfsteinstraße durch den Wald zum Lager. Zur Linken tauchten spitzgieblige Häuser auf; aus Veras Plan wusste ich, dass es die Häuser der Aufseherinnen waren. Eines war zu einer Jugendherberge umgebaut, in der ich übernachten wollte. Das alte Dekor war schon vor langer Zeit entfernt und durch eine schlichte moderne Ausstattung ersetzt worden, aber die früheren Bewohner schienen ihre alten Zimmer immer noch heimzusuchen.
Zu meiner Rechten öffnete sich der See, groß und weiß gefroren. Vor mir lagen die Kommandantur und eine hohe Mauer. Wenige Minuten später stand ich am Eingang zum Lager. Eine weitere große weiße Fläche war von Bäumen gesäumt, Linden, wie ich später erfuhr, die beim Bau des Lagers gepflanzt wurden. Alle Baracken unter den Bäumen waren verschwunden. Während des Kalten Kriegs hatten die Russen das Lager als Stützpunkt eines Panzerregiments benutzt und die meisten Gebäude abgerissen. Russische Soldaten spielten Fußball auf dem ehemaligen Appellplatz, wo einst die Gefangenen zum Durchzählen antraten. Ich hatte vom sowjetischen Stützpunkt gehört, aber nicht dieses Ausmaß an Zerstörung erwartet.
Das Siemens-Lager, wenige Hundert Meter von der Südmauer entfernt, war überwachsen und schwer zu erreichen, ebenso das „Jugendschutzlager“, wo so viele Morde stattgefunden hatten. Ich würde mir vorstellen müssen, wie es dort aussah, aber die Kälte brauchte ich mir nicht vorzustellen. Hier auf dem Appellplatz mussten die Gefangenen stundenlang in ihren Baumwollkleidern stehen. Ich suchte Zuflucht im Zellenbau, dessen Zellen während des Kalten Kriegs als Gedenkorte für vornehmlich kommunistische |XVIII|Opfer gedient hatten. Namenlisten waren in glänzenden schwarzen Granit eingraviert.
In einem Raum nahmen Handwerker gerade die Gedenkplatten ab und bauten um. In der Nachwendezeit arbeiteten Historiker und Archivare an einem neuen Narrativ und einer neuen Gedenkausstellung.
Außerhalb der Lagermauern fand ich andere, intimere Gedenkorte. Nahe dem Krematorium lag zwischen hohen Mauern ein langer dunkler Gang, bekannt als der Erschießungsgang. Hier lag ein Bund Rosen; der Frost hatte verhindert, dass sie verwelkten. Ein Schildchen trug einen Namen.
Drei kleine Blumensträuße lagen im Krematorium auf den Öfen und ein paar Rosen waren am Seeufer verstreut. Seit das Lager wieder zugänglich war, kamen ehemalige Gefangene, um ihrer toten Freundinnen zu gedenken. Ich musste noch mehr Überlebende finden, solange es möglich war.
Nun verstand ich, was dieses Buch sein sollte: eine Biografie von Ravensbrück, vom Anfang bis zum Ende, die die Bruchstücke der Geschichte so gut zusammensetzte, wie es mir möglich war. Das Buch sollte versuchen, Licht auf die Verbrechen der Nazis gegen Frauen zu werfen, und zugleich zeigen, wie ein Begreifen des Geschehens im Frauenlager die ganze Nazigeschichte aufklären kann.
Viel von den Beweismitteln ist zerstört, viel vergessen und verfälscht worden, doch vieles ist auch erhalten und ständig werden neue Dokumente zugänglich. Die britischen Prozessakten waren seit Langem geöffnet und enthielten eine Fülle an Details. Akten von Prozessen hinter dem Eisernen Vorhang wurden ebenfalls zugänglich. Nach dem Ende des Kalten Kriegs waren sowjetische Archive teilweise geöffnet worden und Zeugenaussagen, die man nie beachtet hatte, kamen in verschiedenen europäischen Hauptstädten ans Licht. Überlebende aus Ost und West teilten ihre Erinnerungen mit. Kinder von Gefangenen stellten Fragen, fanden versteckte Briefe und versteckte Tagebücher.
Am wichtigsten für dieses Buch sollten die Stimmen der Gefangenen selbst werden, sie wurden mein Leitfaden für das, was wirklich geschah. Als ich wenige Monate später im Frühling zur alljährlichen Gedenkveranstaltung für die Befreiung zurückkehrte, traf ich Valentina Makarova, die Überlebende des Todesmarschs aus Auschwitz, die mir aus Minsk geschrieben hatte. Sie hatte blauweißes Haar und ein scharf geschnittenes Gesicht. Auf meine Frage, wie sie überlebt habe, sagte sie: „Weil wir an den Sieg glaubten“, als verstehe sich das von selbst.
Als ich vor dem Erschießungsgang stand, brach kurz die Sonne durch. Waldtauben gurrten im Wipfel der Linden und konkurrierten mit dem Geräusch vorbeifahrender Autos. Ein Bus mit französischen Schülern war gekommen und sie standen herum und rauchten.
|XIX|Ich blickte über den See zum Fürstenberger Kirchturm. In der Ferne wurde auf einer Bootswerft gearbeitet; Urlauber mieten die Boote im Sommer, ohne etwas von der Asche zu wissen, die auf dem Grund des Sees ruht. Der Wind trieb eine rote Rose über das Eis.