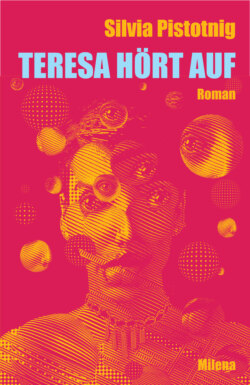Читать книгу Teresa hört auf - Silvia Pistotnig - Страница 10
XX
ОглавлениеAuf dem Weg zur Arbeit sehe ich mir die Menschen an. Sehe ich dem rotgesichtigen Mann oder dem pickeligen Mädchen ähnlich? Kalt, hat Christian gesagt, du bist kalt, das macht dich heiß, aber hübsch, nein, das bist du nicht. Hübsch oder hässlich, das sind Kategorien, die für dich nicht existieren.
Es ist Freitag. Um 14 Uhr leert sich das Büro, um 18 Uhr sind Christian und ich die einzigen Übriggebliebenen. Noch ein Monat bis zum ersten Abflug, bis dahin muss alles klappen, fixiert sein, vom richtigen Essen an Bord bis zur Security.
»Okay, ich mach Schluss für heute.« Christian dreht das Licht in seinem Büro ab. »Was hast du noch vor?«, will er wissen. Smalltalk, warum müssen Leute immer reden? »Nichts Besonderes.« Er nickt. »Also dann bis Montag, mach nicht zu lang, ciao!«
Dann ist er weg. Dann ist es still. Dann bin ich allein. Nur das Surren der Lampen, des Computers, des Kopierers. Die Zeit hält sich selbst an. Das sind schöne Momente. Ich kann sie nicht ausnützen. Das liegt an den Öffnungszeiten. Ich reiße mich los und muss mich beeilen. Wegen der Öffnungszeiten habe ich sogar überlegt auszuwandern, in eines dieser Schlaraffenländer mit durchgehend geöffneten Shops. Doch das Geld, die Wohnung, die Anstrengung, und es geht doch nur um drei Monate.
Ich fahre nachhause, eile in den Billa, das Geschäft, das meinem Palast am nächsten ist. Die Regale sind ausgeräumt, das Gedränge ist groß, Freitagabend: die Hölle des Einkaufens. Ich habe bereits überlegt, online zu bestellen, doch es ist nicht dasselbe. Die Dinge auf dem Bildschirm sind nicht kalt wie die Milch aus dem Kühlregal und riechen nicht nach Fett und Salz wie die Billigchips, deren Geruch ich trotz Verpackung wahrnehmen kann.
Ich schlängle meinen Wagen durch den Einkaufswahnsinn und da, da steht sie, rund und klein mit ihrem Pagenkopf. Sie hat mir den Rücken zugewandt, und ich bleibe stehen. Ihre Würstelfinger greifen hinauf in die luftigen Höhen unerreichbarer Regale, sie steht auf ihren Zehenspitzen, um den Schokopudding zu erwischen, mit den Fingerspitzen greift sie danach, mit letzter Kraft erreicht sie ihn, wie eine Trophäe hält sie ihn über ihren Kopf. Hurra! Gewonnen!
Ich will nicht, dass sie mich sieht, doch es ist mir unmöglich, mich zu bewegen, wegzulaufen, mich aus dem Staub zu machen. Sie entdeckt mich nicht, setzt ihren Weg fort, den Wagen hochaufgeladen und vollbepackt, ein buntes Durcheinander an Produkten. Ich brauche nicht weiterzudenken, es ist ganz klar, was hier Sache ist.
Sie quetscht sich durch die Gänge, und ich fühle das seltsame Bedürfnis, ihr nachzugehen, zu spionieren, aus dem Geschäft hinaus, die Straßen entlang zu ihrem Daheim, Tür auf, hineingehen und – und was?
Von hinten wippt ihr Haar hin und her, kerzengerade und schwarz gefärbt, die scharfen Kanten der Frisur sind das einzig Eckige an diesem runden Wesen. Sie geht an den Produkten vorbei, gleich ist die Reihe zu Ende und sie muss um die Sonderangebote eine Drehung machen, um auf der nächsten Seite wieder hinaufzuwandern, vorbei an Reis, Nudeln, Sugosaucen, eingelegten Antipasti, Oliven; ich kann jede Reihe aufzählen, genau vorhersagen, wo sie was herausholen und woran sie vorbeigehen wird.
»Entschuldigung.« Ein Mann mit Vollbart will an mir vorbei. Ich erschrecke, mein ganzer Körper scheint zu zucken, und ich setze mich abrupt in Bewegung, folge ihr, werde schneller, biege um die Kurve. Die Reihe ist leer.
Die Kassen sind von hier aus noch nicht zu sehen. Ich gehe geradeaus, biege noch einmal um die Kurve, auch in der nächsten Reihe ist sie nicht zu finden. Es ist mir zu riskant, ihr bis zur Kasse zu folgen. Riskant? Warum?
Ich sehe in meinen Wagen. Er ist noch nicht einmal zur Hälfte gefüllt, ich habe noch viel vor mir. Wieso bringt mich ein Luftballon durcheinander?
Absichtlich langsam gehe ich zum Zucker zurück. In Zeitlupe fülle ich den Wagen, lese Produktbeschreibungen und Inhaltsstoffe, Kalorienangaben und Haltbarkeitsdaten, denn ich will mich nicht durcheinanderbringen lassen in meiner dreimonatigen Routine.
Ich bin eine der letzten Kundinnen, vor mir steht ein Wagen, in dem ein Kleinkind sitzt. Es ist blass und hat blutige Pickel, Wimmerl, hat meine Mutter das genannt, warum sagt man jetzt anders? In dem länglichen Gesicht ruhen zwei Knopfaugen auf mir. Ich drehe mich weg, starre auf die Kaugummis, Mini-Wodkaflaschen und Schokosnacks neben der Kasse. Trotzdem spüre ich den bohrenden Blick. Vor Kindern habe ich Angst. Ich glaube, sie sind die Einzigen, die mich wirklich erkennen, mich als Ganzes sehen. Ein Kind wäre mein finales Projekt, die letzte verbleibende Möglichkeit.
Am nächsten Tag, einem Samstag, wache ich um 14 Uhr auf. Wegen der Arbeit sind mir die Wochentage und das genaue Datum bewusst. Mit bloßen Füßen trete ich langsam und träge von meinem Bett aus auf die Terrasse, die heiße Luft trägt den Gestank der Stadt zu mir. Mich ekelt und gleichzeitig bin ich süchtig danach, wie grausige Bilder, von denen man sich nicht abwenden kann.
Mir träumte von ihr, sie hat mich angesehen, und ich war ein Kind. »Ach du«, sagte sie. An mehr kann ich mich nicht erinnern, der Traum hat meinen Kopf schwer gemacht.
Ich kehre langsam gedanklich in meine Gemächer zurück, schreite ins Bad, das Fenster ist weit geöffnet. Dennoch hat sich der Geruch nach Erbrochenem nicht verflüchtigt, mir wird kurz übel, doch ich fange mich und setze mich auf die Toilette.
Während ich pinkle, gehe ich mein Projekt durch, memoriere den Zeitplan. Langsam geht mir das Geld aus. Ich muss Christian um eine Gehaltserhöhung bitten. Ich will aber nicht bitten. Wie auch immer.
Ich verlasse das Badezimmer und gehe die Stiegen hinunter. Bevor ich mich vor den Spiegel stelle, trinke ich einen schwarzen Kaffee, erst am Abend werde ich mich dem Fressen widmen.
Ich zeichne lange und konzentriert. Als ich aufhöre, hat sich die Sonne schon weiter Richtung Westen bewegt. Meine Blätter liegen auf dem Boden, ein Meer aus Bildern, auf dem meine Füße Schmutzspuren hinterlassen, sie trampeln auf Oberschenkeln, Brüsten, auf Bauch und Armen, Fingernägeln, Hautschuppen, Altersflecken, Muttermalen herum. Mein Körperpuzzle.
Ich verlasse das Wohnzimmer und hole das Handy aus der Tasche, um mein Konto zu kontrollieren. Mein Projekt verschlingt Unmengen, doch das ist nur fair, ich tue dasselbe.
Die Buchhaltung hat noch immer kein Gehalt überwiesen. Einen Monat habe ich noch vor mir. Jeden Cent werde ich in Lebensmittel stecken. Bulimie passt wie ein perfektes Outfit zu mir, es ist eines meiner Lieblingsprojekte. Ich bin immer hungrig und finde mich zum Kotzen, ist das nicht lustig? Ich habe ein richtiges Loch im Bauch, aber satt werde ich nie.
Wobei Bulimie schon ein langweilig-abgestaubtes Image hat, quasi der Oldtimer unter den Essstörungen. Katzenfutter essen aus lauter Fresswut? Gähn! Ein bisschen eklig, aber sonst nur noch öde. Wer hip ist, isst anders, raw, vegan, kein Gluten, laktosefrei, Low Carb, nur Eiweiß, und nicht mehr auf Urlaub fahren, weil der Ernährungsplan in Peru, Kalifornien, Südafrika oder weiß der Kuckuck wo der Trip hingehen sollte, nicht funktioniert. Das sind Essstörungen aus billigen Weibermagazinen, die noch nicht mal als solche gelten. Ich halte es lieber klassisch: fressen, fressen, fressen, raus damit.
Worauf warte ich dann noch?
Eine Stunde später lecke ich warme Nussnougatcreme vom kühlen Marmorfußboden. Ich lecke ihrer feinen Spur hinterher, kein noch so dünner Faden entgeht meiner Zunge, von einer Fliese über die nächste breitet sie sich aus, doch ich bin schnell, mein Mund berührt den Boden, und so sauge ich, sauge ich auf, noch schneller, noch mehr, ich warte nicht mehr auf das Schmelzen, wozu schmelzen, wozu warten, in meinen Mund, hinunter, schneller, mehr, in mich, in mir, noch, bitte, bitte, nicht vorbei, noch eine kleine Nougatmenge, noch eine, in den Mund, schnell hinunter, aus.
Das Erbrechen funktioniert einwandfrei, ich mache es am liebsten gleich danach, da ist alles noch schön locker und kann schwuppdiwupp wieder oben raus. Ich habe heute noch einiges vor, die Nougatcreme war erst die Vorspeise, die meine Orgie einleitete.
Die Klotür steht weit offen, während ich die Hälfte meiner Vorräte aufesse. Für morgen brauche ich eine weitere Ration. Um 2 Uhr früh lege ich mich ins Bett.
Ich träume wieder von dem Ballon, sie hat die stierenden Augen des Kindes und liegt auf dem Förderband der Ladenkasse. »Ach du«, sagt sie.