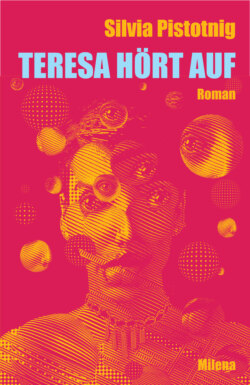Читать книгу Teresa hört auf - Silvia Pistotnig - Страница 8
XX
ОглавлениеIch brauche lang. Stück für Stück räume ich die Schokopackungen in den Wagen, nehme eine Banane nach der anderen, lasse mich von gestressten Schnelleinkäuferinnen und rücksichtslosen Pensionisten nicht stören. Nach einer Dreiviertelstunde bin ich fertig, ein Geduldsakt.
»Sie«, sagt plötzlich jemand hinter mir. Ich reagiere nicht. »Sie!«, sagt die Frauenstimme hinter mir noch einmal und tippt mir auf den Rücken. Was will diese nervige Person? Aber ich habe keinen Ausweg, vor mir ist die Kassenschlange, flüchten geht nicht. Ich drehe mich um.
»Sie haben etwas vergessen«, sagt die Frau und hält mir einen Becher Schlagobers hin.
Sie ist ein Ballon, ja, ein Ballon! Von ihrem runden Kopf führt ein dicker Hals zu einem aufgeblasenen Körper, aus dem fleischige Arme ragen, einer davon ist mir entgegengereckt. In der Hand hält sie den Becher Schlagobers, an den sich ihre Finger wie Würstchen klammern. »Sie haben etwas vergessen«, sagt sie noch einmal, ihr schwarzer Pagenkopf wippt. In ihrer Stimme liegt so viel Überzeugung, dass ich das Schlagobers wortlos entgegennehme und feststelle, dass sie recht hat. Ich wollte es einpacken, nur hat mich das nächste Regal abgelenkt, woher weiß sie das? Sie lächelt.
»Bis zum nächsten Mal«, meint sie, nickt und lenkt ihren Einkaufswagen an mir vorbei.
Ich bleibe vor dem Regal stehen, um ihr nicht noch einmal zu begegnen, und verfolge sie mit den Augen. Sie steht an der Kasse, alle anderen überragen sie, doch seitlich sticht ihr fülliger Körper heraus.
Vollbeladen trippelt sie erstaunlich geschickt aus dem Geschäft, ihre Füße sind bestimmt kaputt, Tag für Tag müssen sie dieses Gewicht tragen, wahrscheinlich hat sie Diabetes und verfettete Organe. Sie könnte dreißig, vierzig oder fünfzig, vielleicht sogar sechzig sein, ihr Körper lässt alle Möglichkeiten zu. Ich quetsche mich an den Leuten vorbei, drängle mich durch, lege die Waren auf das Band und schleppe genauso viele Taschen und Säcke wie der Ballon zuvor.
In meinem Palast werfe ich die Kleidung von mir, setze mich in die Mitte des Wohnzimmers. und beginne ein Mahl, bei dem Zeit keine Rolle mehr spielt.
Wieder ist es Mutters Sirene, die mich aus meiner Trance reißt, in der Hektik habe ich vergessen, mein Handy auszuschalten. Einmal pro Woche muss sie mich erreichen, das ist unsere Vereinbarung, die ich einhalten muss, um nicht wieder zu riskieren, dass sie plötzlich in der Wohnung steht, die »noch immer deinem Vater und mir gehört«.
Ich nehme ab. »Ja?« Draußen läuten die Kirchenglocken, es ist elf Uhr abends.
»Ich mache mir Sorgen, warum hebst du nicht ab?«
Warum tust du mir das an?, möchte sie fragen, aber das tut sie nicht. Ich lächle und schüttle den Kopf. »Ich habe viel zu arbeiten«, erkläre ich. Dann spricht sie eine Zeit lang nichts, und ich, ich habe ihr sowieso nie etwas zu erzählen.
»Und wie viele sind es diesmal?«, fragt sie.
»Was?«
»Teilnehmer. Wie viele sind heuer dabei?«
»Viertausend.«
»Unglaublich, dass das so viele anzieht. Aber gut, wichtig ist, dass nichts passiert.« Ich gähne. Mutter ist ermüdend. »Gestern haben wir im Radio gehört, dass in Schulen nicht mehr so aggressiv geworben werden darf, hast du das mitbekommen?«
»Ich höre keine Nachrichten.« Sie interessieren mich nicht, genauso wenig wie Mutter. Sie hasst mich nicht, sie verachtet mich nur. Aber das ist in Ordnung, das tue ich auch.
»Finde ich gut«, sagt sie, und ich habe das Gesprächsthema schon lang vergessen. »Musst du diesmal mitfahren?«
»Ich weiß es nicht.«
»Dass du das aushältst. Dieser Wirbel. Tausende besoffene Maturierende, es ist schon irgendwie traurig.« Ich sage nichts. »Was fühlst du eigentlich, wenn du daran denkst?«, will sie wissen, und ich lege auf. Rund viertausend junge Menschen werden drei Wochen lang feiern und dafür sorgen, dass Geld auf mein Konto kommt. Was soll ich dabei schon fühlen?
Sie ruft mich noch einige Male an, das weiß ich, obwohl ich es nicht mehr mitbekomme, ich schalte das Handy aus. Auf dem Boden liegen die Überreste meiner Schlacht. Ich werde alles zusammenkehren, in einen Müllsack stecken, und mit einer Küchenrolle die letzten Reste entfernen.
Vor dem Spiegel untersuche ich die Stelle ein paar Zentimeter über dem Knie, dann die Hinterseite des rechten Oberschenkels. Schon lang möchte ich mir einen zweiten Spiegel kaufen, in der exakt gleichen Größe und Ausführung, und ihn gegenüber aufstellen, um mich leichter von hinten betrachten zu können. Per Mausklick kaufen und liefern lassen, von einem Serben oder Pakistani, der den Spiegel auf dem Rücken zu mir hochschleppt. Ich will aber keine Arbeiter hier herinnen, niemand soll zu meinem Palast Zugang haben, niemand soll ihn betreten, vor allem nicht meine Mutter. Ich werde das Schloss austauschen, das Schloss der Königin. Es wird nichts nützen. Ich werde warten müssen, bis sie tot sind, Mutter und Vater, erst dann wird die Wohnung mir gehören, ganz und ausschließlich. Es ist unwahrscheinlich, dass das bald passieren wird. Meine Mutter bewegt sich viel und ernährt sich gesund, mein Vater bewegt sich nicht und ernährt sich ungesund. Doch auch er ist eine Maschine, und die stirbt nicht, sie geht nur kaputt, bis sie irgendwann irreparabel ist. Wie ich. Oder ich werde vor ihnen kaputtgehen. Bis dahin verfolge ich einen Weg. Exakt, klar und detailliert, kompromisslos, zielgerichtet und konsequent.
Ich ziehe an einem kleinen Stück Haut des Oberschenkels; sie ist weiß, selten dringen Sonnenstrahlen ein, dieses Projekt ist lang vorbei. Kaum ein Unterschied ist zu erkennen, die Struktur, die Dehnbarkeit. Ich hole die Staffelei neben dem Spiegel hervor, spanne ein leeres Blatt darauf, nehme den Bleistift. Exakt, klar und detailliert sind meine Linien, Punkte, Striche, Schattierungen, nichts lassen sie aus, keine Pore, kein Härchen und keine Hautirritation. Kompromisslos, zielgerichtet und konsequent.
Ein weiteres Abbild meines Körpers, das ihn in seiner Verwundbarkeit, Stärke, Hässlichkeit, Schönheit darstellt, alles vereint in der Zeichnung eines Teils meines Oberschenkels. Meine Mutter fragt immer, warum ich nicht Künstlerin geworden bin.
Ich mache keine Kunst. Ich habe kein Talent, ich bin unkreativ und kann nur Kopien der Wirklichkeit erstellen. Die Wirklichkeit: Das bin ich.
Immer wieder ist es ein anderer Teil meines Körpers; bis ich ihn erkundet habe, dauert es Wochen, Monate, was weiß ich, es gibt viele Details von den Zehen bis zum Kopf. Sehe ich alt aus? Bin ich dick? Ich weiß es nicht.
Ich schminke mich nicht, und meine Haare lasse ich mir einmal im Monat schneiden. Neben der Agentur ist eine Friseurin, sie färbt die Haare älterer Damen, die dann mit lila oder rosa Schimmer aus dem Salon wandern. »Schneiden«, sage ich ihr, sonst nichts, »einfach schneiden.« Jedes Mal fragt sie: »Wie darf ich schneiden?«, und jedes Mal antworte ich: »Wie Sie wollen.« Am Schluss will sie immer wissen, ob es so passt, und ich sage Ja, ohne mich zu sehen.
Ein Haar, die Pupille meines Auges, der obere Mundwinkel, eine Augenfalte, Hautporen. Details, die kein Gesamtbild ergeben, kein Ganzes, keine Identität, kein Individuum. Das bin ich. Die Wirklichkeit. Ich stimme nicht überein. Ich habe mich vermessen, mich fotografiert und gefilmt, mich vor jeden erdenklichen Spiegel gestellt und mich trotzdem nicht erkannt. So reihe ich weiterhin meine Bilder aneinander.
Vielleicht ist das Ganze ja leicht zu erklären, und ich habe eine eingeschränkte Sehfähigkeit, kombiniert mit einem genetisch determinierten Borderline-Syndrom und einer Vermessenheits-verzerrung, dazu autoaggressives Verhalten und Depersonalisation. Klingt aufregend, nicht? Ich bin völlig irre, gaga im Schädel, nicht ganz frisch in der Birne. Das ist die Wahrheit, dafür braucht es keine Erklärung.
Für die Zeichnung brauche ich eine Stunde. Ich lege das Bild zu den anderen, horte sie in einem eigenen großen Schrank, der Stapel reicht bis zu meinem Brustbein. Das da drinnen in dem Kasten, das bin ich.