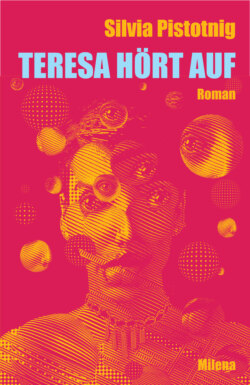Читать книгу Teresa hört auf - Silvia Pistotnig - Страница 14
XX
ОглавлениеSie fragt mich nach meinem Namen, und ich sage, sie kann mir jeden geben, der ihr einfällt. »Was für ein schönes Spiel«, sagt sie. »Kerstin, heute sind Sie Kerstin.«
Am Dienstag bin ich Alia und am Mittwoch Erna. Wir sprechen wenig, nur das Wichtigste: Bitte, die Butter, oder: Wo ist das WC. Ich versuche ihre Ängste aus ihrem Gesicht abzulesen, doch sie bleiben mir verborgen.
Es ist Donnerstag, und ich heiße Petrova. Noch immer liegt die Hitze über der Stadt, doch nach unserem Gelage kommt Wind auf. Er trägt die Verpackung eines als gesund deklarierten Müsliriegels über die Terrasse hinaus zu den Nachbardächern, irgendwann ist sie nicht mehr zu sehen. Nicole, dieser Luftballon, ist in helle, weite Kleidung gehüllt, mit einem schwarz gefärbten Helm auf dem Kopf, und ich brenne darauf, mehr über sie zu erfahren.
»Ich habe immer von so einer Terrasse geträumt«, sagt sie, »wo die Welt unter einem liegt, und man sich fühlt wie eine Königin.« Sie quält sich vom Stuhl hoch und streckt sich. Die Arme hebt sie so hoch sie kann, die Wurstfinger rollen sich aus. »Hier bin ich fast groß!« Ich muss lachen, sie sieht so lächerlich und gleichzeitig bezaubernd aus, die Königin der Luftballone.
Nicole setzt sich wieder und hält sich an der Lehne des Stuhls fest. »Als Kind war ich dünn«, sagt sie, »nur klein war ich schon immer. Als ich auf die Welt gekommen bin, war mein Vater schon weg. Gesehen habe ich ihn trotzdem fast jeden Tag. Er hat im Ort ein paar Häuser weiter mit seiner neuen Frau gewohnt. Aber wir haben keinen Kontakt gehabt. Seine Frau war Lehrerin an meiner Schule. Einmal hat mich die Nachbarin gefragt, ob es mich traurig macht, dass der Papa weg ist. Ich wusste nicht, was sie meinte, für uns war das einfach so. Also habe ich gesagt, es sei mir egal. Seitdem hat die Frau mich nur noch gegrüßt und nicht mehr mit mir geredet. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht sollte man traurig sein, wenn es erwartet wird.
Der Ort war nicht groß, rundherum gab es Felder und Wald. Wir haben in einem winzigen Haus gewohnt, direkt an der Hauptstraße, und obwohl das Dorf klein war, war es für einen freien Blick nicht groß genug. Die großen Häuser rundherum nahmen uns die Sicht und das Licht. Als ich klein war, gab es nicht viel Verkehr, mit den Jahren wurde er immer mehr. Aber das war nicht weiter schlimm. Wir waren nur zum Schlafen im Haus. Sonst waren wir immer draußen. Mein älterer Bruder und ich und ein paar Kinder aus dem Dorf. Als Kinder waren wir alle gleich, später ist das anders geworden. Mit der Volksschule hat es angefangen, ab der Hauptschule wollte kein Kind mehr zu uns. Ein Mädchen hat den anderen erzählt, wir würden in einem dunklen, hässlichen Mäuseloch wohnen. Neben all diesen riesigen Bauern- und Einfamilienhäusern war es ja wirklich winzig. Mein Bruder und ich waren immer gern in diesen großen Gebäuden zu Besuch, wo es immer noch eine Tür und noch einen Raum gab. Wir wurden immer seltener eingeladen. Und irgendwann gar nicht mehr.
Ich habe mich geschämt, habe zu stottern begonnen, sogar Jahre später, als die Mäuselochgeschichte schon lang vergessen war.
Als ich zwölf war, hat mein Vater mit seiner neuen Frau ein Kind bekommen. Ab da hat er zu uns wieder Kontakt aufgenommen und uns eingeladen. Er hat gesagt, dass seine Tochter sich über Geschwister freue. Seine Frau war nett zu uns, und das Baby war süß, so klein und unbeholfen. Es hieß Beatrice, und ich dachte die ganze Zeit, dass das ein Name für eine Königin ist.
Seine Frau und er waren sehr freundlich, wir haben uns in seinem Haus wohlgefühlt. Sie hatten einen riesigen Fernseher, das war unglaublich, daheim hatten wir nur einen ganz kleinen, da lief alles schwarzweiß. Einmal die Woche waren wir dort.«
Sie hört auf, ganz plötzlich, der Wind treibt eine weitere Verpackung über die Dächer. Sie sieht sich um und springt vom Stuhl. Ich bin verwirrt, die vielen Wörter, die auf einmal aus ihr herausgesprudelt sind, und die ich noch auffangen muss. Ich will nicht, dass sie geht.
»Es ist schon wieder nach Mitternacht, ich muss gehen, vor dem Haus wartet meine Kutsche.« Nicole lacht, ein kurzes, tiefes Geräusch, nicht das nervige Gekicher, das ich in der Arbeit ständig höre. Sie reicht mir die Hand, ihre verschwitzten, kleinen Würstelfinger umgreifen meine Finger, und ich umschlinge sie, halte sie fest. »Bis morgen, meine Petrova.«
Sie schlüpft in ihre ausgetretenen Sandalen und verlässt mich. Von draußen höre ich die Kirchturmuhr schlagen. Es ist ein Uhr in der Nacht. Ich bin nicht müde. Wie die Tage zuvor stelle ich mich vor den Spiegel. Heute ist ein Teil meines Bauchs dran.
Tags darauf trinke ich schon am Vormittag drei Energy Drinks und vier Espressi. In meinem Magen rumort es, aber Übelkeit und Müdigkeit sind Zustände, die ich nicht zulasse, außer es entspricht dem aktuellen Projekt.
Ich kontrolliere Excel-Listen, vervollständige die Logos der Kooperationspartner auf unserer Website, telefoniere mit dem Hotelmanager in der Türkei und mit einer hysterischen Mutter, die irgendeine Idiotin zu mir umgeleitet hat, und die sich beschwert, dass ihr Sohn die Reise ohne ihr Wissen gebucht habe.
Um 15 Uhr habe ich keine Lust mehr zu arbeiten, ich bin müde; trotz des Kaffees und der Energy Drinks gehorcht mir mein System nicht mehr. Um ein System zu durchbrechen, das weiß ich als Tochter einer systemischen Psychotherapeutin, muss man die Replik stoppen, denn es repliziert sich ständig selbst.
Um 16 Uhr verlasse ich das Büro, Christian sieht mich erstaunt an. »Ist was?«, fragt er, als ich an ihm vorbeigehe und mich verabschiede. »Kopfweh«, antworte ich, und er runzelt die Stirn: »Du?«
Ich kaufe in zwei Geschäften ein und gebe mehr aus als sonst in einer ganzen Woche. Den Reis und die Pasta koche ich sogar selbst, und die Schokolade ist nicht die billigste Sorte.
Es schlägt sechs Uhr Abend, als ich fertig bin, und ich weiß, dass Nicole nicht vor acht hier sein wird. Vor dem Spiegel betrachte ich ein Stück Bauch rechts unter meinem Nabel. Zwei Cellulite-Streifen durchziehen den Bereich, ein winziges Muttermal ist da und zarte, sehr dünne Härchen.
Ich stelle mir vor, wie Nicoles Bereich aussehen könnte, wie viel Platz er einnehmen würde auf meinem Papier, und wie viele Details es an ihr zu entdecken gäbe.
Um 20 Uhr läutet sie, und ich habe meine Zeichenblätter in eine Ecke verbannt. In der Mitte des Raums türmt sich unser Essen und spiegelt sich zur doppelten Menge. Ich habe keinen Tisch, der groß genug wäre, um die Mengen aufzunehmen, die wir gleich verdrücken werden.
Nicole gibt mir an der Tür die Hand. Mit bloßen Füßen schlurft sie auf einen der Sitzpolster zu; rundherum Essen. Sie braucht lange, schnauft schwer und setzt sich umständlich hin. Das hätte ich bedenken müssen, sich hinzusetzen ist mit ihrem Körpergewicht nicht einfach, doch ich weigere mich zu denken.
»Ich hatte das Gefühl, ich könnte heute früher kommen, Soo-Yun«, sagt sie; nach jedem Wort macht sie eine Pause, sie ist immer noch kurzatmig, das Hinsetzen hat sie angestrengt. »Ein schöner Name, nicht? Hab ich gegoogelt.« Sie grinst.
Ich setze mich ihr gegenüber. Harter, windgepeitschter Regen klopft auf die Terrassentür. Wir essen. Am Ende bleiben Verpackungen und Reste übrig. »Sie dürfen sich gern alle Räume ansehen, solange ich auf der Toilette bin«, sage ich zu ihr.
Als ich zurückkomme, sitzt Nicole noch immer auf ihrem Polster, die Beine vor sich ausgestreckt. Wie bei einer Puppe stehen sie gerade nach vorn ab, während ihr Körper durch die Position noch fetter wirkt. Alles hat sich zu ihrer Körpermitte hin vereinigt, die Brust, der Bauch, der Hintern, eine Frau wie ein Gebirge. Sie sieht dem Regen zu. Ich habe die Terrassentür geöffnet, einzelne Haare ihres Pagenkopfs bewegen sich im Wind.
Abrupt sieht sie mich an. »Sie sind ein großes Talent, Soo-Yun«, sagt sie. »Kein Ton ist von Ihrem Erbrechen zu hören, dabei habe ich mich darauf konzentriert. Sie sollten bei einer Talentshow mitmachen.« Nicole lacht nicht, es war kein Witz.
»Ich habe es perfektioniert«, sage ich, und tatsächlich könnte ich mich auch während der Arbeit geräuschlos und unauffällig übergeben. Ich warte, dass sie weitererzählt, doch sie schweigt; den Rest des Abends sehen wir den Regentropfen zu, bis sie sich um 22 Uhr verabschiedet.