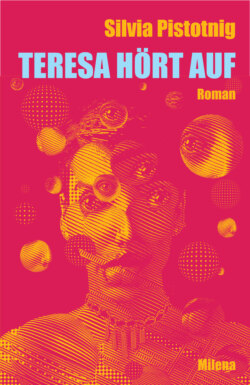Читать книгу Teresa hört auf - Silvia Pistotnig - Страница 15
XX
ОглавлениеTeresa sah sich die unbekannten Häuser an, hörte die Sprache, die sie nicht verstand, Menschen zogen an ihr vorüber, lachende Gesichter, sie hatte das Gefühl, bereits zu träumen.
Sie waren am Strand gewesen, sie hatte im Sand gespielt, dahinter hatten Hochhäuser wie Türme in die Luft geragt. Die Stadt, hatte ihr Vater gemeint, sei eine der größten der Welt, dabei klang sie so kurz. Rio. Wie konnte so eine riesige Stadt so einen kurzen Namen tragen?
Morgen, hatte die Mama gesagt, würden sie auf einen Berg fahren. Von dort, meinte ihr Vater, könne man sehen, wie weit sich dieses Rio erstreckte. Sogar eine Statue von Jesus stehe da oben, gigantisch groß. Teresa waren Jesus und die Stadt egal. Sie wollte lieber im Meer mit den Wellen hüpfen.
»Komm, Schatz, nicht stehen bleiben.« Ihre Mutter zog sie an der Hand, aber Teresa konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. Sie sackte bei jedem Schritt zusammen, so müde war sie. »Na gut«, sagte ihr Vater und hob sie auf seine Schultern.
Teresa fühlte sich wie eine Königin, die in einer Sänfte getragen wurde. Von hier oben konnte sie die Lichter und Reklamen der Geschäfte sehen. Sie legte das Kinn auf den Kopf ihres Vaters und fast wären ihr die Augen zugefallen. »Wir brauchen noch Wasser«, sagte Mama, und Teresa wachte wieder auf.
Das Wasser aus der Leitung konnte man nicht trinken, das hatten ihr die Eltern gesagt. Überhaupt war hier alles anders. Es war heiß und trotzdem schon früh dunkel, und die Geschäfte, das war das Verrückteste, hatten immer offen.
Sie blieben vor einem kleinen Laden stehen, nur ihre Mutter lief hinein. Teresa sah sich um. Es war viel los, überall Menschen, die herumgingen, und Lichter und Gemurmel. Sie sah in einen dunklen Hauseingang. Da war etwas, das dort nicht hingehörte. Sie konnte es nicht gleich erkennen, doch es sah aus wie Decken, die sich bewegten. Als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, erkannte sie unter den Decken einen Mann. Er lag seitlich und hielt eine Frau in seinen Armen.
Teresa wusste, dass das Sandler waren, die gab es auch zuhause. Die haben nichts zu wohnen, das hatte ihre Mama schon einmal erklärt. Aber die Mama hatte ihr auch gesagt, dass es Räume gab, wo sie übernachten durften. Warum lagen die beiden dann hier in einer dunklen Decke bei einem Hauseingang? Gerade als Teresa ihren Vater fragen wollte, bewegte sich noch etwas, und dieses Etwas streckte plötzlich ein Köpfchen heraus und weinte.
Teresa erschrak. Das Kind weinte, die Mutter beruhigte es, und es verschwand wieder unter der dunklen Decke.
»Gut, gehen wir«, sagte Mama, die gerade aus dem Laden kam. Doch bevor Papa losgehen konnte, zerrte Teresa an seinem Kopf, zeigte mit dem Finger zu dem schlafenden Paar mit dem Baby vor dem Hauseingang und sagte: »Ihr müsst sagen, dass sie wohin können, dass es Räume gibt!« – »Nein, Schatz, wir müssen zurück«, sagte der Vater.
Teresa fing auf seinem Rücken zu zetern an. »Ihr müsst es ihnen sagen!«, rief sie.
»Wir können ihre Sprache doch gar nicht«, erinnerte ihre Mutter, und der Vater zog fest an ihren Beinen.
»Ihr könnt Englisch, das können alle!«, brüllte Teresa. Sie hielt nicht still, verwendete alle Kraft darauf, sich zu befreien, schließlich zog sie an seinen Haaren. Er schimpfte, holte sie herunter, ohne sie loszulassen. Die Mutter versuchte sie zu beruhigen, doch Teresa hörte sie nicht. Sie schrie. Die Leute schauten die Familie betreten an und gingen weiter. Der Vater hielt ihre Hände fest und mithilfe der Mutter zerrten sie das Mädchen weg.
Teresa schrie und heulte. Vor dem Hotel redete die Mama auf sie ein. »Beruhige dich doch, es ist doch alles gut.«
»Warum?«, fragte das verheulte und verrotzte Kind, als Papa endlich losließ. Er setzte sich auf die Hotelstufen neben Teresa, Mama hockte sich dazu. »Schatz, wir wissen ja gar nicht, wo es hier Räume für Menschen ohne ein Dach über dem Kopf gibt«, erklärte sie.
»Warum habt ihr ihnen kein Geld gegeben, dann können sie ins Hotel ziehen, so wie wir«, beharrte Teresa.
»Das geht nicht, mein Liebling, wir können nicht allen helfen, das ist unmöglich«, sagte ihr Vater mit sanfter Stimme.
»Warum?«, fragte Teresa, durch den Rotz und die Tränen hindurch. Die Eltern seufzten.
»Es sind zu viele Menschen, denen es nicht gut geht. Wir können uns nicht um alle kümmern.«
»Scheiße!«, schrie Teresa. Es war das schlimmste Wort, das sie kannte. Die Eltern streichelten ihr über den Rücken und redeten ihr gut zu.
In der Nacht begann sie zu fiebern. Der Hotelarzt verschrieb fiebersenkende Mittel. Die Eltern blieben bei ihr sitzen, redeten davon, dass das Kind so sensibel sei. Teresa wusste nicht, was das bedeutete. Bis zu ihrer Rückreise erholte sie sich nicht mehr. Die Eltern nahmen sie mit an den Strand, wo sie den ganzen Tag auf das Meer sah und vor sich hin murmelte. Sie wollte nicht mehr Sandspielen.