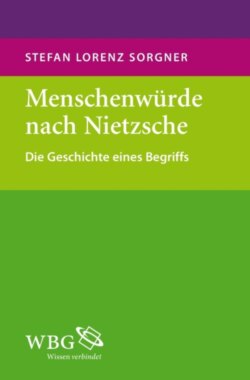Читать книгу Menschenwürde nach Nietzsche - Stefan Lorenz Sorgner - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3.5 Gerechtigkeit
ОглавлениеDie zweite Tugend, die nach Cicero zum Ehrenhaften gehöre, sei die Gerechtigkeit. Diese impliziere, dass ein Gerechter anderen Menschen nicht schadet und er jedem das Seine zukommen lässt. Ciceros Verständnis dieser Tugend lässt sich an seinen Äußerungen zum Eigentum verdeutlichen, da die Frage nach der angemessenen Eigentumserlangung und -verteilung eine Frage der Gerechtigkeit ist. Privateigentum komme nach Cicero durch weit zurückliegende Inbesitznahme, wobei diese nicht näher bestimmt wird, oder durch Sieg zu Stande.44 Das bestehende Eigentum dürfe jedoch nicht weggenommen werden. Wenn dies geschehe, handele es sich um eine schlimme Gewalttat.45
Die Grundforderung der Gerechtigkeit sei aber die Verlässlichkeit, worunter Cicero das „Stehen zu Zusagen wie Übereinkünfte und Wahrhaftigkeit“ versteht (De off. 23). Ungerechtigkeit entstehe entweder durch Unrechttun oder das Nichtabwehren des Unrechts.46 In Ciceros Denken ist die Gerechtigkeit mit der Todesstrafe durchaus vereinbar: „Von aller Ungerechtigkeit aber verdient keine mehr den Tod als die derjenigen, die dann wenn sie am meisten betrügen, darauf hinwirken, das sie als gutgesinnte Männer erscheinen“ (De off. I 41). Die Menschenwürde nach Cicero impliziert also nicht das absolute Abwehrrecht auf Leben.47
Ciceros Gerechtigkeitskonzeption wird in der gegenwärtigen Literatur zum Teil heftig kritisiert, z.B. von Nussbaum (2000, 187). Trotzdem anerkennt sie, dass bei Cicero der universale „Respekt vor der Humanität“ anzutreffen ist, der aus der stoischen „Idee des Lebens in Übereinstimmung mit der Natur“ folge (Nussbaum 2001, 60). Dies berücksichtigend, schreibt sie weiter: „Unfortunately, Cicero’s thought has serious gaps and inconsistencies: in particular, he appears to believe that we have no duties to give material aid to people outside our own republic“ (Nussbaum 2001, xxi).
Diese Kritik erscheint mir in ihrer Schärfe unangemessen. Dass Ciceros Erkenntnistheorie nicht inkonsistent ist, habe ich bereits gezeigt. Was sein Gerechtigkeitsverständnis betrifft, darf nicht vergessen werden, dass bei Cicero der Aspekt der sittlichen Gleichheit aller Menschen, also der Würde, auch in der Praxis deutlich wird. Er betont, dass „auch gegen Niedriggestellte Gerechtigkeit zu wahren ist“, wobei die niedrigste Stellung den Sklaven zukomme (De off. I 42). Außerdem kann Nussbaums Kritik, dass Menschen nach Cicero nicht die Pflicht hätten, Fremden materielle Hilfe zu gewähren, direkt widerlegt werden. Schließlich betont Cicero explizit: „[W]er aber sagt, man müsse Rücksicht nehmen auf seine Mitbürger, nicht aber auf Ausländer, der hebt die alle umfassende Gemeinschaft der Menschheit auf“ (De off. III 29). In direkten, unmissverständlichen Worten geht er auf die Sorge für alle Menschen ein: „Und auch, wenn die Natur dies vorschreibt, dass der Mensch will, es sei für den Mitmenschen – wer er auch immer sei, nur aus dem Grunde, weil er ein Mensch ist – gesorgt, so ist es notwendig gemäß derselben Natur, dass der Nutzen aller Gemeininteresse sei“ (De off. III 27). Allein an diesen Äußerungen wird deutlich, dass sein Würdekonzept von direkter Relevanz für seine Ethik ist und menschliche Handlungspflichten impliziert. Sein Verständnis einer gerechten Strafe, bei der darauf zu achten ist, dass sie frei „von Ehrenkränkungen“ ist, unterstreicht diesen Punkt (De off. 88). Diese Aussage erinnert stark an Margalits negative Begründung der Menschenwürde.48