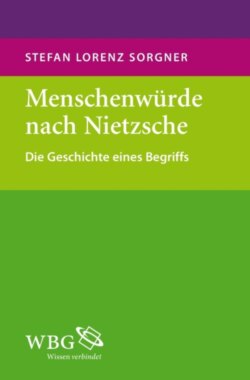Читать книгу Menschenwürde nach Nietzsche - Stefan Lorenz Sorgner - Страница 40
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4.1 Picos Erkenntnistheorie
ОглавлениеPico geht davon aus, dass die Beschäftigung mit der Philosophie die beste Art sei, sich auf den Tod vorzubereiten.7 Dabei sei zu beachten, dass es einen richtigen und einen falschen Umgang mit der Philosophie gebe. Der richtige Umgang liege im Bemühen, zur Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen. Falsch hingegen sei es, wenn man die Philosophie zum Beschaffen von Vorteilen nutze. Pico würde es in schärfster Form ablehnen, die Philosophie als Hilfswissenschaft der Physik oder Biologie anzusehen, wie dies zum Teil innerhalb der analytischen Philosophie der Fall ist, oder sie als Schulung des Denkens zur Vorbereitung auf wirtschaftliches Denken zu erachten: „Es ist sogar schon so weit gekommen, dass (sehr zu meinem Schmerz) nur noch die als Weise gelten, die sich für ihre Weisheitsliebe bezahlen lassen“ (1997, 39). Wer jedoch, wie er, sich um die Wahrheit bemühe, würde sogar verachtet werden.8 Er selbst habe sich „nie aus einem anderen Grunde mit Philosophie beschäftigt“, als um zu philosophieren. Den einzigen Gewinn, den er sich aus seinen „Studien“ und „nächtelangen Mühen“ erhofft habe, seien die Bildung seines Geistes und die Erkenntnis der Wahrheit (Pico della Mirandola 1997, 39ff). Um seinen Geist zu bilden und Wahrheit zu erkennen, geht Pico wie folgt vor: Zunächst betont er die zentrale Bedeutung der Selbsterkenntnis: „Denn wer sich selbst erkennt, erkennt alles in sich“ (1997, 33). Indem man alles Gelesene und Erlebte mit dem vergleiche, was vernünftig ist, schreite man den Weg der Selbsterkenntnis und damit auch den Weg der Erkenntnis voran. Außer in sich zu forschen, komme auch ein Erkenntnisfortschritt zu Stande, indem man die Positionen, zu denen man gekommen ist, anderen Weisen oder Denkern vorstellt und auf deren Erwiderungen reagiert. So sei, nach Pico, eine dialektische Annäherung an die Wahrheit möglich. Daher seien es gerade Wettkämpfe zwischen Reflektierenden, Denkenden und Weisen, die den Fortschritt der Weisheit förderten.9 Im Unterschied zu sportlichen Wettkämpfen gewinne man bei wissenschaftlichen durch die Niederlage.10
Auf wissenschaftliche Weise wollte er auch bei der Disputation seiner neunhundert Thesen vorgehen. Indem man sich durch Selbstreflexion sowie durch die Dialektik, den Austausch mit anderen, um die Wahrheit bemüht, betrachte man alle Aspekte der Schöpfung und damit alle Wunder Gottes, durch die wiederum „die Frömmigkeit und die Verehrung Gottes mehr“ gefördert werden als durch jede andere Tätigkeit (Pico della Mirandola 1997, 65). Damit sind wir bei einem weiteren Aspekt seiner Erkenntnistheorie angelangt. Schließlich ist seine Argumentation oft stärker theologisch als ontologisch.11 Picos Denken könne auch als poetische Theologie gezeichnet werden: „Pico’s theology is, in fact, theologia poetica, as Wind has so happily stressed, and, as we know, he promised but did not writea work by that name“ (Trinkaus 1970, 520). Wenn hier von Theologie gesprochen wird, so bezieht sich dies primär auf eine christliche Theologie, auch wenn aus dem damals vorherrschenden Verständnis des Christentums bezweifelt werden kann, ob Pico ein rechtgläubiger Christ war.12 Dies bedeutet nicht, dass Denker oder Theologen von anderen Religionen keinen Einfluss auf ihn gehabt hätten. Das Gegenteil ist der Fall. Schließlich repräsentieren nach Pico die verschiedenen Religionen einen jeweils anderen Zugang zu der einen Wahrheit. In unterschiedlichen Denk- und Glaubensrichtungen werden unterschiedliche Aspekte der einen Wahrheit offenbart.13 Insbesondere im zweiten Teil der „Oratio“ legt Pico dar,
„dass er mit der Disputation über seine Thesen den Versuch unternehmen wolle, die Lehren aller ihm bekannten Philosophenschulen vorzuführen. Jede einzelne Schule besitze etwas, wodurch sie sich auszeichne und was sie mit den übrigen nicht teile: Er bringt damit ‚seine grundsätzliche Überzeugung zum Ausdruck, dass alle diese Denker und Einzelne von ihnen einen wirklichen Anteil an der philosophischen Wahrheit hatten‘. Insofern erscheint es nicht berechtigt, Picos Synkretismus negativ zu charakterisieren. Er ‚erweist sich‘ vielmehr ‚als das Bemühen um eine ‚pax philosophica‘, zu der sich alle Schulen zusammenschließen‘“ (von der Gönna 1997, 115).
Auf die Vielfältigkeit des Verständnisses von dem hier angesprochenen Frieden gehe ich später noch ein. Aufgrund dieser Grundhaltung hat er sich mit den Autoritäten der verschiedenen Traditionen auseinandergesetzt.14 Nachdem er die Positionen der alten Väter (Platon, Platoniker, Heilige Schrift) durchdacht hatte, erkannte er die wahren Aspekte der jeweiligen Traditionen und setzte sich für die Eintracht zwischen diesen ein.15 Auch versuchte er aufzuzeigen, dass die Philosophien Platons und Aristoteles’ übereinstimmen.16 Aufgrund des versöhnenden Charakters seines Denkens sehen ihn heute einige Leser, etwa Garin, als wahrlich religiös an.17