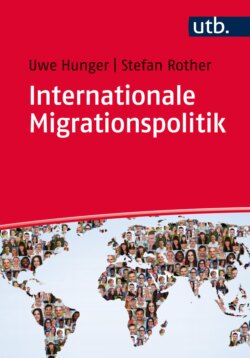Читать книгу Internationale Migrationspolitik - Stefan Rother - Страница 14
2.1 Sozialwissenschaftliche Migrationstheorie
ОглавлениеDie Anfänge der Migrationstheorien gehen auf den Geografen Ravenstein zurück, der im 19.Jahrhundert erste statistische Untersuchungen zur Binnenmigration in Großbritannien durchführte. Er wertete dafür Daten zu Binnenwanderungen auf Basis der Zensuserhebungen zwischen 1871 und 1881 aus. Dabei kam er zu verschiedenen Ergebnissen, die er in allgemeinen ‚Migrationsgesetzen‘ formulierte. So kam er zu dem Ergebnis, dass Wanderungen zumeist über kürzere Distanzen und in Etappen erfolgten, wobei Frauen kürzere Distanzen zurücklegten als Männer. Weiterhin erkannte er, dass das Wachstum in den Städten primär auf Zuwanderung zurückzuführen sei (und nicht auf natürliches Bevölkerungswachstum). Zudem war Migration damals schon auf wirtschaftliche Zentren ausgerichtet (Ravenstein 1885/89). Ravensteins veröffentlichte ‚Migrationsgesetze‘ sahen also schon damals eine starke ökonomische Bedingtheit von Migration, scheinen aus heutiger Sicht aber viel zu eindimensional und deterministisch.
Dennoch können viele von ihm untersuchte Prozesse und Verhaltensmuster auch in der heutigen Migration beobachtet werden. Insbesondere die Beobachtungen, dass Arbeitsmigration (immer noch) zu den wesentlichen internationalen Migrationsformen zählt und sich Migrationen zunächst regional vollziehen, zeigen eine verblüffende Parallele zu den damaligen Erkenntnissen (Samers 2010, S.54ff.). Auch in der späteren Migrationsforschung werden Ideen von Ravensteins Forschung aufgegriffen und weitergeführt. So unterschied Ravenstein bereits verschiedene Arten der Migration, die in der heutigen Migrationsforschung verwendet werden. Die ‚stage migration‘ wird zum Beispiel von späteren Theorien aufgegriffen. Auch seine Thesen zu Wanderungsbewegungen finden sich in der gegenwärtigen Migrationsforschung wieder, so zum Beispiel die große Bedeutung urbaner Zentren für internationale Migrant*innen, die von Frey (1998) mit dem Begriff „Immigrant gateway cities“ und von Sassen (1991) mit der „Global City-Hypothese“ → 1 Grundbegriffe und aktuelle Trends) aufgegriffen wurden.
Die gleich noch zu diskutierenden Push- und Pull-Faktoren gehen ebenfalls auf Ravensteins Analyse zurück und sind seitdem durch mehrere ökonomisch geprägte Migrationstheorien weiterentwickelt worden (insbesondere durch Lee 1966). Der Grundgedanke dabei ist, dass bestimmte Faktoren, wie ein hohes Bevölkerungswachstum, Armut oder bewaffnete Konflikte Migrant*innen aus einem Land ‚wegdrücken‘, während sie von Jobmöglichkeiten, höherem Lebensstandard oder Schutz vor politischer Verfolgung in einem anderen Land ‚angezogen‘ werden (Samers 2010, S.56ff.). Bei aller Kritik an Ravensteins wissenschaftlicher Methode bilden seine Forschungsergebnisse daher die Basis der modernen Migrationstheorien und beeinflussen die Migrationsforschung nachhaltig. Gerade auch der von Ravenstein geprägte methodologische Individualismus in der Migrationsforschung, mit dem das Individuum als zentrale Untersuchungseinheit etabliert wurde, beeinflusst moderne Ansätze, auf die wir als nächstes eingehen, noch heute.