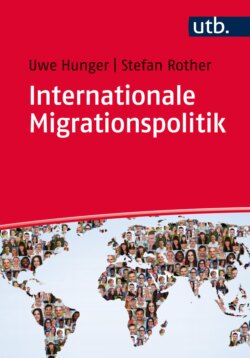Читать книгу Internationale Migrationspolitik - Stefan Rother - Страница 19
2.2.1 Klassischer Realismus und Neorealismus
ОглавлениеMax Weber, Thomas Hobbes, Niccolò Machiavelli, Thukydides – die Wurzeln des Realismus reichen weit zurück. Alle diese Autoren teilen mit dem klassischen Realismus ein zentrales Motiv: Macht (power) und der Kampf um diese als zentrales Charakteristikum der internationalen Politik. Während es innerhalb eines Staates Organe und Institutionen gibt, bei denen die hoheitliche Macht des Staates liegt, gibt es im internationalen System keine solche Hierarchie – es ist letztlich von Anarchie geprägt und Nationalstaaten sind die zentralen Akteure (Dougherty und Pfaltzgraff 2001). Nach Morgenthau, dem wohl bekanntesten Vertreter des Realismus geht es Politik letztlich immer darum, „either to keep power, to increase power or to demonstrate power“ (Morgenthau 1978, S.5). Zwar sind alle Nationalstaaten rechtlich gleichgestellt und souverän, sie unterscheiden sich jedoch deutlich hinsichtlich ihrer Ressourcen und ihrer Macht. Dies lässt sich an der Bedeutung der so genannten Supermächte nachvollziehen. Das Ziel von Nationalstaaten ist es aber immer, das eigene Überleben zu sichern, koste es, was es wolle. Daher versuchen Staaten, ihre politischen, militärischen und wirtschaftlichen Kapazitäten immer weiter zu erhöhen. Erst wenn das gesichert ist, kann sich ein Staat nachrangigeren Interessen zuwenden. Bündnisse mit anderen Staaten werden nur eingegangen, wenn es dem Ziel der eigenen Selbsterhaltung dient.
Nachfolgende Theorien, wie der Neo-Realismus, auch struktureller Realismus genannt, betonen, dass das Streben nach Macht dabei aber nicht als Selbstzweck verstanden werden dürfe, sondern sich aus dem Sicherheitsstreben der Staaten heraus erkläre: „In crucial situations, the ultimate concern of states is not for power but for security.“ (Waltz 1979, S.37).
Vertreter*innen der realistischen Schule, wie Myron Weiner, sehen Migration vor diesem Hintergrund vor allem als Sicherheitsbedrohung für die soziale Stabilität eines Nationalstaats (Weiner 1985). Dabei wird der Nationalstaat von außen durch Einflüsse der Globalisierung und von innen durch einen wachsenden Multikulturalismus bedroht (Schlesinger 1998). Auch Samuel L. Huntington vertrat in seinem letzten Buch “Who are We? The challenges to American identity“ eine solche Auffassung, indem er argumentierte, die zunehmende „Latino culture“ sei eine Bedrohung der amerikanischen Identität, die er vor allem als angelsächsisch-protestantisch begreift (Huntington 2004) (→ 8 Migration und Sicherheit). Solche Ansichten haben auch weit über den akademischen Bereich Auswirkungen – etwa in den Arbeiten von Peter Brimelow, der Immigration als „Krieg gegen den Nationalstaat“ (Brimelow 1996, S.222) betrachtet (dabei aber selber aus Großbritannien in die USA eingewandert ist). In Deutschland schlug das Buch von Thilo Sarrazin (2010) „Deutschland schafft sich ab“ einen ähnlichen Tonfall an. So unterschiedlich diese Autoren sind, so eint sie die Einordnung von Migration als Bedrohung und eines drohendes Kontrollverlusts des Nationalstaates.