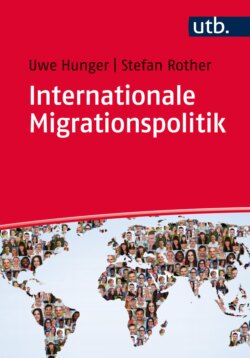Читать книгу Internationale Migrationspolitik - Stefan Rother - Страница 20
2.2.2 Der neoliberale Institutionalismus
ОглавлениеNeoliberale Institutionalist*innen stimmen zwar der Einschätzung des internationalen Systems als anarchisch zu, unterscheiden sich aber von den Neorealist*innen hinsichtlich der Bewertung von Kooperationen. Zwar betrachten auch Realist*innen diese als möglich, gehen aber davon aus, dass Kooperationen nur so lange funktionieren, wie die mächtigen Staaten ein Interesse daran haben. Aus neoliberaler Sicht haben Kooperationen jedoch einen Wert an sich und versprechen Gewinne, die ohne Kooperationen niemals möglich wären und selbst bei ungleicher Verteilung jedem Staat Zugewinne bescheren könnten. Ziel der Staaten müsse es daher sein, Kooperationen auf supranationaler Ebene anzustreben. Aus Sicht eines der prominentesten Vertreter des neoliberalen Institutionalismus, Robert Keohane, sind Kooperation aufgrund der zunehmenden Interdependenz in einer globalisierten Welt für Staaten unabdingbar.1 Obwohl sich institutionelle Regeln im anarchischen internationalen System nicht hierarchisch durchsetzen lassen, argumentiert Keohane, dass Veränderungen in der Institutionalisierung der Weltpolitik signifikanten Einfluss auf das Verhalten von Regierungen haben (Keohane 1989) und diese ihr Handeln zu einem beachtlichen Grad von bestehenden institutionellen Einrichtungen abhängig machen. So führte beispielsweise die Aussicht auf Gewährung von Einreisevergünstigungen oder Zugang zum EU-Binnenmarkt zu Veränderungen im staatlichen Verhalten. Abweichendes staatliches Verhalten wird dadurch nicht unmöglich, aber die Kosten-Nutzen-Rechnung verschiebt sich zugunsten regelgeleiteten Verhaltens.
Relative oder absolute Gewinne?
Umgangssprachlich ist oft von einer „Win-win“-Situation die Rede, im Bereich der Internationalen Beziehungen gestaltet sich die Sache aber etwas komplexer: Dass Staaten bei internationalen Verhandlungen und Abkommen an ihren eigenen Vorteil denken, ist weitgehend unumstritten. Eine Kontroverse gibt es aber darüber, wieweit dabei auch der Vorteil der anderen Partei(en) eine Rolle spielt: Realist*innen glauben, dass hier relative Gewinne entscheidend sind, Staaten also nur zur Kooperation bereit sind, wenn sie daraus mehr Vorteile ziehen als der oder die anderen Beteiligten. Institutionalist*innen gehen dagegen davon aus, dass Staaten bereits kooperieren, solange sie selber davon einen Nutzen haben, selbst wenn dieser für die anderen Beteiligten größer ist. In beiden Fällen folgen die Akteur*innen der Theorie der rationalen Entscheidung (rational choice theory), treffen dabei aber eine andere Kosten-Nutzen-Abwägung.
Die Kosten-Nutzen-Abwägung kann auch dann zugunsten einer Kooperation ausfallen, wenn diese für einen Staat nicht nur Vor-, sondern auch Nachteile mit sich bringt, und zwar dann, wenn dieser Staat die Vorteile höher einschätzt als die Nachteile.
Am weitesten ist der Gedanke der internationalen Kooperation in der sog. Regimetheorie entwickelt worden. Unter Regimen versteht man ein Geflecht von Normen, Regeln und Entscheidungsverfahren auf internationaler Ebene, an denen sich Nationalstaaten und andere Akteure orientieren und anpassen. Beispiele für internationale Regime finden sich etwa in Bereichen wie Handel, Umwelt, Menschenrechte und Abrüstung. Auch im Bereich Migration spielen sie eine wichtige Rolle, besonders im Schutz von Geflüchteten, wie wir weiter unten noch sehen werden. Regime können Bausteine einer Global Migration Governance werden; hier spielen Staaten nicht mehr die alleinige – oder sogar nur eine sehr geringe – Rolle und die Bedeutung von privatwirtschaftlichen und (zivil)gesellschaftlichen Akteur*innen nimmt zu (→ 13 Global Migration Governance).
Regime
Die weitgehend anerkannte Definition von Regimen stammt vom Stephen D. Krasner (1982, S.186): „Implicit or explicit principles, norms, rules, and decision-making procedures around which actors’ expectations converge in a given area of international relations. Principles are beliefs of fact, causation, and rectitude. Norms are standards of behavior defined in terms of rights and obligations. Rules are specific prescriptions or proscriptions for action. Decision-making procedures are prevailing practices for making and implementing collective choice.”)
Die Reichweite ist in der Regel global, kann aber auch regional sein und sehr spezifische Themenfelder umfassen; so gibt es etwa im Diamantenhandel ein Regime, das den Handel mit sogenannten „Blutdiamanten“ ächtet und Mindeststandards für den Handel mit Rohdiamanten festlegt (Kimberley Process Certification Scheme (KPCS). Bei der internationalen Fluchtpolitik wird oft von einem Regime gesprochen, im Bereich der Arbeitsmigration dagegen von einem „fehlenden Regime“.
Im Gegensatz zu internationalen Organisationen, wie z.B. die Vereinten Nationen, besitzen Regime keine Akteursqualität, sie können also nicht eigenständig handeln; es handelt sich lediglich um Regelwerke (Zangl 2010, S.133). Internationale Regime sind problemfeldspezifisch, internationale Organisationen können sowohl problemfeldspezifisch als auch problemfeldübergreifend sein.