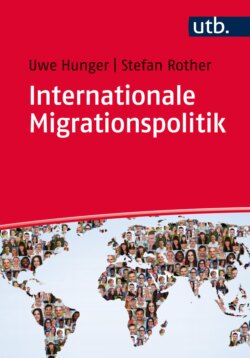Читать книгу Internationale Migrationspolitik - Stefan Rother - Страница 8
1.3 Migration in und zwischen einzelnen Weltregionen
ОглавлениеBlickt man auf die regionale Verteilung des internationalen Migrationsgeschehens, so sieht man, dass die meisten internationalen Migrant*innen in Europa leben (rund 30 %), gefolgt von Nordamerika (21,6 %) und Nordafrika und Westasien (17,9 %). In absoluten Zahlen ausgedrückt wohnten im Jahr 2019 82 Millionen Migran*innten in Europa, rund 59 Millionen in Nordamerika und rund 49 Millionen in Nordafrika und Westasien (UN 2019). Die nächstmeisten Migrant*innen entfielen auf Subsahara-Afrika (8,7 %, rd. 24 Millionen), Zentralasien und Südasien (7,2 %, rd. 20 Millionen) sowie auf Ost- und Südostasien (6,7 %, rd. 18 Millionen). Lateinamerika und die Karibik (4,3 %, rd. 12 Million) sowie Ozeanien (3,3 %, rd. 9 Millionen) bildeten das Schlusslicht. Dabei ist auffallend, dass in allen Regionen die internationale Migration in den letzten 15 Jahren noch einmal stark zugenommen hat, wobei nur in Nordamerika der Zuwachs geringer ausfiel als im Vergleich zu den Jahren 1990 bis 2005.
Abbildung 6:
Regionale Verteilung der internationalen Migrant*innen 2019
Quelle: UN, International Migration Report 2019.
Abbildung 7:
Veränderung des Anteils internationaler Migrant*innen in den verschiedenen Weltregionen (in %)
Quelle: UN, International Migration Report 2019.
Gemessen an der Gesamtbevölkerung ist demgegenüber die Migration in Ozeanien, insbesondere Australien, am höchsten. Hier beträgt der Migrant*innenanteil über 21,2 Prozent. Danach folgt Nordamerika mit 16 Prozent. Europa weist 11 Prozent und Nordafrika und Westasien weisen 9,4 Prozent auf. In allen anderen Regionen liegt der Anteil an internationalen Migrant*innen seit den 1990er Jahren unter drei Prozent.
Auffallend ist zudem, dass der Großteil der internationalen Migration überwiegend nicht zwischen, sondern innerhalb der einzelnen Weltregionen stattfindet. So wandert in den allermeisten Regionen jeweils die Mehrheit der internationalen Migrant*innen innerhalb der eigenen Region. In Ost- und Südostasien sowie in Subsahara-Afrika trifft dies auf fast 80 Prozent der Fälle zu. In absoluten Zahlen stellte Europa mit rund 30 Millionen Menschen den größten Wanderungskorridor weltweit dar, (noch vor der Migration aus Lateinamerika und der Karibik nach Nordamerika im Umfang von 26,6 Millionen Menschen). Ausnahmen bilden nur Ozeanien und Nordamerika, wo nur 11,9 (Ozeanien) bzw. 2,3 Prozent (Nordamerika) der Migrant*innen innerhalb ihrer eigenen Region verbleiben. Während Menschen aus Ozeanien vor allem nach Europa wandern, gehen Migrant*innen aus Nordamerika in den meisten Fällen nach Lateinamerika bzw. die Karibik. Hierbei handelt es sich vielfach auch um Rückwanderer*innen.
Betrachtet man wieder die Nettomigration, zeigt sich entsprechend der Darstellung zu den Entwicklungsregionen (Globaler Norden vs. Globaler Süden), dass vor allem Europa, Nordamerika, Ozeanien und seit 2000 auch die Region Nordafrika und Westasien Einwanderungsregionen, während Zentral- und Südasien, Lateinamerika und die Karibik sowie Ost- und Südostasien ebenso wie Subsahara-Afrika Auswanderungsregionen sind, wobei Zentral- und Südasien die größte Auswanderungsregion der Welt darstellen. Hier sind seit 2000 im Jahresdurchschnitt etwa 1,5 Millionen Menschen mehr aus- als eingewandert. Demgegenüber stieg in Europa die Zahl der internationalen Migrant*innen jährlich um etwa eine Million Menschen, wobei allerdings viele der Migrant*innen innerhalb Europas gewandert sind. Interessant ist dabei auch, dass Europa noch bis weit in das 20. Jahrhundert zu den Auswanderungsregionen der Welt gehörte.
Abbildung 8:
Anteile der Migrationen innerhalb der eigenen Region (in %)
Quelle: UN, International Migration Report 2019.
Abbildung 9:
Ausgangs- und Zielregionen internationaler Migration
Quelle: UN, International Migration Report 2019.
Abbildung 10:
Bevölkerungsabnahmen und -zuwächse infolge internationaler Migration in verschiedenen Weltregionen seit 1950 (in Millionen)
Quelle: UN, International Migration Report 2019.