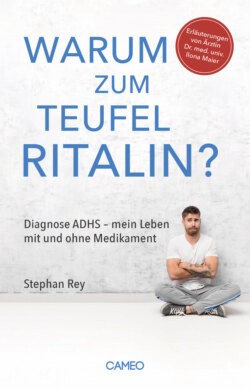Читать книгу Warum zum Teufel Ritalin? - Stephan Rey - Страница 9
ОглавлениеWarum ein Buch über ADHS?
Dem Entschluss, ein Buch schreiben zu wollen, ging meine ADHS-Diagnose voraus. Der Befund war für mich eine Erlösung! Vieles lichtete sich wie ein Schleier vor meinen Augen und ich konnte mein bisheriges fünfzigjähriges Leben endlich in eine neue und vor allem gesunde Relation stellen.
Ich bin im Sommer 1968 geboren und in einer Zeit groß geworden, in der die Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) noch weitgehend unbekannt war in unserer Gesellschaft. Damals sprach man vom Psychoorganischen Syndrom (POS), das als Verhaltensauffälligkeit charakterisiert wurde und von dem man sogar sagte, es verlaufe progressiv. Meine Eltern begegneten meiner Andersartigkeit mit Toleranz und viel gutem Willen. Viele meiner Mitmenschen ließen mich jedoch wissen oder spüren, dass ich doch ein recht schwieriges Kind sei. Ich sollte mich benehmen, mich ruhig verhalten, weniger reden. Ich bemühte mich sehr, aber es ging einfach nicht. Selbst das Beten half nichts. In der Schule geriet ich ins Hintertreffen, mein Selbstwertgefühl litt entsprechend. Mit diesen Voraussetzungen startete ich in mein Erwachsenenleben, das über viele Jahre äußerst turbulent bleiben sollte.
Die Dunkelziffer an Erwachsenen, bei denen die Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS/ADS, (noch) nicht diagnostiziert wurde, wird von Experten hoch eingeschätzt. Natürlich sind jene Generationen, die in einer Zeit aufwuchsen, in der noch niemand von dieser Eigenschaft sprach, überdurchschnittlich betroffen. Dies blieb nicht ohne Folgen, wie ich aus meiner jetzigen beruflichen Position als Pflegefachmann bestätigen kann: Bei vielen Männern und Frauen, die mit Depressionen, Zwangserkrankungen, Angststörungen und Panikattacken, Süchten oder mit einem Burnout leben, kann der Ursprung dieser Leiden durchaus in einer unbehandelten AD(H)S-Problematik liegen. Dass die Ursprungserkrankung in Wirklichkeit die Haupterkrankung ist, wissen weder die Patienten noch die behandelnden Ärzte. Leider wird die Nebendiagnose nur allzu oft mit Antidepressiva behandelt, während die Grunderkrankung, AD(H)S, ignoriert oder kategorisch ausgeklammert wird.
Je mehr ich mich mit der Thematik rund um AD(H)S befasst habe, desto wichtiger fand ich es, dass ein Betroffener selbst erzählt, was er in Zusammenhang mit AD(H)S erlebt hat. Es ist die Reflexion eines Lebens mit und ohne Diagnose, aber auch mit und ohne Therapien sowie Medikamenten. Es ist aber auch ein Appell an Eltern: Wenn Ihre Kinder einen begründeten Verdacht auf eine AD(H)S-Problematik aufweisen, sollten sie diesen Verdacht auf jeden Fall abklären lassen. Alles andere muss nicht, aber kann sich negativ auf die Zukunft auswirken. Die Sozialisierung und eine adäquate Schulbildung können von der Diagnose und den getroffenen Maßnahmen abhängen. Das gilt ebenso für das Wohlbefinden des betroffenen Kindes auf verschiedenen Ebenen und ebenso zur Prävention für spätere Begleiterkrankungen.
Heute sind Kinder in einer Welt zu Hause, in der die Zeit der Eltern ein zunehmend knappes Gut geworden ist. Der ständig wachsende Leistungsdruck, dem immer mehr Kinder ausgesetzt sind, aber auch der eingeschränkte Bewegungsraum in den Städten tragen dazu bei, dass im Zusammenhang mit AD(H)S von einer Zivilisationskrankheit gesprochen wurde. Heute weiß man, dass das eine falsche Annahme ist.
Und doch glaube ich, dass der bekannte Schweizer Kinderarzt Remo Largo auch recht hat, wenn er in Bezug auf Verhaltensauffälligkeiten Folgendes sagt: «Nicht die Kinder sind das Problem, sondern die Erwachsenen, die die Umgebung gestalten.» Aufgrund meiner eigenen Biografie weiß ich nur zu gut, wie verschiedenartig sich AD(H)S äußern kann und welchen Beitrag die Umwelt unter Umständen leistet.
Die ersten Jahre meines Lebens hatte ich Glück: Mit toleranten Erwachsenen und wenigen Regeln, die meinen Bewegungsdrang und mein unkonventionelles Verhalten einschränkten. Später erlebte ich leider das pure Gegenteil, und das hatte Konsequenzen für mein Leben. Wenn das Umfeld mit Überforderung reagiert und wenn in gleichem Maße Vorurteile vorhanden sind, die oft auf mangelnder Information beruhen, kann der Alltag für ein Kind mit AD(H)S zur wahren Belastung werden.
Im weiteren Verlauf meines nicht einfachen Lebens wurde ich schließlich mit dem Thema Ritalin konfrontiert. Nach einem fünfjährigen Prozess, der mit unzähligen Versuchen gespickt war, meine innere Unruhe und das Chaos in meinem Kopf zu bewältigen, war ich dazu bereit, dem umstrittenen Medikament eine Chance zu geben, und ich entschied mich für die Einnahme von Ritalin. Das Resultat ist für mich positiv, um nicht zu sagen: Es war überwältigend. Seit einiger Zeit bin ich gut eingestellt mit dem Medikament und mein Buchprojekt konnte dadurch Kapitel um Kapitel erweitert werden. Manche meiner Überlegungen mögen für Leserinnen und Leser ketzerisch erscheinen, andererseits kann ich als Betroffener laut aussprechen, was sich andere vielleicht nicht getrauen: Warum sollte ich verschweigen müssen, dass ein Medikament meine Lebensqualität signifikant steigert, während die Medikation mit anderen Präparaten wie z. B. Temesta, Xanax, Stilnox u. a. weit mehr Risiken birgt und die Mittel noch dazu abhängig machen? Anders gefragt: Warum ist Ritalin im Zusammenhang mit AD(H)S ein Tabuthema und warum sind es Benzodiazepine und Schlafmedikamente oft nicht?
Ritalin fällt in die Kategorie der Betäubungsmittel. Das ist aus meiner Sicht jedoch nicht der eigentliche Grund, warum es immer wieder verteufelt wird. Die Antwort ist simpel: Die wenigsten Menschen wissen, wie Ritalin bei Menschen mit AD(H)S wirkt und welche Nebenwirkungen es dann tatsächlich hat. Die Empörung rund um Ritalin ist laut und schrill. Während Nebenwirkungen in der Schulmedizin mehrheitlich ignoriert werden, muss die Psychiatrie und Neuropsychiatrie immer noch gegen enorme Vorurteile ankämpfen, und das gilt hier natürlich auch für die Medikamente, die eingesetzt werden.
Die Diskussion sollte sachlich und nicht ideologisch geführt werden. Natürlich hat jedes Medikament eine Wirkung und eine Nebenwirkung. Wirksamkeit und Nutzen müssen immer wieder aufs Neue überprüft werden. Verschreibungspflichtige Arzneimittel dürfen zudem niemals ohne Facharzt und eine vorhergehende Anamnese verordnet werden. Eine seriöse Behandlung von AD(H)S und möglicher Folgeerkrankungen schließt immer mehrere Therapiebereiche mit ein. Dazu gehören Ernährung, Bewegung, die Komplementärmedizin oder die Agogik. All diese Maßnahmen können eine Linderung bewirken und sie tragen auch dazu bei, dass die Medikation mit Ritalin die beste Wirkung entfalten kann.
In meinem Fall half mir das Medikament dabei, dass ich einerseits mehr am Leben teilnehmen und andererseits den Moment besser genießen kann. Ich bin heute mit mir selbst im Reinen, agiere im Gegensatz zu früher überlegt und bin innerlich ausgeglichen und ruhig. Und das ist ein großer Gewinn für mich, ein Zustand, den ich kaum in Worte fassen kann. Ich erhebe nicht den Anspruch, dass meine Erfahrungen für alle Gültigkeit haben. Und doch möchte ich nicht schweigen müssen.
Zusammenfassend kann ich sagen: Nach all den Jahren, in denen sich meine Hyperaktivität negativ auf meine Lebensqualität ausgewirkt hat, ist mein Leben mit Ritalin heute wie ein Geschenk, das ich etwas verspätet ausgepackt habe. Das klingt jetzt für einige vielleicht so, als hätte ich einen Werbevertrag mit einem bekannten Pharmakonzern. Ich kann aber mit gutem Gewissen behaupten, dass dem nicht der Fall ist und sich für mich auch keine anderen finanziellen Quellen erschlossen haben, um dieses Buch zu schreiben. Ich beschreibe lediglich die Erlebnisse eines Menschen – meine Erlebnisse – mit ADHS, wie ich mit (aber nicht nur) Ritalin einen Weg gefunden habe, mein Leben so zu leben, wie es für viele von Geburt an natürlich und selbstverständlich ist.
Stephan Rey, im Sommer 2020
Dr. med. univ. Ilona Maier erläutert das Kapitel
Fakten zu ADHS:
Sind Menschen mit ADS und ADHS kreativer?
Der Begriff «Kreativität» stammt vom lateinischen Wort «creare» ab, was in die deutsche Sprache übersetzt «schaffen», «gebären» oder «erzeugen» bedeutet.
Dahinter steht auch die entsprechende Motivation, bezogen auf den Bereich, in dem die Kreativität ausgelebt wird. Das kann in der Kunst sein, doch ist es natürlich in unzähligen anderen Bereichen möglich.
Kreativität wird nach Joy Paul Guilford (1897–1987), amerikanischer Psychologe und Intelligenzforscher, durch grundlegende psychische Merkmale erfasst: Problemsensitivität, d. h. im Erkennen, wo ein Problem besteht, die Fähigkeit, in kurzer Zeit viele Ideen hervorzubringen, Flexibilität, das Neuverwenden bekannter Objekte, Anpassen der Ideen an die Realität sowie Originalität.
Gemäß der Kreativitätstheorie des Psychologen Dean Keith Simonton (geboren 1948) von der University of California sind ungewöhnliche und unerwartete Erfahrungen ein wichtiges Merkmal von Menschen, die im Laufe ihres Lebens kreative Meisterleistungen vollbringen.
Was hat das mit ADHS zu tun?
Das Kernsymptom Unaufmerksamkeit führt oft zum Abwandern der Gedanken (mind-wandering, der Autopilot ist eingeschaltet). Die während dieses Abdriftens aufkommenden Gedanken, betrachtet es man nun positiv, können zu neuen Ideen bzw. kreativen Einfällen führen.
Das andere Kernsymptom, die Impulsivität, macht Menschen mit ADHS spontaner, auch mutiger, sie haben eine gewisse Risikobereitschaft, sind begeisterungsfähig. Da sie manchmal die Grenzen nicht so gut spüren können, probieren sie eher Dinge aus, lassen sich auf Neues ein, sind offen und neugierig. Das fördert die Umsetzung von Ideen bzw. Kreativität.
Ein Problem ist häufig die Ausdauer. Wenn ein großes Interesse an einer Sache besteht, funktioniert die Konzentration besser und es gelingt entsprechend einfacher, eine Angelegenheit weiterzuverfolgen, man befindet sich dann im Flow-Zustand.
Es ist davon auszugehen, dass es unter den Künstlern, also Menschen mit großem kreativem Potenzial, nicht wenige gibt, die ADHS haben.