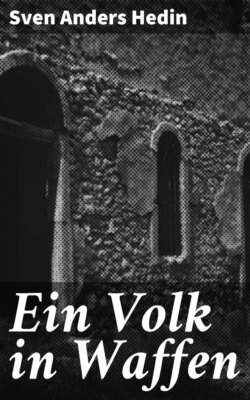Читать книгу Ein Volk in Waffen - Sven Anders Hedin - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Kriegsbilder auf der Fahrt.
ОглавлениеInhaltsverzeichnis
Felder und Wälder, Höfe und Städte fliegen vorüber, und der Geschwindigkeitsmesser zeigt auf 70 Kilometer.
Wannsee — Potsdam. Nichts deutet an, daß Deutschland eben seinen größten Krieg erlebt. Gewaltige Ladungen duftenden Heus werden von den Wiesen hereingefahren. Es gibt also noch Pferde in Deutschland, die anderes ziehen als Kanonen und Munition. Die Flügel der Windmühlen drehen sich knarrend und mahlen das Korn, das in Brot für Millionen von Soldaten und ihre Familien daheim verwandelt werden soll.
Wittenberg. Auf der Straße zieht ein Trupp Freiwilliger. Sie sehen fröhlich in die Welt hinaus, marschieren können sie mit taktfesten Schritten, und sie singen ein munteres, belebendes Soldatenlied. An der nächsten Straßenecke ein neuer Trupp, der vom oder zum Übungsplatz marschiert, junge, kräftige Männer von soldatischer Haltung; man sieht, wie sie sich darnach sehnen, ins Feld zu ziehen. Sie singen nicht, sie pfeifen eine gemütliche Melodie, die ganz lustig zwischen den alten wittenbergischen Häusern erklingt. Es sind Germanen. Sie sind nicht geboren, um von slawischen oder lateinischen Völkern besiegt zu werden. Ihre Väter sind von Tacitus besungen worden und haben im Teutoburger Wald gesiegt. Nun sind sie würdige Nachkommen der alten Germanen, die sich unter den deutschen Adlern zum Kampf für die Freiheit zwischen Rhein und Weichsel und jenseits der großen Stromtäler versammeln. Es ist gefährlich, Adler zu reizen; noch können sie ihre Horste verlassen und ihre Schwingen erheben! Jetzt hat Deutschlands Schicksalsstunde geschlagen, jetzt gilt es den Platz und die Zukunft der Germanen auf der Erde! Hört das Echo ihrer stahlfesten Schritte in Wittenbergs Straßen! So hallt es ähnlich in allen deutschen Städten, wo die Freiwilligen zu den Fahnen strömen! Es ist eine Völkerwanderung, deren gleichen die Welt noch nicht gesehen hat!
In Bitterfeld treffen wir ein, als gerade der Wochenmarkt in höchstem Flor steht: Vor den Verkaufsständen malerisches Leben, farbenreich, altertümlich und friedlich — kein Mensch kann hier ahnen, daß Deutschland im Krieg steht, und doch denken alle, auch die, die die kleinen Geschäfte des Tags besorgen, nur einen einzigen Gedanken, den Krieg. Auf der Straße vor der Stadt sehen wir Frauen, die in ihre Dörfer zurückwandern oder fahren, nachdem sie auf dem Markt ihre Ein- und Verkäufe gemacht haben. Bei den Braunkohlengruben vor Bitterfeld sind die Körbe der Luftbahnen in voller Fahrt und führen die Kohle in die Fabriken, wo Briketts daraus verfertigt werden.
Bei jeder Brücke, die wir passieren, über oder unter einem Bahngleis, stehen immer ein oder ein paar ältere Landsturmleute; sie tragen dunkelblaue Uniformen, abends und in der Nacht graue Mäntel. Sie stehen mit verschränkten Armen, das Gewehr wagerecht unter den linken Arm geklemmt, und gehen langsam und treu am Kopf der Brücke oder unter ihrer Wölbung, bis sie von Kameraden abgelöst werden. So oft das Auto mit seinem flatternden Kriegswimpel dahergefahren kommt, nehmen sie Stellung, Gewehr bei Fuß. Mindestens ein Armeekorps ist durch solchen Wachtdienst in der Heimat gebunden.
Auf der Hauptstraße in Halle ist reges Leben, denn hier ist die große Straße nach Merseburg und weiterhin nach dem westlichen Kampfplatz. Während wir uns in der Stadt aufhielten, sausten noch verschiedene Militärautomobile vorüber. Auch hier hängen in den Fenstern der Buchhandlungen große Kriegskarten, und davor stehen Gruppen von Schuljungen, die laut und wichtig von dem sprechen, was die kleinen Fähnchen andeuten — vom Krieg.
Wir zünden den Scheinwerfer des Automobils an und fahren aus Halle heraus, südlich an Merseburg vorüber auf der Straße nach Naumburg, immer im Saaletal. Der scharfe Lichtschein erhellt die Landstraße ein gutes Stück voraus. Die Schnelligkeit ist auf 40 Kilometer in der Stunde herabgesetzt. Die Laubbäume der Alleen werden von den Lampen von untenher beleuchtet; es sieht aus, als führe man durch einen unendlichen grünen Tunnel. In der Ferne, zu beiden Seiten der Straße, werden helle Perlenschnüre von glänzenden Lichtern sichtbar: die Fenster in Dörfern und Höfen, wo Väter und Mütter, Geschwister, Jungfrauen und Kinder bei der Abendlampe sitzen und zum zwanzigsten Male die Feldpostbriefe und -karten lesen, die Soldaten von der Front in Frankreich oder in Belgien nach Hause geschickt haben. Ihre Anzahl geht in viele Millionen. Was steht wohl in diesen oft schwer leserlichen Briefen? Ich habe einige von ihnen gelesen. Da erzählt der Soldat den Seinen, wie es im Quartier geht, wie das Essen nach den Strapazen des Felddienstes schmeckt, wie ihm zumute ist, wenn die Granaten in seiner Nähe krepieren und die Kameraden neben ihm fallen. Da steht auch, daß der Feind verloren ist und im Handumdrehen zurückgeworfen werden wird, wenn der General die Stunde für gekommen hält, um Sturm zu kommandieren. Da wird mit gutmütiger Achtung von den Franzosen als tapferen, ehrlichen Soldaten gesprochen und von den Engländern mit glühendem Haß. Und schließlich sagt oft genug der Soldat, es könne keine Rede davon sein, daß er in die Heimat zurückkehrt, ehe er verwundet und, was Gott verhüten wolle, kampfunfähig geworden und ehe der Sieg über die Feinde des Deutschen Reiches erfochten ist. Denn das wissen die Soldaten vom Veteran bis zum jüngsten Rekruten, daß Deutschland wohl bis an die Zähne gerüstet war in Erwartung des Krieges, daß aber der Kaiser und die Staatsmänner Deutschlands alles, was in ihrer Macht stand, taten, um ein Unglück abzuwehren, das die ganze Erde treffen und unerhörte Ströme von Blut und Tränen kosten mußte, ein namenloses Elend in verödeten Häusern und verwüsteten Dörfern, unzählige Nächte des Wartens und der Unruhe und lange Jahre trostloser Sorge und Trauer.
Der Wirt im Hotel »Zum mutigen Ritter« in Kösen leistet uns bei einer Tasse Tee Gesellschaft und berichtet, daß alle seine Badegäste auf einmal verschwanden, als der Krieg ausbrach; der ganze Hotelbetrieb stehe still. »Aber was tut das,« fügt er hinzu — »wenn wir nur siegen!«
16. September. Wenn man sich im Goethehaus zu Weimar in diese Welt großer, teurer Erinnerungen hineinversenkt hat und plötzlich wieder auf die Straße hinaustretend eine Schar Landsturmleute sieht, die nach dem Schießplatz marschiert, dann muß man sich die Augen reiben und sich zusammennehmen, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Und dieses Volk, das einen Goethe hervorbrachte und jetzt mit glänzender Tapferkeit an einem halben Dutzend Fronten kämpft, ist von einer ganzen Presse, von einer ganzen Nation ein Volk von Barbaren genannt worden! —
Erfurt–Gotha. Links von uns steigen die dunklen, regenschweren, neblichten Höhen des Thüringer Waldes empor. Aber unser Weg führt durch behagliche Dörfer mit freundlichen Fachwerkhäusern; schreiende Gänse und gackernde Hühner tun ihr möglichstes, um von uns überfahren zu werden oder wenigstens unsere Fahrt aufzuhalten. Schnell ist Eisenach erreicht und hinter uns. Die Straße biegt nun scharf nach Südwesten ab, und in schön abgerundeten Windungen erklimmen wir die Höhen des Thüringer Waldes. Tiefer, dunkler, kühler Schatten; es duftet von feuchtem Erdboden und saftigen Nadeln; ab und zu erinnert die prächtige Gegend lebhaft an die Straße von Rawalpindi bis Kaschmir.
Marksuhl–Hünfeld in Hessen. An einem Tisch im Speisesaal des Gasthofs sitzt eine Krankenschwester, das Zeichen des Roten Kreuzes am Arm, und unterhält sich mit zwei Herren, offenbar Ärzten, denn sie sprechen von der Pflege verwundeter Soldaten. Eine Schar Jäger tritt ein, ihre Taschen voll Rebhühner und Hasen. Sie tragen grüne und braune Anzüge und kecke, federgeschmückte Filzhüte, auf der Schulter die Gewehre. Sie sprechen eifrig vom Krieg, diesem Krieg, der alle beschäftigt und alle waffentüchtigen Verwandten nach Westen oder Osten ruft.
Gelnhausen–Hanau. Unter uns fließen die trüben Wassermassen des Mains. Es regnet stark. Die Straßen sind aufgeweicht, aber doch immer gleich gut. Man merkt, daß man sich einer großen Stadt nähert, der Verkehr auf der Straße nimmt zu. Die Menschen wohnen dichter beieinander, und die Telegraphendrähte sammeln sich zu mächtigen Bündeln. Diese stummen Drähte, die doch immer sprechen und mehr wissen als wir — vielleicht durcheilt sie in diesem Augenblick die große Neuigkeit, auf die ganz Deutschland wartet? Wir hofften, sie in Kösen anzutreffen, vielleicht erwartet sie uns in Frankfurt?
17. September. Frankfurt. Der Tag brach in freundlicher Schönheit an, trotzdem schwere Wolken am Himmel segelten. Wir mußten erst zu einer Tankstelle, um Benzin aufzufüllen, und dann zum Immobilen Kraftwagendepot, wo immer alles vorhanden sein muß, was zur Reparatur der Kriegsautomobile erforderlich sein kann. Hier holten wir fünf Reservereifen, die rechts und hinten am Auto festgemacht wurden. Von Bezahlen ist natürlich keine Rede; die Autos gehen ja für Rechnung der Krone.
Endlich geht es weiter, und wir fahren durch Frankfurts lange Straßen und seine westlichen Vorstädte, die fast ganz aus Arbeiterwohnungen bestehen. Man denkt vielleicht, diese Arbeiter sympathisierten nicht mit dem Krieg, den Deutschland für seine Zukunft führt? Weit gefehlt! Sozialdemokratische Arbeiter haben ihren Jungen, die auf den Höfen richtige Schlachten liefern und sich Kluck und Hindenburg nennen, kleine Helme und Holzschwerter geschenkt. — Wiesbaden–Eiserne Hand. In Langenschwalbach stechen die feinen Hotels grell ab von den ernsten Fahnen des Roten Kreuzes und den verwundeten Soldaten, die schon auf dem Wege der Besserung sind und auf Balkons und in den Gärten sitzen, um Luft zu schöpfen. Dann windet sich die Straße jäh zu Höhen empor, wo die Luft klarer ist und gedämpfte Aussichten auf lachende Täler und waldbekleidete Hügel sich öffnen.
Nassau an der Lahn. Bezaubernd schön ist dieses Land, herrlich seine Straßen, majestätisch seine Wälder in ihrer dunkeln, stummen Einsamkeit. Auf dem Gipfel eines Hügels thront eine alte Festung. Das Volk ist freundlich und grüßt und winkt, wohin wir kommen, und ein junges Mädchen wirft eine rote Rose in unser Auto — nicht für uns, vermute ich, sondern als Gruß an ihren Verlobten, der draußen im Felde steht.
Die Lahn entlang — Ems. Wir lassen das Auto in einer Nebenstraße halten und bleiben auf dem Fußsteig entblößten Hauptes stehen, um einen Leichenzug passieren zu sehen. Der Tote ist ein Major, der seinen Wunden erlegen ist. Die Musikkapelle spielt einen langsamen Trauermarsch; zwei Fahnen wehen vor dem schwarzen sarkophagähnlichen Sarg, und diesem folgen die Mitglieder des Emser Kriegervereins, die Kampfgenossen, alle in Zylinder, langem Rock und schwarzer Halsbinde; den Schluß bildet eine Schar verwundeter Soldaten, Rekonvaleszenten, die im Kursaal einquartiert sind. Langsam bewegt sich der feierliche Zug nach dem Bahnhof, denn die Leiche des Majors soll in seine Heimat befördert werden. Nach einiger Zeit kam die Musikkapelle mit den Rekonvaleszenten zurück, aber diesmal spielte sie eine fröhliche, belebte Melodie. Das sei so Sitte bei Militärbegräbnissen, hörte ich; erst die Trauer und die Ehrung des Toten, dann die Rückkehr der Lebenden zum Leben und seinen täglichen Freuden.