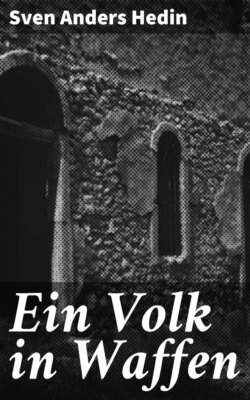Читать книгу Ein Volk in Waffen - Sven Anders Hedin - Страница 8
5. Verwundete und Gefangene.
ОглавлениеDer nächste Weg nach Trier. — »Nach Wittlich?« fragt Rittmeister von Krum in einem Dorf, als er des Wegs nicht sicher ist. — »Nach Paris!« antworten ein paar muntere Mädchen, die uns die Richtung zeigen. Als wir endlich vor dem »Trierischen Hof« in Trier haltmachten, war es bereits dunkel. Wir waren durchnäßt und wollten uns nur trocknen, um dann die Reise nach Luxemburg fortzusetzen. Da aber der unbarmherzige Regen mehr zu- als abnahm und in Luxemburg kein Zimmer zu bekommen war, beschlossen wir, zu bleiben, wo wir waren. Im Restaurant wimmelte es von Offizieren, und auf den Straßen gingen die Soldaten in ihren grauen Mänteln. »Wo ist das Große Hauptquartier?« fragten wir bald hier, bald da. Keiner wußte es. Einige meinten, es sei in Luxemburg, andere, es sei nach Belgien verlegt. Nun, dachten wir, wir werden schon allmählich hinkommen.
Im »Trierischen Hof« waren wirklich noch ein paar Zimmer frei, in denen wir es uns bequem machten. Mein prächtiger Freund Krum erzählte mir, daß in Kriegszeiten alle Offiziere das Recht haben, sich einzuquartieren, wo sie wollen. Ein Zimmer mit Frühstück soll kostenlos zu ihrer Verfügung stehen; Mittagessen und sonstige Beköstigung müssen sie bezahlen. Der Offizier hat nur eine gedruckte Quittung auszufüllen, die er dem Wirt beim Aufbruch statt klingender Münze übergibt. Gegen diese Quittung bekommt der Wirt von der betreffenden Militärbehörde sein Geld, doch nicht die gleiche Summe wie in Friedenszeiten, denn die Taxe wird niedriger angesetzt als unter normalen Verhältnissen. Dasselbe gilt von Pferden, Wagen und allem, was im Krieg gebraucht wird; es wird von besonderen Kommissionen abgeschätzt und mit Quittungen bezahlt. In Trier war kein Auto aufzutreiben, nicht einmal eine Droschke, da alle Pferde fort waren. Als daher unser Wirt ein Telegramm erhielt, sein leicht verwundeter Sohn sei gegen 3 Uhr nachts zu erwarten, konnte er kein Fahrzeug auftreiben, um ihn abzuholen. Unser Automobil durften wir ihm nicht leihen; schließlich fand er das Auto eines Arztes und traf seinen Sohn bei ganz gutem Humor.
In besserem Gang waren die Straßenbahnen, und einer solchen bedienten wir uns, als wir am Abend die Horn-Kaserne aufsuchten, in der sonst das Infanterieregiment Nr. 29 von Horn liegt. Jetzt war das ganze Regiment im Feld und die Kaserne ein Lazarett. Sie kann tausend Soldaten aufnehmen, aber nur fünfhundert Verwundete, denn diese brauchen mehr Raum und Platz für Ärzte und Krankenwärter; außerdem werden mehrere Zimmer als Operationssäle, Baderäume usw. in Anspruch genommen. Bei unserem Besuch waren nur 220 Plätze belegt; 150 von ihnen hatten Franzosen inne. Sechs Ärzte und ein Oberarzt, dazu eine ganze Schar von Rote-Kreuz-Schwestern pflegten die Verwundeten.
Mit einigen jungen Ärzten schritten wir durch einen langen Korridor und besahen zunächst einige Operationssäle, die beim Ausbruch des Krieges in aller Eile hergerichtet und dann, soweit möglich, ganz modern ausgerüstet worden waren. Die Operationstische standen in der Mitte der Zimmer, die Wasserleitungen, Becken, Apparate, eine Masse chirurgischer Instrumente, alles in bester Ordnung. Wände und Boden dieser Säle waren mit Ölfarbe gestrichen. Es wurden hier im Durchschnitt fünfzehn Operationen am Tage vorgenommen. Ähnlich waren mehrere andere Kasernen in Trier in Krankenhäuser umgewandelt worden.
Dann betraten wir einen großen Saal mit deutschen Verwundeten. Alle waren vergnügt und munter, befanden sich vortrefflich und konnten sich keine sorgsamere Pflege denken, als sie in diesem Lazarett erhielten. Nur wurde ihnen die Zeit allzu lang; sie mußten immer an ihre Kameraden in den Schützengräben denken, sehnten sich in den Krieg zurück und hofften, bald wieder auf die Beine zu kommen, d. h. diejenigen, die wußten, daß sie nicht Krüppel fürs Leben waren!
In einem andern Saal wurden französische Soldaten gepflegt. Auch hier unterhielten wir uns mit einigen Patienten. Sie waren alle höflich und mitteilsam, ließen aber den fröhlichen Lebensmut der Deutschen vermissen, was ja auch kein Wunder war, da sie sich in Feindesland befanden und von aller Verbindung mit der Heimat abgeschnitten waren. Einer von ihnen war bei Rossignol verwundet worden, wie Leutnant Verrier, den er aber nicht kannte. Er hatte einen Schuß durch die linke Hand und durch das linke Bein, das der Arzt hatte amputieren müssen. Bei seiner Verwundung hatte er die Kraft und die Geistesgegenwart gehabt, bis zu einem Graben zu kriechen, wo er vor Wind und Wetter und Feuer geschützt war; einige Fetzen aus seinem Mantel hatte er um seine Wunden gewickelt. Tags darauf fanden ihn deutsche Sanitätssoldaten, legten ihm den ersten ordentlichen Verband an und trugen ihn ins nächste Feldlazarett, von wo er vor kurzem mit der Eisenbahn ins Trierer Kriegslazarett transportiert worden war.
Der andere Soldat hatte zwei Nächte auf dem Feld gelegen und unsagbar an Durst gelitten. Einige Male hatten Deutsche, die an ihm vorüberkamen, ihm Wasser und Schokolade gegeben. Schließlich hatte man Gelegenheit gefunden, ihn in das Verwundetenlager zu bringen. Wie sein Kamerad sprach er seine Dankbarkeit aus über die Behandlung, die ihm in Trier zuteil wurde, und aus mehreren Betten in der Nachbarschaft erscholl Zustimmung. Die beiden deutschen Ärzte, die uns begleiteten, erzählten, die französischen Verwundeten wollten gewöhnlich das Lazarett nicht verlassen, da sie wie einfache Gefangene behandelt werden, sobald sie wieder auf die Beine gekommen sind. Diese Auffassung ist ganz natürlich und wird sicher von allen Verwundeten geteilt, welcher Nation sie auch angehören mögen, denn es ist behaglicher, in seinem warmen Bett zu liegen und auf alle Weise gepflegt zu werden, als in einer Baracke zu wohnen oder in einem Gefangenenlager inmitten von Senegalnegern, Marokkanern und Indern!
Schließlich kamen wir in ein Zimmer, in dem drei französische Offiziere lagen. Einer von ihnen, der einen Lungenschuß hatte, schlief gut und ließ sich durch unsere Unterhaltung nicht stören. Der andere hatte einen gefährlicheren Lungenschuß, wurde immer von einem bösen Husten geplagt, der ihm bei jedem Anfall den Kopf vor- und rückwärts warf. Sein Zustand wurde für kritisch angesehen; auch wenn man die Adresse seiner Angehörigen gewußt hätte, wäre es keine Freude gewesen, sie von seinem Befinden zu unterrichten. Der dritte, ein großer, wohlbeleibter Kapitän, hatte mehrere Jahre im südlichsten Marokko Dienste getan und war an Kämpfe mit den Tuaregs in der Sahara gewöhnt. Aber dieser Krieg war doch etwas ganz anderes. »Terrible!« Von seiner afrikanischen Garnison her war er in diesen furchtbaren Krieg gerufen worden. In einem Gefecht in Belgien hatte eine Kugel ihm den rechten Fuß zerschmettert, während eine andere ihm ein paar Finger abriß. Er meinte sich zu erinnern, daß ihm bereits auf dem Schlachtfeld seine Wunden von deutschen Sanitätssoldaten oder Ärzten sorgsam verbunden worden seien; dann war in einem Feldlazarett sein Verband erneuert worden. Als verhältnismäßig Leichtverwundeten hatte man ihn nach Luxemburg gebracht und jetzt nach Trier. Wahrscheinlich wußte er, daß er, sobald er geheilt war, mit all den Vorteilen seines Ranges in Gefangenschaft gehalten und außerdem die Hälfte des Soldes bekommen würde, den er in seiner Heimat bezog. Nun lag er da, der Kapitän mit den freundlichen Augen, der Adlernase und dem Vollbart, und versicherte jovial und gutmütig, daß er über absolut nichts zu klagen habe, nur über das Geschick, das ihm versage, noch weiter für sein Land zu kämpfen. Aber er trug sein hartes Schicksal als Philosoph und als Mann. Ein Lächeln umschwebte seine Lippen, und er war dankbar für die Hilfe, die er empfing, und für das Interesse, das ihm die unbekannten Gäste erwiesen.
Die jungen Ärzte, die uns führten, berichteten, daß die deutschen Soldaten sich immer und ohne Ausnahme an die Front zurücksehnten, soweit ihr Zustand solche Gedanken nicht einfach unmöglich machte. Bei den Franzosen sei die Stimmung eine andere: »Alles — nur nicht zurück an die Front!« Auch das ist aus psychologischen Gründen ganz natürlich. Nichts drückt den Soldaten so nieder und demoralisiert ihn so, wie eben die Gefangenschaft. Er spielt die Rolle des Schwächeren, er lebt ausschließlich von der Gnade anderer, seine Kraft ist erschöpft, seine Initiative gelähmt und seine Kampflust vergebens. Da sagt er, um persönliche Vorteile zu gewinnen und aus einer an und für sich widrigen Situation das Beste herauszuschlagen, manches, was er jenseits der Feuerlinie niemals gesagt hätte. Deshalb würde man jedem Heere unrecht tun, wenn man seinen Kampfwert nach den Aussagen der Gefangenen beurteilen wollte.
Hierin findet man vielleicht auch die Erklärung für das Faktum, daß in dem Trierer Lazarett, wenigstens in der Horn-Kaserne, die Sterblichkeit unter den Franzosen viel größer war als unter den Deutschen. Die Wunden der Deutschen heilen leichter und schneller als die der Franzosen, und das psychologische Moment ist dabei von unverkennbarer Wirkung. Der deutsche Soldat kann Zeitungen lesen und mit seinen Angehörigen Briefe wechseln. Der französische Soldat ist ganz und gar von der äußeren Welt abgeschnitten, ein Nachteil, von dem bis Ende September auch die in Frankreich gefangenen Deutschen betroffen wurden. (Vergl. oben S. 18.) Und ein Gefangener, der nichts von dem Gang des Kampfes erfährt, leidet doppelt unter dem Eindruck, besiegt zu sein. Diese trostlosen Gedanken wirken auf seinen Zustand zurück und vermindern seine Widerstandskraft, er wird Fatalist und vermag nicht gegen den Tod anzukämpfen. Er gibt alles verloren und hofft nicht einmal auf Wiederherstellung und Heimkehr.