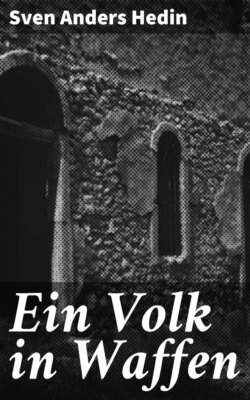Читать книгу Ein Volk in Waffen - Sven Anders Hedin - Страница 6
3. Ein Franzose im Lazarett zu Ems.
ОглавлениеIm Kurhaus mit seinen vielen prächtigen Zimmern werden achtzig Verwundete gepflegt, und man erwartete mehr. Viele der Schwerverwundeten lagen in ihren Betten; wer sich bewegen konnte, saß auf den Altanen, genoß die frische Luft und sehnte sich, das versicherte man mir überall, an die Front zurück.
Auch ein junger französischer Leutnant hatte, schwer verwundet, im Kurhaus Unterkunft gefunden. Mit welcher schändlichen Grausamkeit sollten nach den Meldungen der englischen Presse die Deutschen ihre französischen Gefangenen behandeln! Ich konnte daher dem Wunsche nicht widerstehen, mich zu erkundigen, was der Franzose selbst darüber zu sagen hatte. An seinem Zimmer war nichts auszusetzen, es lag unmittelbar gegenüber einem der sechs kleinen Räume, in denen König Wilhelm I. 1867–1887 Jahr für Jahr einige Zeit zubrachte. Der Verwundete wurde von einem deutschen Arzt gepflegt, der die besten Hoffnungen für seine Wiederherstellung hatte, und von zwei barmherzigen Schwestern, von denen die eine französisch sprach. Auf meine Frage, ob er mit der Pflege, die ihm in Deutschland zuteil wurde, zufrieden sei, antwortete der Leutnant aus überzeugtem Herzen heraus mit Ja!
Er lag in einem großen Bett, und sein Gesicht war kaum weniger bleich als die reinen weißen Bettlaken, aber er sah gut aus mit seinem kurzgeschorenen Haar, der edlen Nase, dem schwachen Schnurrbart über den feingeschnittenen Lippen, und seine schwarzen französischen Augen erzählten von Lebenslust und scharfem Verstand. Er berichtete, er sei im Juni von Guinea heimgekehrt und habe gerade vor der Hochzeit gestanden, als der Krieg ausbrach und ihn von der Braut und den Eltern wegriß. In dem Gefecht bei Rossignol in Belgien traf ihn die Kugel. Es war ein entsetzlicher Tag. Er kämpfte im Feuer der Granaten, Maschinen- und Handgewehre. Die Kugel drang ihm durch Knie und Unterschenkel. Er fiel und blieb die ganze Nacht auf dem Schlachtfeld liegen. Am nächsten Tag las ihn die deutsche Ambulanz auf, und er wurde etappenweise bis Ems befördert. Ende August war Kaiser Wilhelm in Ems gewesen, und als er erfuhr, daß ein verwundeter Franzose da sei, hatte er ihn besucht. Der Leutnant erzählte, der Kaiser habe sich in ausgezeichnetem Französisch nach seiner Verwundung und seinem Befinden erkundigt. Ich sagte ihm, ich würde wahrscheinlich binnen kurzem den Kaiser treffen und dann Seiner Majestät mitteilen, welchen Eindruck der hohe Besuch auf den Verwundeten gemacht habe. Als ich mich später des freiwillig übernommenen Auftrags entledigte, zeigte sich, daß der Kaiser sich sehr wohl des französischen Leutnants erinnerte und sich über seine voraussichtliche Genesung freute.
Feldküche.
Feldbarbier.
Schließlich fragte ich den Kranken, ob ich ihm einen Dienst erweisen könnte, soweit das von den deutschen Behörden erlaubt sei. Er schien auf diese Frage gewartet zu haben. Tag und Nacht hatte er über dem einzigen Gedanken gebrütet: wie können meine Eltern und meine Braut erfahren, daß ich lebe und es mir gut geht? ich bin ja in Feindesland und habe keine Postgelegenheit! Ich bat ihn um seine Adresse, und er schrieb in mein Tagebuch: Monsieur Verrier-Cachet, Horticulteur, 52 Rue du Quinconce, Angers, Marne et Loire. Bald darauf saß ich an einem Schreibtisch, berichtete auf offener Postkarte und in deutscher Sprache das Schicksal des Leutnants Verrier und schickte die Karte an meine Familie in Stockholm, die durch Vermittlung des französischen Gesandten die Nachricht an obenstehende Adresse befördern sollte. Und daß die Nachricht ans Ziel kam und große Freude bereitete, das weiß ich; denn ich habe später aus Verriers Elternhaus die herzlichsten Grüße erhalten.
Kleines Biwak.
Feldpostbriefe.
Oft bin ich seither schweren und zögernden Schritts durch Feld- und Kriegslazarette gewandert, besonders durch die Säle, in denen verwundete Franzosen, Engländer und Belgier lagen und die langsam verrinnenden Stunden zählten. Wie leicht hätte ich, der ich meine Freiheit und gesunde Glieder hatte, Postkarten in die Welt hinausschicken und sehnsüchtig Harrende von ihrer Unruhe erlösen können! Nichts ist so peinigend und schwer zu tragen wie die Ungewißheit über das Schicksal derer, die man liebt. Wenn in der Verlustliste der Name eines Sohnes, Bruders oder Ehemanns unter den Vermißten steht, ist das Leid für die Daheimgebliebenen größer, als wenn er gefallen wäre. Zwar besteht noch die Hoffnung, daß er am Leben sei, aber sie wird von unheimlichen Vorstellungen verdrängt: man sieht ihn verwundet, verblutend, einsam und verlassen in Nacht, Kälte und Durst. Oft habe ich mir Vorwürfe gemacht, daß ich solche Postkarten nicht schrieb. Aber ich tröstete mich damit, daß ich einmal kein Recht dazu hatte, mich in die Bestimmungen hineinzumischen, die die deutschen Militärbehörden über die Verbindung Verwundeter mit ihrer Heimat getroffen hatten, und dann waren ihrer auch allzu viele. Immer sah ich schon am Abend des Tages ein, daß das Wirken als barmherziger Bruder eine hoffnungslose Aufgabe gewesen wäre. Übrigens wurde vom Beginn des Oktober an allen Gefangenen, also auch den Verwundeten, der Briefwechsel mit ihrer Heimat gestattet, nachdem die französische Regierung den Grundsatz der Gegenseitigkeit anerkannt hatte. —
Wir betrachteten noch den Denkstein, der an die bedeutungsvolle, feste Antwort erinnert, die König Wilhelm am 13. Juli 1870, 9 Uhr 10 Minuten vormittags dem französischen Minister Benedetti gab, jene Antwort, die der Anlaß zum Französisch-Deutschen Kriege wurde. Und nun nach 44 Jahren standen wir wieder am selben Fleck! Nun war der Revanchegedanke zum Ausbruch reif geworden — soweit nicht andere böse Mächte Frankreichs Sehnsucht nach Rache für Elsaß-Lothringen benutzt haben, um selber daraus Vorteil zu ziehen und den Aufschwung aufzuhalten, den Deutschland inzwischen genommen hat. Denn ich habe genaue Kenner versichern hören, daß der Revanchegedanke in weiten Kreisen des französischen Volkes mit den Jahren im Abnehmen begriffen war. Eine nahe Zukunft wird entscheiden, wen die Verantwortung dafür trifft.