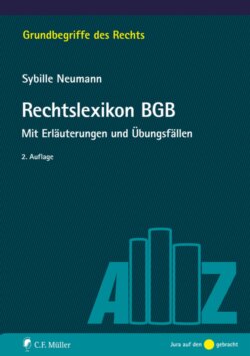Читать книгу Rechtslexikon BGB - Sybille Neumann - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеA › Anfechtung §§ 119 ff. BGB › Erläuterungen
Erläuterungen
25
Die Anfechtung ist ein einseitiges Rechtsgeschäft (Rechtsgeschäft) mit empfangsbedürftiger Willenserklärung (Willenserklärung). Sie ist zudem ein Gestaltungsrecht (Gestaltungsrecht).
26
Es gibt unterschiedliche Gründe, die zur Anfechtung einer Willenserklärung berechtigen. So ist eine Anfechtung möglich, wenn ein Irrtum beim Erklärenden vorlag oder der Erklärende seine Willenserklärung abgab, weil ihm gedroht oder er arglistig getäuscht wurde. Eine wirksame Anfechtung setzt daher stets einen Anfechtungsgrund voraus. Daneben sind eine Anfechtungserklärung und die Einhaltung der Anfechtungsfrist, innerhalb der die Anfechtungserklärung abgegeben werden muss, erforderlich.
27
Die Anfechtbarkeit einer Willenserklärung hat zunächst keinerlei Auswirkung auf ihre Wirksamkeit. Erst wenn derjenige, der einen Anfechtungsgrund hat, durch eine entsprechende Willenserklärung auch die Anfechtung rechtzeitig erklärt, hat dies die Unwirksamkeit seiner Willenserklärung (Willenserklärung) zur Folge. Unternimmt er nichts, so ist die Willenserklärung und das durch sie getätigte Rechtsgeschäft (Rechtsgeschäft) trotz der Anfechtbarkeit weiterhin wirksam.
28
Kann die Willenserklärung angefochten werden, weil der Anfechtungsberechtigte einem Irrtum unterlag (§§ 119, 120, 121, 122, 142, 143 BGB), so ist zu beachten, dass nicht jeder Irrtum die Berechtigung zur Anfechtung nach sich zieht.
Beispiel:
Kauft Elias einen Cut, weil er demnächst heiraten möchte und überwirft er sich wenig später mit seiner Verlobten Marie, so stellt dies keinen Anfechtungsgrund dar, denn es handelt sich hier um einen rechtlich nicht relevanten Motivirrtum.
Rechtlich relevant ist dagegen der sog. Inhaltsirrtum, der immer dann vorliegt, wenn der Erklärende den Inhalt seiner Erklärung selbst falsch versteht: So wenn dieser z. B. eine Software bestellt, weil er denkt, dass ein entsprechender Update-Service hiervon erfasst ist. Rechtlich relevant ist auch der Erklärungsirrtum. Dieser liegt vor allen Dingen dann vor, wenn der Erklärende sich verspricht oder verschreibt.
Beispiel:
Wenn Valentina Vollst, Inhaberin einer Boutique, sich beim Gespräch mit einer Kundin verspricht, in dem sie sagt, dass das Kleid 9 € koste, obwohl der richtige Preis 90 € lautet.
Ebenfalls rechtlich von Bedeutung ist der sog. Eigenschaftsirrtum. Dieser liegt z. B. dann vor, wenn sich der Erklärende über eine verkehrswesentliche, also besonders wichtige Eigenschaft der Sache selbst, irrt. Der Eigenschaftsirrtum kann sich auch auf eine Person beziehen.
Beispiel:
Der Unternehmer Thomas Maler möchte einen neuen Buchhalter einstellen, weiß aber nicht, dass dieser wegen Veruntreuung vorbestraft ist.
Zur Anfechtung berechtigt ist auch derjenige, der eine Willensklärung abgegeben hat, weil er getäuscht oder ihm gedroht (§§ 123, 124, 142, 143 BGB) wurde.
29
Immer zu beachten ist jedoch die alte Regel: Auslegung (Auslegung) geht vor Anfechtung! So ging im „Haakjöringsköd-Fall“[1] das Reichsgericht von einem Kaufvertrag (Kaufvertrag) über Walfleisch aus, da beide Parteien bei Vertragsschluss (Vertrag) Walfleisch und nicht Haifleisch (Haakjöringsköd bedeutet übersetzt Haifleisch) als Kaufgegenstand betrachteten. Hier wurde nicht der Kaufvertrag als anfechtbar angesehen, sondern vielmehr der Vertrag im Sinne des übereinstimmenden Parteiwillens ausgelegt.
30
Übungsfall Anfechtung
Herr Vollmer verkaufte Frau Keller im April 2019 einen gebrauchten Audi A3 für 3.000 €. Bei den Vertragsverhandlungen verschwieg Herr Vollmer bewusst, dass das Fahrzeug vor einigen Jahren einen schweren Unfall hatte. Im Juni 2019 erfuhr Frau Keller von ihrer Werkstatt, dass sie einen Unfallwagen gekauft hat und verweigert die bisher noch nicht erfolgte Zahlung des Kaufpreises. Kann Herr Vollmer von Frau Keller die Zahlung von 3.000 € verlangen?
31
Lösung
Herr Vollmer könnte gegen Frau Keller einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 3.000 EUR gem. § 433 Abs. 2 BGB haben. Voraussetzung hierfür ist, dass zwischen V und K ein wirksamer Kaufvertrag gem. § 433 BGB zustande gekommen ist. Dies ist hier der Fall. Jedoch könnte im vorliegenden Fall der Kaufvertrag gem. § 142 Abs. 1 BGB nichtig sein.
Voraussetzung hierfür wäre, dass der Vertrag wirksam angefochten werden könnte. Hierzu müsste zunächst ein Anfechtungsgrund gegeben sein. Dieser könnte hier in der arglistigen Täuschung gem. § 123 Abs. 1 1. Alt. BGB liegen. Das heißt, es müsste zunächst eine Täuschungshandlung auf Seiten des Herrn Vollmer vorliegen. Durch positives Tun hat er Frau Keller nicht getäuscht. Er hat auch keine wahre Tatsache entstellt oder unterdrückt. Hier könnte jedoch ein Verschweigen trotz Aufklärungspflicht in Frage kommen. Das Auto hat einen schweren Unfall erlitten. Einen solchen schweren Unfall hat der Verkäufer auch ohne besondere Aufforderung des Käufers zu erwähnen. Dies hat Herr Vollmer nicht getan. Folglich hat er Frau Keller getäuscht. Dies war auch widerrechtlich, da es hierfür keinen Rechtfertigungsgrund gab. Fraglich ist, ob Herr Vollmer auch arglistig, d. h. vorsätzlich mit Wissen und Wollen gehandelt hat. Herr Vollmer wusste, dass der Wagen einen Unfall erlitten hat. Durch sein Schweigen trotz Aufklärungspflicht wollte er Frau Keller gerade dazu bewegen, das Auto zu kaufen, sie also zur Abgabe einer entsprechenden Willenserklärung bestimmen. Bei Frau Keller wurde durch das Verschweigen ein Irrtum herbeigeführt. Sie ging nämlich davon aus, dass der Wagen unfallfrei sei. Dieser Irrtum war auch kausal für die Annahme des Antrags von Herrn Vollmer. Hätte sie von dem Unfall gewusst, hätte sie den Kaufvertrag mit ihm nicht abgeschlossen; zumindest nicht zu den Bedingungen.
Somit liegt eine arglistige Täuschung gem. § 123 Abs. 1 1. Alt. BGB vor.
Des Weiteren ist erforderlich, dass eine Anfechtungserklärung gem. § 143 Abs. 1 BGB erfolgte. Ausdrücklich hat Frau Keller den Kaufvertrag nicht angefochten, jedoch konkludent durch ihre Weigerung den Kaufpreis zu zahlen.
Zudem ist die Anfechtungsfrist gem. § 124 BGB einzuhalten. Diese beträgt ein Jahr beginnend mit der Entdeckung der arglistigen Täuschung. Da Frau Keller die Anfechtung sofort nach Entdeckung der Täuschung erklärt, ist diese Voraussetzung ebenfalls erfüllt. Die Willenserklärung von Frau Keller ist wirksam angefochten worden; der Kaufvertrag zwischen Herrn Vollmer und Frau Keller hat somit keinen Bestand. Somit kann Herr Vollmer von Frau Keller nicht die Zahlung von 3.000 € gem. § 433 Abs. 2 BGB verlangen.
Weiterführende Literatur
Stefan Arnold, Die arglistige Täuschung im BGB, JuS 2013, S. 865-870. Kai Büchler, Die Anfechtungsgründe des § 123 BGB, JuS 2009, S. 976-980. Stephan Lorenz, Grundwissen – Zivilrecht: Willensmängel, JuS 2012, S. 490-493. Hans-Joachim Musielak, Die Anfechtung einer Willenserklärung wegen Irrtums, JuS 2014, S. 491-495; S. 583-589