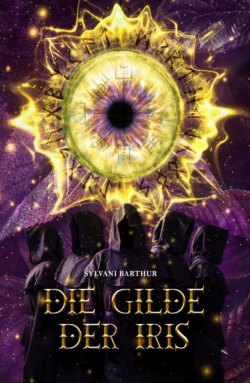Читать книгу Die Gilde der Iris - Sylvani Barthur - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKAPITEL 2
Als ich aufwachte, hatte ich ein Gefühl in der Magengegend, als würde jemand mit einem Löffel darin herumrühren. Zum Glück hielt das nicht lange an; nachdem ich aufgestanden war, verging es abrupt. Ich hatte es schnell vergessen, doch als ich nach der fünften Stunde den Physikraum verließ, überfiel es mich wieder. Und dieses Mal hatte es einen Grund.
Der Grund stand ein paar Meter vor mir in voller Größe auf dem langen Flur, und legte Sachen in einen Spind, der wohl seiner war. Er lächelte mir zu und ich schaute sofort weg. Das durfte doch nicht wahr sein! Das hatte er also gestern damit gemeint, dass wir uns „spätestens“ nächste Woche sehen würden … Der extrem gesprächige Perfektionist aus meinem Sprachkurs ging offensichtlich auf meine Schule.
„Hallo Elisa.“ Er begrüßte mich mit einem hinreißenden Lächeln, nachdem er den Spind geschlossen hatte und auf mich zukam. „So schnell sieht man sich wieder.“
„Ja, leider“, brummelte ich vor mich hin.
Ich bemerkte, wie ein paar meiner Mitschülerinnen hinter mir tuschelten. Konnte er mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich sah schon vor mir, wie Dana, Conny und die anderen aus der Clique sich das Maul über mich zerrissen. Und ich konnte das dann wieder ausbaden. Mit zusammengekniffenen Lippen versuchte ich, in Erwartung der mir bevorstehenden Beleidigungen, meinen Spind aufzuschließen, der blöderweise fast direkt neben dem von Kris lag. Natürlich streikte der Schlüssel – was auch sonst?
Kris stand mit verschränkten Armen und einem Grinsen im Gesicht neben mir und beobachtete meine Anstrengungen, die dämliche Tür zu öffnen. Am liebsten hätte ich ihn erwürgt.
„Soll ich dir helfen?“, fragte er selbstgefällig. „Für mich ist das kein Problem.“
„Nein.“ Ich warf ihm einen wütenden Blick zu. „Das schaffe ich schon allein.“
Ich schob die Brille nach oben, die mir die Nase heruntergerutscht war, und zog den Schlüssel aus der Schranktür. Dann wollte ich ihn so ins Schloss drücken, dass er sich nicht wieder verkantete.
„Sieht nicht danach aus“, sagte er.
„Kannst du nicht … jemand anderen nerven?“ Ich versuchte voller Konzentration, das Schloss zu öffnen, als ich wie vom Blitz getroffen zusammenzuckte.
Kris hatte meine Hand mit seiner umschlossen und drehte sie langsam nach links, bis die Tür aufsprang. „War doch ganz leicht, oder?“
Er stand so dicht hinter mir, dass ich seinen Atem im Nacken spürte. Ruckartig zog ich meine Hand weg und machte einen Schritt zur Seite.
„Ich habe dich nicht um Hilfe gebeten“, presste ich hervor.
Was bildete dieser Kerl sich ein? Ich schnappte mir das Heft, das ich brauchte, und schlug die Tür zu. Dann drehte mich um und eilte in Richtung Klassenraum.
„Bis später, Elisa“, rief er mir nach, und ich hätte ihm am liebsten einen Vogel gezeigt.
Im Klassenraum erwartete mich dann genau das, was ich befürchtet hatte: Der Spießrutenlauf ging los. Es waren noch ein paar Minuten Zeit bis zum Unterrichtsbeginn und ich hatte die Wahl zwischen Kris auf dem Flur und Danas Clique im Zimmer. Ich wählte das kleinere Übel und setzte mich den höhnischen und provozierenden Gesprächen aus, die Dana und die anderen extra laut führten, damit ich auch alles mitbekam.
Meistens blendete ich das aus, indem ich im Kopf meine Lieblingssongs sang oder versuchte, einen schwierigen Satz ins Norwegische zu übersetzen. Aber heute gab ich mir die volle Dröhnung und hörte mit gesenktem Kopf zu. Das lenkte mich wenigstens von den widersprüchlichen Gedanken um Kris ab.
„Ich war letzten Samstag mit meinen Eltern shoppen“, rief Conny begeistert. „Sie haben mir alle Klamotten gekauft, die ich wollte. Und wie immer nur das Modernste.“ Sie stand auf und drehte eine Pirouette in meine Richtung, damit die anderen – und vor allem ich – ihr neustes Outfit bewundern konnten.
Ich schaute demonstrativ in mein Biologiebuch und verdrehte die Augen. Ja, das war das, worum sich die kleine Welt der meisten Mädchen drehte, die mit mir in eine Klasse gingen – Klamotten.
Mir war so etwas überhaupt nicht wichtig. Es reichten Jeans und Pulli und meine geliebte Kapuzenjacke. Mehr brauchte ich nicht.
„Und wir waren in dem Elektronikmarkt, der erst neu eröffnet hat. Dort hab ich mir das neuste Handy kaufen lassen.“ Dana blickte kurz zu mir, um sich zu vergewissern, dass ich zuhörte. „Hier schaut mal“, sagte sie und hielt das Teil hoch, das so groß war wie ein Frühstücksteller und in einer schreiend pinken Hülle steckte. „Mein Vater ist extra mit uns dorthin gefahren, obwohl der Markt außerhalb der Stadt liegt. Ihm ist absolut nichts zu aufwendig oder zu teuer, wenn es um mich geht, seine leibliche Tochter“, betonte sie laut.
Okay, jetzt war es wieder so weit. Nun kamen die gehässigen Bemerkungen, die über die üblichen Beleidigungen zu meinen Klamotten hinausgingen. Scheinbar machte ihnen das heute besonders viel Spaß, weil sich dieser neue, supercoole Junge für mich interessierte, was sie offenbar nicht begreifen konnten – ich übrigens auch nicht.
Sie weiteten das Thema aus und ich entschied, dass ich genug gedemütigt worden war. In meinem Kopf sang ich lautstark „After the Rain“ von Nickelback, um nichts mehr davon hören zu müssen. Das klappte auch ganz gut, bis die bohrenden Gedanken mich einholten, die sich seit Danas Äußerung in meinem Gehirn eingenistet hatten. Es stimmte, alle hatten leibliche Eltern … alle außer mir. Offenbar wussten sie ganz genau, dass sie damit meinen wunden Punkt trafen, obwohl ich das ihnen gegenüber nie zugeben würde.
Ich war adoptiert worden, aber das wusste ich erst seit ein paar Jahren. Damals war ich elf gewesen und wir mussten im Deutschunterricht einen Aufsatz über die Berufe unserer Eltern schreiben. Wir sollten sie kurz vorstellen und Beruf und Alter erwähnen. Ich hatte mich vorher nie für das Alter meiner Mutter interessiert, aber damals war mir aufgefallen, dass irgendetwas nicht stimmen konnte, denn sie war 24 Jahre alt gewesen. Das hätte bedeutet, dass sie mich bekommen hatte, als sie 13 war.
Nicht, dass das unmöglich gewesen wäre, aber es war auch nicht unbedingt der Standard. Außerdem konnte ich mir das bei meiner Mutter, die meistens sehr ernst und total verantwortungsbewusst war, absolut nicht vorstellen.
Als ich sie an jenem Tag beim Abwasch nach dem Abendessen darauf ansprach, fiel ihr ein Teller aus der Hand. Sie wurde kreidebleich und hielt sich an der Küchenspüle fest. Als sie sich wieder gefangen hatte, nahm sie mich beiseite und wir setzten uns an den Tisch. Dann erfuhr ich die ungeheuerliche Geschichte, die meine sein sollte und mich zutiefst erschütterte.
Es war an einem trüben Herbsttag gewesen und meine leiblichen Eltern waren mit mir zusammen nach der Arbeit zum Einkaufen gefahren. Damals wohnten wir in einem kleinen Dorf nicht weit von der Stadt entfernt. Ein betrunkener Autofahrer rammte unser Auto in einem Waldstück frontal und es wurde von der Straße in den Wald geschleudert, wo es gegen einen Baum krachte und total demoliert wurde. Meine Eltern kamen beide ums Leben, nur ich hatte leicht verletzt überlebt. Mein Kopf hatte wohl einiges abbekommen, denn ich konnte mich an den Unfall und die Zeit davor nicht mehr erinnern, obwohl ich bereits sechs Jahre alt gewesen war.
Meine Adoptivmutter war eine sehr gute Freundin meiner leiblichen Mutter gewesen. Sie hatten sich bei der Arbeit kennengelernt, als meine leibliche Mutter die Aufgabe von Saras Mentorin übernommen hatte. Zwischen den beiden entwickelte sich eine wunderbare Freundschaft, die so weit ging, dass Sara meine Patin geworden war.
Nach dem Tod meiner Eltern hatte sie mich adoptiert und seitdem lebte ich bei ihr und hatte immer angenommen, dass sie meine richtige Mutter war. Wir waren uns nah, so wie Mutter und Tochter eben, und ich hatte niemals daran gezweifelt, dass sie meine echte Mutter war – bis zu dem Tag, an dem für mich eine Welt zusammenbrach.
Die Zeit danach war schwer, für uns beide. Ich war zutiefst getroffen, weil sie mich belogen hatte, und wollte nichts mehr von ihr wissen. Sara versuchte alles, um mir wieder näher zu kommen, aber ich verletzte sie nur. Sie war todunglücklich und litt unheimlich darunter, dass ich sie ablehnte. Es dauerte fast ein Jahr, bis unser Verhältnis halbwegs normal wurde. Wir waren beide von Natur aus stur und das machte es nicht leichter. Doch Saras Beharrlichkeit und ihre unendliche Geduld hatten es letztlich geschafft, dass wir wieder zueinanderfanden. Ich sprach sie seitdem zwar noch mit „Mama“ an, aber für mich nannte ich sie nur Sara.
Irgendwie fühlte ich mich auch schuldig an dem Unfall, der meine Eltern getötet hatte. Ich hatte immer wieder Albträume, in denen jedes Mal die gleiche Szene auftauchte: Meist stand ich als Beobachterin vor dem Auto und erblickte zwei blutüberströmte Menschen, offensichtlich tot, in dem total verbeulten Fahrzeug sitzen. Plötzlich öffneten sie ihre Augen und an dieser Stelle wachte ich jedes Mal schweißgebadet auf. So lief es meistens ab und diese Schuldgefühle begleiteten mich bis heute. Sara hatte lange versucht, mich da rauszuholen, aber irgendwann hatte sie es aufgegeben und wir waren zur Tagesordnung übergegangen.
In der Schule war die ganze Sache kurze Zeit später ebenfalls herumgegangen, keine Ahnung, wie sie davon erfahren hatten. Doch von da an hatte ich es auch dort schwer. Meine lieben Mitschülerinnen hatten endlich jemanden gefunden, auf dem sie herumhacken konnten, wenn ihnen danach war. Aber das war mir irgendwann egal, ich kam ganz gut alleine klar.
Die Stimmen hinter mir verstummten, als der Lehrer eintrat und der Biologieunterricht losging. Für den Moment war ich erlöst. Nur gut, dass diese Stunde die Letzte für heute war.
Später rief Kris hinter mir meinen Namen, als ich zum Ausgang des Schulgebäudes lief, doch ich drehte mich nicht um. Ich hatte echt keine Lust, mir wieder hirnloses Gelaber anzuhören von diesem supercoolen Möchtegern. Es reichte mir, wenn ich das nächste Mal beim Norwegischkurs neben ihm sitzen musste.