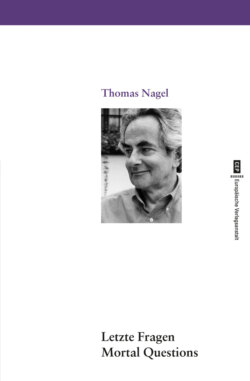Читать книгу Letzte Fragen - Thomas Nagel - Страница 10
I
ОглавлениеVergegenwärtigen wir uns ein paar typische Reflexionen. Oft hört man, daß nicht das Mindeste dessen, was wir so alles tun, in einer Million Jahren nicht egal sein wird. Wenn dem so ist, läßt sich der Spieß aber doch ebenso leicht umdrehen, und dann ist auch nicht das Mindeste dessen, was in einer Million Jahren sein wird, heute von Bedeutung. Unter anderem wäre es dann insbesondere auch egal, daß alles von dem, was wir heute tun, dereinst egal sein wird. Ja, und selbst wenn es so wäre, daß unser heutiges Tun jemandem in einer Million Jahren tatsächlich nicht egal Sein würde? Dann bliebe noch immer die Frage, warum hierdurch etwas, das uns heute beschäftigt, davor bewahrt würde, absurd zu sein: Was könnte es uns denn nützen, wenn etwas davon in einer Million Jahren für jemanden nicht egal wäre, wenn noch nicht einmal der Tatbestand, daß es heute nicht egal ist, ausreichte, unser Tun vor Absurdität zu retten?
Die Frage, ob etwas, das wir heute tun, in einer Million Jahren bedeutend ist, markiert nur dann die entscheidende Differenz, wenn seine Bedeutsamkeit in einer Million Jahren von seiner Bedeutsamkeit schlechthin abhängt. Stellt man jedoch von vornherein in Abrede, daß irgend etwas dessen, was sich in unseren Tagen zuträgt, in einer Million Jahren von Bedeutung ist, begeht man eine Petitio principii gegenüber dieser zweiten Frage: Man verneint sie immer schon. Denn in diesem Sinne kann man gar nicht sicher sein, daß es in einer Million Jahren egal ist, ob (zum Beispiel) heute jemand glücklich oder unglücklich ist, wenn man nicht immer schon sicher ist, daß es schlechthin egal ist.
Was wir vorbringen, wenn wir anderen die Absurdität unseres Lebens vor Augen führen wollen, kann häufig auch mit Raum oder Zeit zu tun haben: Schließlich sind wir doch alle nur winzige Staubkörnchen in den unendlichen Weiten des Alls; die Spanne unseres Lebens ist doch selbst nach erdgeschichtlichen, ganz zu schweigen von kosmischen Maßstäben nicht mehr als ein bloßer Augenblick; ja, wir werden doch alle jeden Moment tot sein. Aber natürlich kann keine dieser evidenten Tatsachen zur Folge gehabt haben, daß unser Leben absurd geworden ist, wenn es denn absurd ist. Nehmen wir dafür einmal an, wir lebten ewig. Wäre denn ein Leben, das bei einer Dauer von siebzig Jahren absurd ist, bei ewiger Dauer – nach Adam Riese – nicht: unendlich absurd? Und falls unser Leben bei unserer jetzigen Größe absurd ist, warum wäre dieses Leben weniger absurd, wenn wir statt dessen das ganze Universum ausfüllten (sei's, weil entweder wir größer, oder sei's, weil das Universum kleiner wäre als jetzt)? Derlei Reflexionen über uns kurzlebige Zwerge scheinen uns irgendwie in engem Zusammenhang mit dem Gefühl zu stehen, das Leben sei sinnlos, doch bleibt dabei völlig im Dunkel, worin dieser Zusammenhang überhaupt bestehen könnte.
Ein drittes und nicht minder inadäquates Argument bringt vor, daß, weil wir ja alle einmal sterben werden, jede Rechtfertigungskette notgedrungen in der Luft hängen muß: Man lernt und arbeitet, um Geld zu verdienen, um sich damit Obdach, Nahrung, Kleidung und Vergnügen leisten zu können, um sich jahrein, jahraus also am Leben zu halten, vielleicht auch um eine Familie zu ernähren, eine Laufbahn einzuschlagen – aber was dann? All das, um dann letztendlich welchen Zweck zu erreichen? Das ganze ist eine kunstvoll gestaltete verschlungene Reise und führt doch – nirgendwohin! (Zugegeben, all das hat Auswirkungen auf das Leben anderer, aber dann wiederholt sich das Problem ja nur, da auch sie sterben müssen.)
Auch dem läßt sich mancherlei entgegnen. Erstens geht das Leben nämlich nicht nur in einer Reihe von Aktivitäten auf, von denen jede eine weitere, spätere bezweckt. Rechtfertigungsketten finden im wirklichen Leben immer wieder ein Ende, und die Frage, ob sich der Lebensprozeß als ein Ganzes rechtfertigen läßt, spielt für die Endgültigkeit dieses Endens nicht die mindeste Rolle. Es bedarf schlicht keiner weiteren Rechtfertigung dafür, daß es vernünftig ist, gegen Kopfschmerzen eine Aspirintablette zu nehmen, die Ausstellung eines bewunderten Malers zu besuchen oder ein Kind daran zu hindern, den heißen Herd anzufassen. Auch ohne weiteren Kontext oder zusätzlichen Zweck sind derlei Handlungsweisen nicht sinnlos.
Selbst wenn jemand noch weitere Rechtfertigungen für all das im Leben liefern wollte, was gewöhnlich als durch sich selbst gerechtfertigt angesehen wird, müßten auch diese irgendwo ein Ende finden. Könnte nichts eine Rechtfertigung liefern, ohne seinerseits durch etwas anderes gerechtfertigt zu sein, das nicht minder gerechtfertigt wäre, ergäbe sich ein Regreß ins Unendliche – und keine Rechtfertigungskette könnte jemals vollendet werden. Schlimmer noch: Könnte keine endliche Kette von Gründen etwas rechtfertigen, was würde eine unendliche Kette dann überhaupt leisten, bei der jedes Glied durch etwas außer ihr gerechtfertigt sein müßte?
Weil also Rechtfertigungen nun einmal irgendwo ein Ende haben müssen, ist nichts damit gewonnen, daß bestritten wird, daß sie enden, wo sie anscheinend enden, nämlich im Leben – und auch nichts damit, daß man versucht, die Vielzahl von meist trivialen Alltagsrechtfertigungen unseres Handelns unter einem einzigen, leitenden Lebensplan zu einen. Wir sind schon mit viel weniger zufrieden. In der Tat erhebt dieses Argument, indem es den Rechtfertigungsprozeß entstellt, bloß eine hohle, nichtssagende Forderung. Indem man insistiert, daß all die Gründe, die uns das Leben bietet, nicht vollständig sind, suggeriert man, alle einmal endenden Gründe seien unvollständig. Das macht es dann aber unmöglich, überhaupt noch Gründe anzuführen.
Dem Anschein nach sind die üblichen Argumente mithin als Argumente zum Scheitern verurteilt. Und dennoch glaube ich, daß sie etwas auszudrücken suchen, das sich zwar nur mit Mühe sagen läßt, im Grunde genommen aber zutreffend ist.