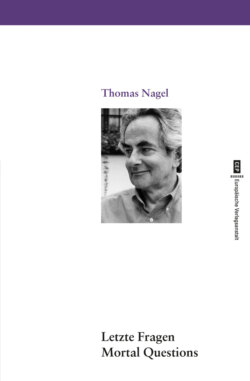Читать книгу Letzte Fragen - Thomas Nagel - Страница 24
VI
ОглавлениеEin Teil der Restriktionen, die sich von Zeit zu Zeit einmal in der Frage zulässiger Methoden der Kriegführung durchgesetzt haben, läßt sich mit dem Eigeninteresse der beteiligten Parteien erklären: Verbote, die sich auf die Art der eingesetzten Waffen beziehen, die Behandlung von Kriegsgefangenen betreffen und so weiter. Aber es steckt noch mehr dahinter. Die beiden Grundbedingungen der Direktheit und der Relevanz, von denen ich zeigen wollte, daß sie für jede Beziehung gelten, die einen Konflikt oder eine Aggression darstellt, haben auch für den Krieg ihre Gültigkeit. Ich habe behauptet, daß es in der Kriegführung zwei Typen absolutistischer ethischer Restriktionen gibt: Jene, welche die Stoßrichtung demarkieren, also abgrenzen, wogegen sich Feindseligkeit legitimerweise nur richten darf, und jene, die beschränken, wie Feindseligkeiten, selbst wenn ihre Stoßrichtung stimmt, allein beschaffen sein dürfen. Ich werde jetzt über jeden Typus etwas sagen, und dabei wird sich zeigen, daß wir mit Hilfe des oben skizzierten Prinzips nicht in jedem Fall zu einer unzweideutigen Antwort gelangen können.
Schauen wir uns zuerst an, inwiefern daraus folgt, daß man nur bestimmte Menschen angreifen darf, andere hingegen nicht. Die Behauptung mag etwas Paradoxes an sich haben, wir behandelten jemanden, den wir mit dem Maschinengewehr beschießen, während er selbst Handgranaten gegen unsere Stellung schleudert, als Menschen. Gleichwohl ist die Beziehung hier direkt und unkompliziert.8 Die Reaktion ist ausdrücklich gegen die von einem gefährlichen Angreifer ausgehende Bedrohung gerichtet und nicht gegen ein peripheres Ziel, in dem er zufällig verwundbar ist, das aber mit der Bedrohung nichts zu tun hat. Zum Beispiel könnten wir ihn aufhalten, indem wir seine Frau und seine Kinder, die zufällig in der Nähe sind, über den Haufen schießen, ihn auf diese Weise davon ablenken, uns in die Luft zu sprengen, und ihn so gefangen nehmen. Stellen seine Frau und seine Kinder aber keine Bedrohung für unser Leben dar, hieße dies, sie in ganz extremer Weise als bloße Werkzeuge zu gebrauchen.
Und das wäre nichts anderes als Hiroshima im kleineren Maßstab. Einer der Vorbehalte gegen Massenvernichtungswaffen – seien es nukleare, thermonukleare, biologische oder chemische – lautet, daß sie wegen der Wahllosigkeit ihres Zuschlagens als direktes Ausdrucksmittel einer feindseligen Beziehung untauglich sind. Indem man die Zivilbevölkerung angreift, zollt man weder dem militärischen Gegner noch dem Zivilisten jenes Minimum an Achtung, das man ihnen als Menschen schuldig ist. Bei einem direkten Angriff auf jemanden, von dem nicht die mindeste Bedrohung ausgeht, liegt dies auf der Hand. Nicht minder gilt es aber auch für die Art und Weise, wie man Menschen attackiert, die uns wirklich bedrohen, also die Regierung und Streitkräfte des Feindes. Man richtet seine Aggression gegen einen äußerst verwundbaren Bereich weit abseits jeglicher Bedrohung durch jene, bei denen es gegebenenfalls legitim gewesen wäre, wenn die Aggression sie getroffen hätte. Man hat sie im Visier, aber durch das Alltagsleben und Überleben ihrer Landsleute hindurch, statt auf dem Wege der Zerstörung ihrer militärischen Kapazitäten. Und natürlich bedarf es nicht erst der Wasserstoffbombe, solche Verbrechen zu begehen.
Betrachtet man die Sache so, hilft uns dies, die Wichtigkeit der Unterscheidung von Kämpfern und Nichtkämpfern und Irrelevanz eines Großteils der mit Blick auf die Verständlichkeit und moralische Bedeutung dieser Differenz vorgebrachten Kritik zu verstehen. Nach Auffassung des ethischen Absolutismus ist jederlei vorsätzliche Tötung Unschuldiger nichts anderes als Mord – und im Krieg sind es für den Angreifenden freilich die Nichtkämpfer, die den Status dieser Unschuldigen haben. Nun war man der Ansicht, daß sich daraus aber zweierlei Probleme ergeben: Erstens die in manchen Köpfen spukende Schwierigkeit, in der modernen Kriegführung wirklich noch zwischen Kämpfern und Nichtkämpfern zu trennen, und zweitens Probleme, die von Konnotationen des Worts »unschuldig« aufgeworfen werden.
Lassen Sie mich die zweite Problematik zuerst ansprechen.9 Aus absolutistischer Sicht ist der hier wirksame Begriff der Unschuld gerade nicht jener der moralischen Unschuld, und er steht auch nicht dem Begriff der moralischen Schuld entgegen. Sonst nämlich sähe man sich darin gerechtfertigt, in einer feindlichen Stadt einen durch und durch schlechten, aber nicht zu den Kämpfern gehörenden Friseur umzubringen, der die verbrecherische Politik seiner Regierung zuinnerst unterstützt, jedoch nicht darin gerechtfertigt, dies einem moralisch integeren Rekruten anzutun, der zu seinem größten Bedauern und mit einem von Liebe erfüllten Herzen seinen Panzer direkt auf uns zurollen läßt. Aber moralische Unschuld spielt hier schwerlich eine Rolle, denn in unserer Definition von Mord bedeutet ›unschuldig‹ so viel wie ›x ist derzeit harmlos‹ und steht im Gegensatz nicht etwa zum Begriff der Schuld, sondern zu dem Begriff: ›von x geht derzeit Gefahr aus‹. Man beachte, daß diese Analyse zu der Konsequenz führt, daß wir im Krieg häufig darin gerechtfertigt sein können, Menschen zu töten, die den Tod nicht verdient haben, während wir gegebenenfalls nicht gerechtfertigt wären, Menschen zu töten, die tatsächlich den Tod verdient haben, wenn ihn überhaupt noch jemand verdient.
Wir müssen also die Unterscheidung zwischen Kämpfern und Nichtkämpfern aufgrund ihrer momentanen Bedrohlichkeit oder Gefährlichkeit treffen. Ich behaupte nicht, daß das eine scharfe Grenze markiert, aber so schwierig, wie häufig behauptet wird, ist es gar nicht, die einzelnen Personen einer der beiden Seiten zuzuordnen. Kinder sind keine Kämpfer, auch wenn sie vielleicht in die Armee eintreten werden, falls man es ihnen gestattet, erwachsen zu werden; und Frauen sind nicht deshalb schon Kämpfer, weil sie Kinder auf die Welt bringen oder den Soldaten Trost und Wärme spenden. Problematischer verhält es sich mit dem breiten Spektrum des nichtuniformierten oder auch uniformierten Versorgungspersonals, das vom Fahrer eines Munitionstransporters oder vom Armeekoch bis hin zu zivilen Arbeitern in Munitionsfabriken und in der Landwirtschaft reicht. Ich glaube, daß man auch sie mit guten Gründen der einen oder der anderen Seite zuordnen kann, indem man auf die Grundbedingung zurückgreift, daß sich die Maßnahmen im Konfliktfall gegen die Ursache der Gefährdung selbst richten müssen und nicht gegenirgend etwas Peripheres. Die Bedrohung, die von einer Armee und mithin von jenen ausgeht, die ihr angehören, geht nicht einfach in dem Tatbestand auf, daß da Menschen eingesetzt werden, sondern besteht in dem Faktum, daß solche Menschen bewaffnet sind und Waffen einsetzen, um bestimmte Ziele zu erreichen. Ein Beitrag zur Bewaffnung und Logistik ist ein Beitrag zu ebendieser Bedrohung; ein Beitrag zu ihrer puren Existenz als Menschen hingegen nicht. Deshalb ist es unrecht, einen Angriff gegen Menschen zu richten, die nur zur Befriedigung humaner Bedürfnisse der Kämpfer beitragen, wie Bauern und Lieferanten von Proviant, und zwar auch dann, wenn menschliches Überleben eine der notwendigen Bedingungen für soldatische Effizienz ist.
Das bringt uns zu der zweiten Klasse ethischer Auflagen: zu Restriktionen, die alldem Grenzen ziehen, was man sogar Kämpfern antun darf. Diese Grenzen deutlich hervortreten zu lassen, ist etwas komplizierter. Manche von ihnen mögen willkürlich oder konventionell sein, und manche wird man vielleicht aus anderen Quellen herleiten müssen, doch glaube ich, daß sie durch meine beiden Grundbedingungen der Direktheit und der Relevanz jedes Reagierens auf Feindseligkeiten in einem beachtlichen Maße erklärt werden.
Führen wir uns zunächst einen Fall vor Augen, der sowohl eine geschützte Klasse von Nichtkämpfern umfaßt als auch Einschränkungen in der Frage der Maßnahmen, die gegen Kämpfer zulässig wären. Eine der Maximen der Kriegführung, die allgemein Achtung fand, auch wenn sie anscheinend in Vietnam zur hohlen Phrase verkommen ist, lautet, daß dem Sanitätspersonal und allen Verwundeten ein Sonderstatus einzuräumen sei. Natürlich könnte es weitaus wirkungsvoller sein, jeden Arzt, den man vor die Maschinenpistole bekommt, zu erschießen und die verwundeten Feinde besser dem Tod auszuliefern als sie wieder zusammenflicken zu lassen, damit sie dann eines Tages womöglich erneut kämpfen können. Doch sobald jemand als Arzt erkennbar ist, erwartet man, daß er in Ruhe gelassen und es ihm gestattet wird, die Verwundeten zu versorgen und zu bergen. Meines Erachtens liegt dies daran, daß sich der Arzt um ein allen Menschen gemeinsames Bedürfnis kümmert und nicht insbesondere um ein Bedürfnis am Krieg beteiligter Soldaten, und wir uns in einem Konflikt mit dem Soldaten befinden und nicht mit seiner Existenz als Mensch.
Führt man diesen Gedanken fort, kommt man in die Lage, das Verbot besonders grausamer Waffen zu rechtfertigen: Aushungern; Vergiften; Infizieren mit Krankheitserregern (gesetzt, man könnte dergleichen überhaupt auf die kämpfende Truppe einschränken); Waffen, die darauf ausgerichtet sind, den Gegner zu verstümmeln, zu entstellen oder ihm Qualen zu bereiten, statt ihn nur aufzuhalten. Es ist in meinen Augen keine bloße Kasuistik zu sagen, daß diese Waffen den Menschen als solchen angreifen und nicht den Soldaten. Die Wirkung eines Dum-Dum Geschosses ist zum Beispiel weitaus brutaler als es die militärische Lage, in der es eingesetzt zu werde pflegt, je erforderlich machen könnte. Solche Waffen haben derart gravierende Folgen, daß sie jeden Versuch im Keim ersticken, den Kämpfer und den Menschen im Feind zu unterscheiden. Aus demselben Grund ist unter allen mir denkbaren Umständen der Gebrauch von Flammenwerfern und Napalm schlicht ein Kriegsverbrechen, und zwar egal wogegen sie sich richten. Verbrennungen sind sowohl beispiellos schmerzhaft als auch ungemein entstellend – weitaus schlimmer und folgenreicher als alle anderen Wundarten. Daß dieses evidente Faktum nicht den mindesten (hemmenden) Einfluß auf die Festlegung der Waffenpolitik der Vereinigten Staaten hatte, legitimiert den Schluß, daß sich auch hierzulande unter Amtsträgern und Statthaltern politischer Macht die moralische Sensibilität seit den Zeiten der spanischen Inquisition nicht merklich verändert hat.10
Und schließlich sollte auch für Angriffe auf ein ganzes feindliches Land (also auf seine gesamte Industrie, Landwirtschaft, Infrastruktur usw.) dieselbe Grundbedingung in Kraft sein: nämlich daß die eingesetzten Mittel stets dem wirklichen Objekt der Feindseligkeit angemessen sind. Auch eine Nation, die nicht Armeen oder Regierungen als die Parteien in einem militärischen Konflikt ansähe, sondern stets ganze Nationen (was in der Regel ein gravierender Irrtum ist), wäre noch nicht darin gerechtfertigt, gegen jeden Aspekt oder Teil der anderen Nation kriegerisch vorzugeben. Das ist bei Konflikten unter Individuen nicht gerechtfertigt, und da Nationen sogar von noch höherer Komplexität sind als Individuen, treffen auf sie dieselben Gründe zu. Selbst wenn eine ganze Nation Krieg führt, ist sie, nicht anders als jeder einzelne Mensch, zugleich in zahllose weitere Tätigkeiten und Geschäfte verwickelt, und in diesen Hinsichten kein Feind.
Die obige Argumentation beruhte insgesamt darauf, daß jedem Absolutismus im Hinblick auf Mord Prinzipien zugrunde liegen, die für alle unsere Beziehungen zu anderen, seien diese freundschaftlich oder feindselig, maßgeblich bleiben, und daß solche Prinzipien, ebendieser Absolutismus, auch für den Krieg gelten, woraus gefolgert wurde, daß bestimmte Maßnahmen einfach nicht zulässig sein können, gleichgültig welche Folgen sie ermöglichen.11 Ich denke hier nicht daran, den Krieg romantisch zu verklären. Dafür ist die Annahme bei weitem zu utopisch, daß sich unsere Nationen im Konfliktfall lieber auf das Niveau beschränkter Barbarei begeben könnten, das für feindselige Auseinandersetzungen zwischen Individuen typisch ist, statt sich weiter in dem moralischen Dreck zu suhlen, in dem sie sich, umringt von ihren gewaltigen Waffenarsenalen, offenkundig häuslich eingerichtet haben.