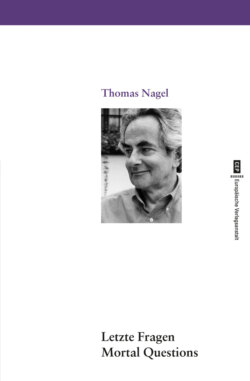Читать книгу Letzte Fragen - Thomas Nagel - Страница 8
Der Tod
ОглавлениеWarum eigentlich ist es schlimm zu sterben, wenn der Tod doch das Ende unserer Existenz ist, unwiderruflich und in alle Ewigkeit?
Die Meinungen in dieser Frage gehen auffallend weit auseinander. Für manche Menschen ist der Tod etwas Schreckliches, andere hingegen haben am Tod als solchem nichts auszusetzen, obwohl auch sie sich wünschen, daß er im eigenen Fall nicht zu bald eintritt, und wenn, dann kurz und schmerzlos. Während die Vertreter der einen Anschauung die der anderen schlicht für blind halten, da sie doch das Nächstliegende nicht erkennen, sehen andererseits diese in jenen nur die bedauernswerten Opfer einer Verwirrung. Die eine Seite kann geltend machen, daß das Leben alles ist, was wir haben, und sein Verlust das schlimmste Übel, das wir überhaupt erleiden können. Die andere Seite führt an, dagegen spreche doch aber gerade, daß der Tod diesen vorgeblichen Verlust ja seines Subjekts beraubt. Sobald wir erkennen, daß der Tod nicht etwa ein unvorstellbarer Zustand einer Person ist, die womöglich nach wie vor existiert, sondern an sich schlicht – nichts, werden wir auch einsehen, daß ihm weder eine positive noch eine negative Valenz zugeschrieben werden kann.
Ich will die Frage ausklammern, ob wir in irgendeiner Weise unsterblich sind oder es überhaupt sein könnten. Deshalb werde ich mich für mein Teil mit dem Wort »Tod« oder verwandten Ausdrücken im folgenden auf den endgültigen Tod beziehen, auf jenen wirklichen Tod, der alle Formen bewußten Weiterlebens ausschließt. Ich werde diskutieren, ob der Tod an sich selbst etwas Schlechtes ist, wie groß dieses Übel gegebenenfalls ist, und von welcher Art. Dafür sollte sich sogar jemand interessieren, der an irgendeine Form der Unsterblichkeit glaubt, denn zwangsläufig hätte unsere Einstellung zu ihr zu einem Teil von unserer Einstellung zum Tod abzuhängen.
Ist der Tod ein Übel, dann nicht etwa aufgrund positiver Qualitäten, die wir ihm zuschreiben könnten, sondern allein aufgrund dessen, was er uns raubt. Die Schwierigkeiten, mit denen ich fertig zu werden versuche, entstehen im Umfeld der natürlichen Ansicht, daß der Tod deswegen ein Übel ist, weil mit seinem Eintreten all das Gute ein Ende hat, das uns das Leben bietet. Wir brauchen nicht im einzelnen darauf einzugehen, was hier mit dem Guten gemeint ist; wir sollten lediglich festhalten, daß einiges dazugehört – Wahrnehmen, Wünschen, Handeln und Denken –, das allgemein genug ist, um für das menschliche Leben als solches konstitutiv zu sein. Es ist eine weit verbreitete Ansicht, daß es sich hierbei um vorzügliche Himmelsgaben handelt, ungeachtet der Tatsache, daß es eventuell einer ausreichenden Anzahl einzelner Übel gelingen könnte, den Vorteil dieser Gaben aufzuwiegen, und daß sie Bedingungen für Freud und Leid gleichermaßen sind. Das, glaube ich, will gegebenenfalls die Bekundung ausdrücken, es sei schon gut, nur am Leben zu sein, gleichgültig wie entsetzlich das ist, was man durchmacht. Im großen und ganzen handelt es sich darum, daß es auf der einen Seite Komponenten gibt, die zu einem besseren Leben führen, wenn man sie der Erfahrung hinzufügt, und andererseits Komponenten, die der Erfahrung hinzugefügt das Leben schlechter machen. Was aber übrig bleibt, wenn man von diesen Komponenten absieht, ist eben nicht bloß neutral, es ist entschieden positiv. Deshalb ist das Leben lebenswert, selbst wenn sich die üblen Erlebnisse häufen und die guten so dürftig sind, daß sie allein keinen Ausgleich schaffen können. Den Ausschlag zum Positiven gibt dann die Erfahrung selbst, und nicht einer ihrer Inhalte.
Ich möchte hier nicht darauf eingehen, welchen Wert das Leben oder der Tod einer Person für andere haben können, und auch nicht, welches ihr objektiver Wert ist, sondern mich beschäftigt, welchen Wert der Tod für die Person selbst hat, die sein Subjekt ist. Das scheint mir der primäre Aspekt des Problems, aber auch der schwierigste zu sein. Ich möchte nur noch zwei Beobachtungen anfügen: Erstens kommt der Wert des Lebens und seiner Inhalte nicht dem bloßen organischen Überleben zu. Fast jedermann wäre es ceteris paribus egal, ob er auf der Stelle tot wäre oder nur in ein Koma fiele, das zwanzig Jahre später, ohne daß er je wieder erwacht wäre, mit dem Tod endete. Zweitens kann das Gute am Leben wie das meiste Gute durch die Zeit vervielfacht werden: je länger, desto besser. Dieser Prozeß muß keineswegs kontinuierlich vonstatten gehen (obwohl das etliche soziale Vorteile hätte). Manch einer fühlt sich von der Möglichkeit angezogen, die Körperfunktionen längere Zeit auszusetzen oder den Körper einzufrieren, um danach das bewußte Leben wieder aufzunehmen, und der Grund hierfür ist, daß er es aus der Innenperspektive einfach als Fortsetzung seines jetzigen Lebens bemerken würde. Angenommen, diese Techniken wären eines Tages weit genug entwickelt, könnte etwas, das von außen wie ein dreihundert Jahre dauernder Winterschlaf aussieht, vom Subjekt selbst lediglich als scharfer Bruch in der Kontinuität seiner Erlebnisse empfunden werden. Damit leugne ich natürlich nicht, daß auch dies seine Schattenseiten hätte. Freunde und Angehörige würden längst tot sein; die eigene Sprache könnte sich gewandelt haben; unsere komfortable Vertrautheit mit der eigenen Kultur, Geographie und Gesellschaft wäre dahin. Und doch würden diese Schwierigkeiten den grundsätzlichen Vorteil eines nunmehr fortdauernden, wenngleich diskontinuierlichen Daseins nicht aufheben.
Wenden wir uns statt den guten Seiten des Lebens den schlechten des Todes zu, so ändert sich die Lage vollständig. Es mag zwar problematisch sein, angeben zu wollen, was wir im einzelnen am Leben für wünschenswert halten, doch wird es sich dabei wesentlich um bestimmte Zustände, Bedingungen oder Aktivitätsformen handeln. Wir finden es gut, am Leben zu sein, gewisse Dinge zu tun und bestimmte Erlebnisse zu haben. Doch sofern der Tod ein Übel ist, ist es eher der Verlust des Lebens als irgendein Zustand, tot, nicht mehr existent oder bewußtlos zu sein, an dem wir etwas auszusetzen haben.1 Diese Asymmetrie ist entscheidend. Ist es gut, am Leben zu sein, kann man dieses Gut einer Person zeit ihres Lebens zuschreiben. Mithin war Bach darin reicher als Schubert, einfach weil er länger lebte. Beim Tod hingegen handelt es sich nicht um ein Übel, von dem Shakespeare bis heute eine erheblichere Portion einstecken mußte als Proust. Ist der Tod etwas Schlechtes, fällt es nicht leicht zu sagen, wann jemand eigentlich unter dem entsprechenden Nachteil leiden sollte.
Es gibt zwei weitere Anzeichen dafür, daß wir am Tod nicht bloß auszusetzen haben, daß er lange Perioden der Nichtexistenz einschließt. Wie gesagt würden erstens die meisten von uns ein zeitweiliges Aussetzen des Lebens, selbst für eine beträchtliche Zeitspanne, nicht schon per se für ein vergleichbares Unglück erachten. Sollte es dereinst einmal möglich werden, Menschen einzufrieren, ohne daß sich dadurch ihr bewußtes Leben verkürzte, wäre es im Grunde unangebracht, einen zu bedauern, der auf diese Weise eine Zeitlang aus dem Verkehr gezogen würde. Zweitens gilt ebensogut, daß keiner von uns existierte, bevor er geboren (oder gezeugt) wurde, daß jedoch kaum jemand dies jemals als Unglück empfindet. Davon wird später noch zu reden sein.
Das Faktum, daß wir uns den Tod nicht als einen unglückseligen Zustand denken, gestattet es uns, eine ebenso merkwürdige wie verbreitete Vermutung über die Ursache unserer Angst vor dem Tode zurückzuweisen. Nicht selten hört man, der Fehler all derer, die etwas gegen den Tod einzuwenden hätten, bestehe in dem Versuch sich vorzustellen, wie es sich anfühlt, tot zu sein. Man versichert, daß just dieses Unvermögen, die logische Unmöglichkeit eines solchen Unterfangens einzusehen – die schlicht daher rührt, daß es da gar nichts vorzustellen gibt – das Moment sei, das zu der Überzeugung führt, der Tod sei ein mysteriöser und deshalb furchterregender künftiger Zustand. Doch kann diese Diagnose unmöglich richtig sein, und der Grund dafür ist der folgende: Es ist nicht minder unmöglich sich vorzustellen, wie es sich anfühlt, vollständig ohne Bewußtsein zu sein, wie sich vorzustellen, tot zu sein (obwohl man sich aus der Außenperspektive freilich mühelos vorstellen kann, in einem dieser beiden Zustände zu sein), und doch haben zahllose Menschen, die allerhand gegen den Tod haben, in der Regel gegen den Zustand der Bewußtlosigkeit nichts einzuwenden (jedenfalls solange damit keine entscheidende Einbuße in der Gesamtdauer ihres wachen Lebens verbunden ist).
Soll die Auffassung überhaupt einen guten Sinn ergeben, daß es schlecht ist zu sterben, so deshalb, weil das Leben etwas Gutes ist und der Tod der entsprechende Verlust oder Mangel. Zu sterben ist nicht etwa schlecht aufgrund positiv damit einhergehender Qualitäten, sondern aufgrund des negativen Sachverhalts, daß da vormals etwas Wünschenswertes war, das uns der Tod genommen hat. Ich möchte nun zu den ernsthaften Schwierigkeiten übergehen, die diese Hypothese mit sich bringt, zu Schwierigkeiten, die sich in Angelegenheiten des Verlusts und Mangels im allgemeinen und der Frage des Todes im besonderen ergeben.
Wir haben es im Wesentlichen mit drei Arten von Problemen zu tun. Zum ersten könnte man bezweifeln, daß für einen Menschen überhaupt etwas schlecht sein kann, ohne ihm wirklich unangenehm zu sein. Man mag insbesondere bezweifeln, daß es Übel gibt, die rein darin aufgehen, daß Gutes fehlt oder verloren geht, dabei aber niemanden voraussetzen, dem der Verlust etwas ausmacht. Zum zweiten tauchen im Zusammenhang mit dem Tod eine Reihe besonderer Schwierigkeiten auf, die damit zusammenhängen, wie man das vermeintliche Unglück überhaupt einem Subjekt zuschreiben kann. Es ist sowohl zweifelhaft, wer sein Subjekt ist, als auch, wann es vom Tod betroffen sein soll. Solange eine Person existiert, ist sie ja noch nicht gestorben, und wenn sie gestorben ist, existiert sie nicht mehr. Mithin scheint es erst gar keinen Zeitpunkt geben zu können, zu dem wir das Übel, das der Tod doch sein soll, seinem bedauernswerten Subjekt zuschreiben können. Und eine dritte Schwierigkeit betrifft die oben erwähnte Asymmetrie zwischen unseren Einstellungen gegenüber posthumer und pränataler Nichtexistenz: Wie kann die erstere schlecht sein, letztere aber nicht?
Man sollte sich jedoch über folgendes im klaren sein: Wären dies wirklich stichhaltige Einwände dagegen, im Tod ein Übel zu sehen, dann müßten sie sich auch auf viele andere vermeintliche Übel anwenden lassen. Die erste Art von Einwänden wird in allgemeiner Form durch das Sprichwort ausgedrückt: »Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß«. Das würde bedeuten, daß wir sogar von jemandem, der von seinen Freunden betrogen, hinterrücks verspottet und von denselben Leuten, die ihm freundlich ins Gesicht lächeln, verachtet wird, solange nicht sagen können, er sei unglücklich, wie er nicht darunter leidet. Ebensogut würde es besagen, daß derjenige nicht gekränkt wird, dessen letzter Wille vom Testamentsvollstrecker mißachtet oder über den nach seinem Tod das Gerücht verbreitet wird, das literarische Werk, das ihn berühmt gemacht habe, sei in Wahrheit von seinem Bruder verfaßt worden, der im Alter von achtundzwanzig Jahren in Mexiko gestorben sei. Es scheint mir die Frage angezeigt, welche Annahmen es in Sachen dessen, was gut oder schlecht ist, eigentlich sein sollten, die zu derart drastischen Einschränkungen führen?
Alle diese Fragen haben etwas mit der Zeit zu tun. Zweifellos gibt es Dinge (darunter mancherlei Freuden und Schmerzen), die für einen Menschen einfach aufgrund des Zustands, in dem er sich zu dieser Zeit befindet, gut oder schlecht sind. Doch gilt dies nicht von allem und jedem, das wir als gut oder schlecht für einen Menschen erachten. Häufig müssen wir erst seine Geschichte kennen, um sagen zu können, ob etwas ein Unglück für ihn ist oder nicht, vor allem, wenn es sich darum handelt, daß sich seine Situation verschlechtert oder daß er einen Verlust oder Schaden erlitten hat. Ja, in einigen Fällen ist es hierfür sogar ziemlich uninteressant, wie es ihm momentan gerade geht – so etwa im Falle des Mannes, der sein Leben damit vergeudet, quietschvergnügt nach der Spargelsprache zu suchen. Wer die Meinung vertritt, daß nur Zustände einer Person, die ihr mit Angabe eines Zeitpunkts zugeschrieben werden können, gut oder schlecht seien, könnte solchen Problemfällen natürlich dadurch Rechnung tragen wollen, daß er auf die Freuden oder Leiden hinwiese, die durch diese komplizierteren Fälle verursacht würden. Dieser Ansicht zufolge wäre es schlecht, etwas zu verlieren, verraten, betrogen und verspottet zu werden, weil der Betroffene darunter leidet – so er davon erfährt. Wir sollten uns aber fragen, welche Vorstellungen davon, was für den Menschen welchen Wert hat, es uns erlauben würden, mit diesen problematischen Fällen statt dessen auf direktem Wege fertig zu werden. Das hätte unter anderem den Vorteil, daß wir erklären könnten, warum einer eigentlich leidet, wenn er erfährt, wie glücklos er ist, und es auf eine Weise erklären könnten, die dieses Leiden als gerechtfertigt erscheinen ließe. Denn für gewöhnlich sagt man ja, daß das Aufdecken eines Verrats uns unglücklich macht, weil es schlecht ist, verraten zu werden, und nicht etwa, daß es schlecht ist, verraten zu werden, weil die Entdeckung uns unglücklich macht.
Deshalb scheint es mir einen Versuch wert zu sein, die Ansicht zu untersuchen, daß das Subjekt fast jeden Glücks oder Unglücks eine Person ist, die nicht durch den kategorischen Zustand, in dem sie sich im betreffenden Augenblick befindet, sondern durch die Geschichte ihres Lebens und all das, was ihr in diesem Leben möglich ist, identifiziert wird – so daß sich zwar das Subjekt räumlich und zeitlich exakt lokalisieren ließe, nicht aber unbedingt auch alles Gute und Schlechte, das ihm widerfahren kann.2
Diese Überlegungen lassen sich gut am Beispiel einer Privation veranschaulichen, die fast so schwer wiegt wie der Tod. Angenommen eine intelligente Person verletzte sich am Gehirn so stark, daß sie den Geisteszustand eines zufriedenen Säuglings zurückfällt. Alle ihr noch bleibenden Bedürfnisse können von einem Pfleger befriedigt werden, sie hat also keine Sorgen. Nahezu jedermann würde diesen Vorgang als schreckliches Unglück ansehen, und zwar nicht nur für ihre Verwandten und Freunde oder für die Gesellschaft, sondern in erster Linie für sie. Damit ist freilich nicht gesagt, daß ein zufriedener Säugling etwa unglücklich ist. Das Subjekt des Unglücks ist vielmehr die intelligente erwachsene Person, die in diesen Zustand zurückgefallen ist. Sie ist es, die wir bedauern, obgleich ihr dieser Zustand natürlich nichts ausmacht. Ja, es regen sich sogar gewisse Zweifel, ob wir dann überhaupt sagen können, daß es sie immer noch gibt.
Sobald aber jemand davon überzeugt ist, ein solcher Mensch sei Opfer eines Unglücks geworden, lassen sich hiergegen dieselben Einwände vorbringen, die im Zusammenhang mit dem Tod erhoben wurden: Der betreffende Mensch leidet ja nicht unter seinem Zustand. Es ist derselbe Zustand, in dem er sich im Alter von drei Monaten befunden hatte, nur daß er jetzt etwas größer ist. Damals haben wir ihn nicht bedauert, warum bedauern wir ihn eigentlich jetzt? Und wie dem auch sei, wen bedauern wir eigentlich? Den intelligenten Erwachsenen gibt es ja nicht mehr, und für ein Wesen, wie wir es jetzt vor uns haben, besteht alles Glück dieser Erde in einem vollen Magen und einer trockenen Windel.
Geht diese Einrede fehl, dann aufgrund einer irrigen Annahme über die zeitliche Beziehung zwischen dem Subjekt des Unglücks und den für das Unglück verantwortlichen äußeren Umständen. Hören wir also auf, uns ausschließlich auf das überdimensionale Baby vor uns zu konzentrieren, und denken wir an den, der er einmal war, und daran, wer er in diesen Tagen hätte sein können, dann ist sein Rückfall in diesen Zustand und der abrupte Abbruch seines natürlichen Erwachsenenlebens der klare Fall einer Katastrophe.
Das sollte uns davon überzeugen, daß es aus der Luft gegriffen ist, all das, was gut oder schlecht für einen Menschen sein kann, auf nichtrelationale Eigenschaften der Person, die ihr zu einem bestimmten Zeitpunkt zugeschrieben werden können, beschränken zu wollen. In Wahrheit würden wir mit einer solchen Restriktion nicht nur Fälle hochgradiger Degeneration wie den oben geschilderten ausschließen, sondern darüber hinaus auch einen Großteil dessen, was über jemandes Erfolg oder Mißerfolg und all jene anderen Charakteristika seines Lebenslaufes entscheidet, die Prozesse sind. Ja, wir können sogar noch weiter gehen: Es gibt Güter oder Übel, die irreduzibel relational sind – Merkmale der Beziehung zwischen äußeren Umständen und einer in der gewohnten Weise raumzeitlich bestimmten Person –, die weder zu ihren eigenen Lebzeiten eintreten müssen noch an demselben Ort, an dem sie sich befindet. Zum Leben eines Menschen gehört vieles, das sich außerhalb der Grenzen seines Körpers und Geistes abspielt, und zu dem, was ihm widerfährt, kann auch mancherlei gehören, das sich außerhalb der Grenzen seiner Lebensdauer abspielt. Beispielsweise werden diese Grenzen bisweilen überschritten, wenn jemandem das Unglück widerfährt, getäuscht, verachtet oder betrogen zu werden. (Sollte sich diese Position als haltbar erweisen, können wir auch mühelos erklären, was unrecht daran ist, ein Versprechen zu brechen, das man am Sterbebett gegeben hat: Es ist eine Kränkung des Verstorbenen. Bisweilen ist es möglich, in der Zeit nur eine andere Form von Distanz zu sehen). Das Beispiel psychischer Degeneration zeigt, daß es manchmal vom Kontrast zwischen der Wirklichkeit und alternativen Möglichkeiten abhängt, ob etwas ein Übel ist. Für einen Menschen kann etwas nicht nur schlecht (oder gut) sein, weil er fähig ist zu leiden (oder sich zu erfreuen), sondern weil er auch Hoffnungen hat, die in Erfüllung oder nicht in Erfüllung gehen könnten, und Anlagen, die er entfalten oder nicht entfalten könnte. Ist der Tod ein Übel, werden wir uns an diesen Aspekt zu halten haben, und es sollte uns dann erst gar nicht stören, daß man das Übel nicht länger innerhalb des betreffenden Lebens zu lokalisieren vermag.
Stirbt jemand, so ist alles, was von ihm übrig bleibt, sein Leichnam. Nun kann ein Leichnam zwar zu Schaden kommen, ganz wie ein Möbelstück, doch wäre es völlig unangemessen, einen Leichnam zu bedauern. Bedauern kann man aber den Menschen. Er hat sein Leben verloren, und wäre er nicht gestorben, würde er dieses Leben heute noch immer führen und im Besitz all dessen sein, was es an Gutem ermöglicht. Wenden wir die Überlegung, die wir im Falle unseres Debilen angestellt haben, auf den Tod an, so können wir zwar ziemlich klar die räumliche und zeitliche Lokalisierung dessen, der den Verlust erlitten hatte, angeben, nicht aber so leicht die seines Unglücks. Wir müssen uns mit der Feststellung zufrieden geben, daß sein Leben aus und vorbei ist und es auf ewig bleiben wird. Dieses Faktum, und nicht etwa irgendein Zustand, in dem er sich jetzt befindet oder einst befand, macht sein Unglück aus, wenn es denn eines ist. Wenn es sich indes um einen Verlust handelt, muß es allemal jemanden geben, der ihn erleidet und der mithin existieren und einen genauen Ort in Raum und Zeit haben muß, selbst wenn dies für den Verlust nicht gilt.
Das Faktum, daß Beethoven keine Kinder hatte, mag uns veranlassen, ihn zu bedauern, und mag traurig für die Welt sein, aber niemand kann sagen, es sei ein Unglück für die möglichen Kinder, die er nicht gehabt hat. Ich glaube, jeder von uns ist glücklich zu schätzen, das Licht der Welt erblickt zu haben, aber solange es unmöglich ist, von einem Embryo oder erst recht von einem noch nicht verschmolzenen Paar von Keimzellen zu sagen, sie hätten Glück oder Pech, solange kann man auch nicht davon sprechen, daß es ein Unglück sei, nicht geboren zu werden. (Solche Faktoren spielen eine entscheidende Rolle, wenn es zu entscheiden gilt, ob Abtreibung oder Empfängnisverhütung womöglich etwas mit Mord zu tun haben könnten.)
Diese Überlegungen erlauben es nun, das Problem der zeitlichen Asymmetrie zu lösen, auf das Lukrez hingewiesen hat. Ihm fiel auf, daß niemand es beunruhigend findet, über jene Ewigkeit zu grübeln, die seiner eigenen Geburt voranging. Diese Feststellung schien ihm zu beweisen, daß es irrational sei, den Tod zu fürchten, da dieser doch nichts weiter sei als das Spiegelbild der dem Leben vorausliegenden Unendlichkeit. Das ist jedoch schlicht nicht wahr, und was beide Sachverhalte voneinander unterscheidet, liefert uns auch die Erklärung dafür, warum wir sie mit gutem Grund unterschiedlich behandeln. Es stimmt zwar, daß niemand in dem Zeitraum vor seiner Geburt oder nach seinem Tod existiert. Doch die Zeit nach unserem Tod ist die Zeit, die uns der Tod raubt. Wären wir nicht gestorben, wären wir zu dieser Zeit ja noch am Leben. Deshalb führt der Tod stets zum Verlust irgendeiner Lebensspanne, die sein Opfer noch erlebt hätte, wäre es nicht zu dieser oder einer früheren Zeit gestorben. Wir wissen nur zu genau, wie es für ihn gewesen wäre, wenn ihm dieses Leben noch geblieben wäre, das er verloren hat, und es bereitet uns keinerlei Mühe, denjenigen zu identifizieren, der diesen Verlust erlitten hat.
Aber es ist nicht möglich zu sagen, die Zeit vor der Geburt sei ebensogut eine Zeit, die dieser Mensch erlebt hätte, wäre er nur früher geboren worden. Denn abgesehen von einem unerheblichen Spielraum, der sich durch die Möglichkeit vorzeitig eintretender Wehen ergibt, hätte er gar nicht früher auf die Welt kommen können als zu der Zeit zu der er geboren wurde: Jeder, der wesentlich früher als er geboren worden wäre, wäre ein anderer gewesen. Folglich gilt für die Zeit vor seiner Geburt keineswegs, daß das zu späte Eintreten der Geburt etwa schuld daran war, daß er sie nicht erlebt hat. Gleichgültig wann einer das Licht der Welt erblickt, verliert er dadurch keine Sekunde seines Lebens.
Die Zeitrichtung ist entscheidend, sobald wir einem Menschen oder überhaupt einem Individuum Möglichkeiten zuschreiben. Verschiedene mögliche Leben einer einzelnen Person können, ausgehend von einem gemeinsamen Anfang, divergieren, aber sie können schwerlich aus unterschiedlichen Anfängen in einem gemeinsamen Ende zusammentreffen. (Im letzteren Fall würde es sich nicht um eine Reihe verschiedener möglicher Leben ein und desselben Individuums handeln, sondern um eine Reihe verschiedener möglicher Individuen, deren Leben gegen ein gemeinsames Ende konvergierten.) Wir können uns also für jedes identifizierbare Individuum unzählige mögliche Fortsetzungen seines Lebens vorstellen und uns immerhin vor Augen führen, wie es für dieses Individuum wäre, unendlich lange weiterzuexistieren. Wie unausweichlich es auch immer sein mag, daß dieser Fall nie eintreten wird, besteht doch diese beständige Möglichkeit als die Möglichkeit, daß das Gute am Leben kontinuierlich fortdauert (wenn sein Leben tatsächlich so gut ist, wie wir unterstellt haben).3
Es stellt sich mithin die Frage, ob die Nichtverwirklichung dieser Möglichkeit in jedem Falle ein Unglück sein muß, oder ob dies davon abhängt, was vom Weiterleben überhaupt noch zu erhoffen war. Das scheint mir die in Wahrheit gravierendste Schwierigkeit für die Position zu sein, daß der Tod jederzeit ein Übel sei. Selbst wenn es uns gelänge, das Befremden abzuschütteln, ob man überhaupt von einem Übel reden kann, wenn das Unglück nie erlitten wird oder einer Person nicht zu Lebzeiten zugeschrieben werden kann, bliebe nämlich noch die Frage, wie aussichtsreich dann eine Aussicht zum mindesten zu sein hat, damit als Unglück aufgefaßt werden kann, daß sie nicht verwirklicht wird (oder als Glück, falls es sich um die Aussicht auf etwas überaus Schlimmes gehandelt hat). Gewöhnlich gilt Keats' Tod im Alter von nur vierundzwanzig Jahren als eine Tragödie, nicht aber Tolstois Tod als Zweiundachtzigjähriger. Obwohl beide bis in alle Ewigkeit tot sind, wurde Keats ja vieler Lebensjahre beraubt, die Tolstoi noch beschieden waren. Keats mußte also ganz eindeutig einen komparativ größeren Schaden erleiden (obwohl dies freilich nicht der Sinn von »größer« ist, mit dessen Hilfe unendliche Quantitäten normalerweise in der Mathematik verglichen werden).
Indessen kann so nicht bewiesen werden, daß Tolstoi etwa nur einen unbedeutenden Verlust erlitten hat. Denn womöglich verhält es sich lediglich so, daß wir erst dann Protest einzulegen pflegen, wenn das Unausweichliche noch durch üble Dreingaben unnötig vermehrt wird. Jedenfalls nimmt die Tatsache, daß es entschieden schlechter ist, mit vierundzwanzig als mit zweiundachtzig Jahren zu sterben, dem Tod eines Zweiundachtzigjährigen nichts von seinem Schrecken – ebensowenig wie dem Tod eines Achthundertsechsjährigen. In Frage steht dann, ob wir eine Beschränkung, die wie die Sterblichkeit für eine Spezies normal ist, überhaupt für ein Unglück erachten können. Blind oder fast blind zu sein, ist für den Maulwurf schließlich kein Unglück und wäre es auch nicht für den Menschen, würde es von Natur aus zur Beschaffenheit seiner Spezies gehören, daß er nicht sehen kann.
Das Mißliche hieran ist, daß uns das Leben immer schon vertraut macht mit all dem Guten, das der Tod uns dann raubt. Wir sind deshalb, im Unterschied zum Maulwurf, der die Fähigkeit zu sehen erst gar nicht würdigen kann, in der Lage, den Wert dieses Guten zu erkennen. Lassen wir die Zweifel beiseite, ob es sich überhaupt um etwas Gutes handelt, und gestehen wir außerdem zu, daß das Ausmaß des Guten zu einem Teil davon abhängt, wie lange es andauert, verbleibt uns die Frage, ob gesagt werden kann, daß der Tod, völlig gleichgültig wann er eintritt, sein Opfer der im relevanten Sinne möglichen Fortsetzung seines Lebens beraubt.
Die Problemlage ist doppeldeutig. Aus der externen Perspektive besehen haben menschliche Wesen unbestreitbar eine natürliche Lebenserwartung und können unmöglich wesentlich älter werden als hundert Jahre. Doch das interne Bewußtsein, das jemand von seinem eigenen Erleben hat, schließt gerade nicht diese Vorstellung ein, daß die Natur seinem Leben eine Grenze gesetzt hat, vielmehr konkretisiert sich ihm das Dasein des Individuums als eine virtuell endlose Zukunft mit den gewohnten Wechselfällen von Gutem und Schlechtem, die ihm in der Vergangenheit so erträglich erschienen sind. Nun da er durch eine geradezu überflüssige Verkettung natürlicher, historischer und sozialer Kontingenzen auf die Welt gekommen ist, findet er sich als das Subjekt eines Lebens wieder, dem eine unbestimmte und nicht mit Notwendigkeit befristete Zukunft offensteht. Wie unvermeidlich der Tod auch sei, löscht er aus dieser Perspektive auf abrupte Weise all das mögliche Gute aus, das andernfalls in unbestimmtem Umfange hätte eintreten können. Daß unser Tod normal ist, hat damit offenbar nicht das Mindeste zu tun, denn aus der Tatsache, daß ein jeder von uns unausweichlich nach ein paar Dutzend Jahren sterben wird, folgt ja keineswegs, daß es nicht gut wäre, weiterzuleben. Gesetzt, es sei unausweichlich für uns alle, vor unserem Tod in Agonie zu verfallen – in eine sechs Monate anhaltende physische Agonie. Würde diese Aussicht auch nur um ein Jota weniger unangenehm aufgrund irgendeiner Unausweichlichkeit? Und warum sollte es sich dann mit dem beschriebenen Verlust eigentlich anders verhalten? Bei einer mittleren Lebenserwartung von tausend Jahren wäre es ja nachgerade eine Tragödie, im Alter von nur achtzig Jahren zu sterben. Vielleicht steht es so, daß diese Tragödie unter unseren heutigen Bedingungen nur um einiges verbreiteter ist. Gibt es kein Alter, von dem an es sich nicht mehr zu leben lohnt, mag es sein, daß uns allen ein schlechtes Ende bevorsteht.
Übersetzt von Karl-Ernst Prankel, Ralf Stoecker und Michael Gebauer.