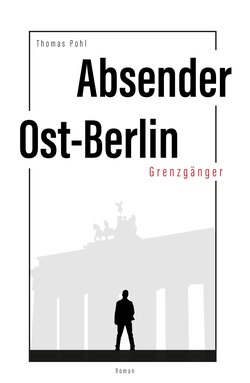Читать книгу Absender Ost-Berlin - Thomas Pohl - Страница 16
Оглавление11. Transitautobahn
Die westdeutschen Grenzbeamten standen gelangweilt vor ihrem hell erleuchteten Grenzhäuschen. Sie versprühten einen Hauch von Unbekümmertheit, Vertrauen, vielleicht sogar etwas Familiäres. Michael liebte dieses Zeitfenster kurz nach Sonnenuntergang, die blaue Stunde. Der Zeitpunkt für ihre Abreise war von ihm nicht zufällig gewählt. Er hatte den Wagen rund um die Siegessäule gesteuert, die bereits golden glänzte. Michael beobachtete Annas leuchtende Augen entlang der Straße des 17. Juni, dem Geburtstagsdatum seines Vaters. Unter der S-Bahn-Brücke hindurch, vorbei an ihrer beider Universität, die nunmehr nicht mehr die seine war. Michael steuerte den alten VW-Käfer auf die Stadtautobahn in Richtung Funkturm. Er schien ihnen den Weg zu leuchten, in Richtung des Grenzüberganges, der dem jungen Liebespaar den Weg in den Westen freigab.
„Er grüßt uns!“ Anna deutete auf den winkenden westdeutschen Beamten. Ihr Ausruf klang so überrascht wie ungläubig.
„Warum nicht?“ Michael konnte sich ein Lachen nicht verkneifen.
„Oder sollten sie Angst haben, dass wir nicht zurückkehren? Republikflucht in den Osten?“
Anna schwieg und begann Michael den Nacken zu kraulen. Die kleine bronzene Statur des Berliner Bären zwischen den Fahrbahnen huschte an ihnen vorbei.
„Gleich beginnt das Rumpeln. Achtung! Drei, Zwei, Eins.“ Exakt auf seine Ankündigung hin, änderte sich der Fahrbahnbelag von der glatten Asphaltdecke zu den aneinander gesetzten fünf Meter langen Platten der ostdeutschen Transitautobahn. Die groben Fugen des Betons erzeugten während der Fahrt den galoppierenden Rhythmus, der den gesamten Innenraum des Autos durchflutete.
„Ich liebe diesen Sound. Er erinnert mich an früher, an unsere Besuche in der DDR.“
„Wart ihr oft im Osten?“
„Bestimmt drei bis viermal im Jahr. Einmal bin ich sogar alleine gefahren.“
Anna schaute ungläubig zu Michael hinüber. „Wie? Als Kind?“
„Ja als Kind. Ich war fünf.“
Und dann begann er zu erzählen:
Ich wusste nicht, ob das Kopfschütteln der Frau gegenüber mir immer noch von ihrem Unverständnis oder dem Rütteln des Zuges herrührte. Sie hatte mich so eigenartig ins Visier genommen. Schien so gar nicht zu verstehen, was hier gerade vor sich ging:
„Wie alt bist du?“
„Fünf“, sagte ich. Ich spürte trotz meines zarten Alters, dass hier gerade zwei Welten aufeinanderprallten. Und doch war ich von dieser Frau gegenüber eigenartig unbeeindruckt.
„Und dein Vater holt dich dann am Bahnsteig in Frankfurt ab?“ fragte sie. Ungläubig.
„Ja. Hab` ich doch schon gesagt. Es sind doch nur fünf Stationen.“ Abermals schüttelte sie ihren Kopf so eigenartig. Nur diesmal lag die Ursache eindeutig nicht am Rütteln des Zuges. Den Blick von ihr abwendend schaute ich interessiert aus dem Fenster. Ich kannte die vorbeiziehenden Häuser. Die Umgebung schien mir so viel vertrauter als diese merkwürdige Frau.
„Außerdem übe ich nur.“
Mir war in diesem Moment klar, dass ich diesen Satz besser nicht gesagt hätte. Denn das würde die kopfschüttelnde Frau wirklich nie verstehen.
„Wie? Was übst du?“
Ich hatte schon geahnt, dass sie das fragen würde. Eigentlich war ich dieser fremden Person keine Rechenschaft schuldig. Warum stellte sie mir überhaupt so viele Fragen? Konnte sie mich nicht einfach alleine Zug fahren lassen? Und doch spürte ich bereits trotz meiner wenigen Jahre die Brisanz dessen, was ich gerade tat und bald tun würde. Ich haderte kurz, blickte der Frau tief in die Augen und sagte es dann doch: „Ich übe das Zugfahren, damit ich in zwei Monaten alleine in die DDR fahren kann. Aber dann bin ich ja fast schon sechs.“
Es wirkte, als würden der Frau die Augen aus dem Kopf fallen. Sie zupfte nervös an ihren Jackenärmeln. Irgendetwas schien ihr die Sprache verschlagen zu haben. Zumindest stellte sie jetzt erst einmal keine weiteren doofen Fragen. Ihr Weltbild schien bis in die tiefsten Grundfesten erschüttert. Wahrscheinlich war sie selbst noch nie in der DDR gewesen. In diesem anderen Teil des Landes, wo die Menschen nichts zu essen hatten. Und froren. Wo man nicht laut reden durfte. Die Ostzone. Aber ich wusste es besser. Für mich war es einfach nur das andere Deutschland.
Inzwischen hatte sich die Dame gegenüber mit einem weiteren Fahrgast solidarisiert und tuschelte, unverblümt auf mich schauend, mit ihm über die Situation. Ich schaute aus dem Fenster und beobachtete so unauffällig wie möglich den Dialog der beiden. Es war mir unangenehm, dass man über mich sprach. Ich wollte einfach nur Zugfahren. Aber diese Erwachsenen schienen irgendetwas dagegen zu haben. Inzwischen waren sie schon zu dritt und redeten untereinander ohne die Blicke von mir zu wenden. Der dritte war ein Mann, der zwar etwas ruhiger schien, aber mich offensichtlich auch nicht in Ruhe lassen wollte: „Sag` mal — die Frau hat mir gerade erzählt, dass du hier das Zugfahren übst, damit du bald alleine in die DDR reist? Stimmt das?“
„Ja, nach Eisenach.“
Meine präzise Antwort machte den Mann wenigstens für kurze Zeit mundtot. Zumindest redete er nicht mehr auf mich ein, sondern flüsterte mit den beiden anderen Damen. Nach einiger Zeit und unverständlichem Getuschel wandte sich die erste Frau wieder an mich: „Hör zu. Dieser Onkel wird mit dir in Frankfurt aussteigen und dann zeigst du ihm deinen Papa — ja?“
Mir war klar, dass dieser Mann weder mein Onkel war, noch dass ich Lust hatte, mit ihm in Frankfurt auszusteigen. Das wollte ich doch schließlich alleine tun. Das war der Plan. Doch die Erwachsenen schienen von ihrem Vorhaben nicht abrücken zu wollen. Soviel war klar.
Der Zug fuhr langsam und quietschend in den Frankfurter Hauptbahnhof ein. Ich reckte meinen Hals. Die Züge interessierten mich. Manchmal konnte man hier noch eine alte Dampflock sehen. Die meisten Loks fuhren ja mit Elektrizität. Nur wenige Male kam noch so ein dampfendes Ungetüm in den Bahnhof hereingefahren. Blies seinen Qualm bis unter das hohe Dach, durch das bei Regen das Wasser bis auf die Bahnsteige tropfte. Nur heute leider nicht.
Ich stieg auf, so wie ich es mit meinen Eltern zuvor besprochen hatte. Schaute noch kurz aus dem Fenster, ob bereits mein Vater in Sichtweite stand. Hoffte, dass der „Onkel“ mich irgendwie aus den Augen verlieren würde. Doch dieser schien seinen selbstauferlegten Auftrag durchaus ernst zu nehmen. Der Bahnsteig war nicht sonderlich mit Reisenden gefüllt und da sah ich auch schon den hellen Trenchcoat meines Vaters. Mit schnellen Schritten ging ich auf ihn zu. Schaute in das vertraute Lächeln. Eine Umarmung blieb wie üblich aus. Mein Vater nahm schnell den Mann wahr, der mir folgte. Sein Lächeln verwandelte sich in einen ernsten Ausdruck. Der „Onkel“ redete mit vielen Worten auf ihn ein. Es war ein Wortschwall an Vorwürfen und Anschuldigungen. Doch mein Vater beendete den Monolog auf seine Weise: „Sie können Ihre Kinder ja wie kleine Dackel an der Leine erziehen. Ich tue das nicht.“
Dann nahm er mich an die Hand und ging in Richtung Ausgang.
Acht Wochen später saß ich dann tatsächlich alleine im Zug in die DDR. Der Grenzbeamte schaute erstaunlich freundlich auf die Einreiseformulare. Immer wieder blätterte er in den unzähligen Papieren hin und her. Als würde er noch ein einziges Formular vermissen. Doch dann zog er doch seinen Stift. Schrieb auf einige der grau-gelben Zettel ein paar Bemerkungen, sortierte in routinierter Art und Weise die Papiere und reichte sie in meine kleine Kinderhand zurück. „Dann wünsche ich dir noch eine gute Reise.“
Ich bedankte mich brav und steckte meinen Pass mit den Einreiseformularen zurück in meinen roten Brustbeutel. Meine Hände strichen sicherheitshalber noch einmal über den verschlossenen Reisverschluss. Ich spürte die Fransen an der Unterseite des Brustbeutels. Der Grenzbeamte zog die Abteiltür hinter sich zu, schenkte mir noch einen letzten freundlichen, zugleich verwunderten Blick und setzte seine Kontrollroutine fort. Auf den Gleisen liefen in den gleichen Uniformen noch andere Grenzbeamte umher. Einige von ihnen hatten ihre Maschinengewehre locker um die Schulter gehängt. Die Grenzer machten auf mich nicht den Eindruck, als wären sie sonderlich besorgt, dass jemand illegal in die DDR einreisen würde. Ich wusste, dass die Soldaten bei der Ausreise aus der DDR weitaus sorgfältiger den Zug untersuchten. Für mein Alter wusste ich bereits ziemlich viel über die Grenze, über die DDR und über die BRD, die eigentlich gar nicht BRD hieß. Für dieses Wissen hatte mein Vater gesorgt. Er hatte mir auch genau erklärt, was passieren würde, wenn ich mit dem Zug in die DDR fahren würde. Und mein Vater hatte in jedem Punkt recht behalten. Es lief in jedem Detail genauso ab, wie ich es immer wieder von ihm erklärt bekommen hatte. Selbst das Lächeln des Grenzbeamten hatte mein Vater vorhergesagt.
Der Zug machte einen kurzen Ruck. Mir war klar, dass dies die Vorankündigung für die Abfahrt sein würde. Die Grenzbeamten hatten inzwischen den Zug verlassen und trotteten zurück in ihre Barracken. Der westdeutsche Schaffner ging durch den Gang an meinem Abteil vorbei, schaute mich lächelnd an, so wie er es seit seiner Abfahrt in Frankfurt schon so häufig getan hatte. Die nächste Station würde Eisenach sein. Das vorläufige Ende meiner Reise.
Das erste, was ich auf den nächsten Kilometern wahrnahm, war der Geruch der DDR. Er drang erstaunlich schnell in das verschlossene Abteil. Erst Jahre später wurde mir klar, dass das die verbrannte Braunkohle in der Luft war, die ihren grauen Dunst über das ganze Land legte. Für mich war nicht nachvollziehbar, warum so viele Erwachsene so schlecht über dieses andere Deutschland sprachen. Ich hätte gerne eines der leuchtend blauen Halstücher getragen, wäre gerne mitmarschiert bei den farbenfrohen Paraden zum Ersten Mai. Ich trank gerne diese pinkfarbene Brause. Und das Sandmännchen war sowieso viel besser als das des Westfernsehens. Deshalb empfand ich den Braunkohlegeruch nicht als Gestank, sondern als ein Indiz. Ein Indiz für eine Umgebung, die einfach anders roch, anders aussah und in der man einfach anders lebte.
Anna war sprachlos. Ihr Blick wandte sich von den Fahrzeugscheinwerfern beleuchtenden, vorbei huschenden Leitplanken auf Michael. Die Autos auf der Gegenfahrbahn blitzten im Gegenlicht und unterstrichen die Silhouette seiner markanten Gesichtszüge. Michaels Augen blieben konzentriert nach vorne gerichtet und bemerkten Annas Nachdenklichkeit nicht.
Sie hatten inzwischen seit einiger Zeit die ostdeutsche Grenzkontrolle für Transitreisende hinter sich. Mit exakt 100 Stundenkilometern steuerte Michael den Wagen über die das Fahrwerk zum Pulsieren bringende Betonpiste. Die Sonne hatte sich inzwischen völlig zurückgezogen und die Nacht tauchte den Himmel in ein tiefes Schwarz, das von keinerlei künstlicher Beleuchtung erhellt wurde. Von Zeit zu Zeit konnte man am Horizont einen kleinen Ort erahnen, dessen winzig funkelnden Lichter kaum durch die tiefe Dunkelheit dringen konnten. Im Kegel des Scheinwerferlichtes rumpelten die beiden durch die nächtliche DDR.
Michaels Geschichte hinterließ eine Stille im Auto, die zwischen dem Paar nicht häufig auftrat. Bis ihn Anna bat, noch mehr aus seiner Kindheit zu erzählen. Eine Geschichte, in der er bereits älter war. Eine Episode mit seinem Vater. Über die Grenze. Und Michael ließ sich nicht zweimal bitten.
„Nachts hören wir manchmal die Selbstschussanlagen. Dann wissen wir, dass die Hasen über den Todesstreifen hoppeln.“ Der Mann erzählte das mit einer eigenartigen Selbstverständlichkeit. Ich dachte an die Hasen und mir lag die Frage auf der Zunge, ob sie dies überlebten. Doch ich wusste, dass ich mich mit dieser Frage jetzt zurückhalten musste. Das würde ich auf der Rückfahrt meinen Vater fragen, wenn dieser seine Reportage beendet haben würde. Auf dem Tisch lag ein kleines Diktiergerät und nahm jeden Satz des Gespräches auf. Er fragte nach. Es ging um die Grenzposten. Um die Zeit vor dem Mauerbau. Mein Vater konnte gut fragen. Fühlte sich in seine Gesprächspartner ein und beflügelte damit ihren Redefluss. Er war bekannt für seine detaillierten Recherchen und anerkannt unter seinen journalistischen Kollegen. Nicht umsonst nannten sie ihn Ludwig Wiesner, den Grenzgänger.
Der Mann hatte Vertrauen zu meinem Vater gefasst. Er sprach mit ihm, als würden sie sich schon ewig kennen. Zuvor waren wir von außen um das Haus gegangen. Mein Vater hatte fotografiert. Dann zeigte der Mann auf die zugemauerten Fenster auf der Hausseite, die der Zonengrenze zugewandt waren.
„Genau genommen dürfen wir diesen Teil des Hauses nicht betreten.“
Auf das fragende „Wieso“ meines Vaters erklärte der Mann weiter, dass dieser Teil des Hauses bereits auf DDR-Gebiet stand. Doch die Grenzziehung sei damals „großzügig“ in einem Bogen um das Haus herum gebaut worden. Ich hatte jetzt am Küchentisch immer noch das Bild vor Augen, das sich uns von außen offenbarte. Das Haus, das an den Hang der steilen Anhöhe gebaut war. Ähnlich der Bilder, die man aus alten Dokumentarfilmen kannte. Als in Berlin reihenweise Fenster von Wohnhäusern zugemauert wurden, deren Rückseiten West-Berlin zugewandt waren. Doch hier sah es anders aus. Hier stand dieses kleine Haus völlig alleine in der Wildnis, weit weg von Berlin auf der innerdeutschen Grenze. Über dem Anwesen erstreckte sich ein Berg, der drohend über dem Grundstück lag. Der an den Betonpfeilern befestigte Maschendrahtzaun, sich so indiskret an das Haus schmiegend, glich übergroßen Fingern, die nach dem Gebäude griffen. Und dicht dahinter lagen die Selbstschussanlagen, die in fünf Meter Entfernung ihre trichterartigen Öffnungen parallel auf den Bereich hinter dem Zaun richteten. Weiter oben auf der Anhöhe stand ein Wachturm. Er war noch einer der ersten Generation. Der eckige Ausguck thronte auf einer runden Betonsäule in der offenbar eine steile Leiter nach oben führen musste. Das Design des Turmes war so eigenartig wie auffällig. Ganz auf die Funktionalität der Überwachung ausgerichtet. Kaum hatte mein Vater seine Kamera gezückt, hatten sich die beiden Grenzposten auf ihrem Hochstand nach unten geduckt. Für diese Fälle waren wohl die kleinen Öffnungen unterhalb der Fenster des Wachturms vorgesehen. Durch diese würden die Grenzposten sie jetzt sicherlich im Augenmerk haben.
„Die ducken sich immer, wenn sie das Gefühl haben, selbst beobachtet zu werden. Besonders wenn man sie fotografieren will“, kommentierte der Mann beim Gang um das Grundstück. Mich amüsierte die Vorstellung, dass die beiden Grenzer jetzt auf dem Boden kauernd abwarteten, bis wir aus dem Sichtfeld waren.
„Kann man die Räume mit den zugemauerten Fenstern betreten?“ Die Frage löste bei dem Mann ein Stuhlrücken in der kleinen Küche aus: „Klar — kommen Sie mit.“
Wir standen auf und verließen den Raum. Mein Vater und ich folgten dem Mann durch die Wohnung. Am Ende des Flurs wartete eine gewöhnliche Zimmertür auf uns. Ohne dass uns der Mann den Hintergrund dieser Tür erläuterte, war klar, dass sie eine besondere Funktion in diesem Haus hatte. Der Hausherr fingerte ein Schlüsselbund aus seiner Hosentasche. Es dauerte einen Moment, bis er den richtigen Schlüssel unter dem Dutzend zu fassen bekam. Dann hörten wir den hohlen Klang des sich drehenden Schlüssels in dem veralteten Türschloss. Der Mann öffnete die knarrende Tür und ging voran.
„Wir haben hier drinnen kein Licht. Sie müssen etwas aufpassen.“
Es dauerte einige Minuten bis sich unsere Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Der Raum war unmöbliert. In der Ecke stand noch ein alter Besen gegen die Wand gelehnt. Durch die zugemauerten Fenster zeichnete das Tageslicht dünne Streifen entlang der zum Teil unverputzten Fugen. So wirkten die Fenster auf mich wie eine Installation in einer Kunstausstellung. Der Mann bemerkte mein Interesse an den lichteinfallenden Fugen: „Die haben sich damals ziemlich beeilt beim Zumauern der Fenster. Da war nicht viel Zeit für sorgfältiges Arbeiten. Kommen Sie. Da kann man durchschauen.“
Wir näherten uns mit einem Gefühl des Unbehagens den leuchtenden Schlitzen. Der Hausherr deutete auf einen besonders breiten Spalt: „Hier sieht man am besten.“
Mein Vater presste als erster seinen Kopf an den Spalt. Sein Auge war zunächst geblendet. Doch dann erkannte er den Zaun. Konnte die Selbstschussanlagen direkt vor sich sehen. Ein leises „Unglaublich!“ huschte über seine Lippen. Hinter dem Todesstreifen verlief ein zwei-streifiger Betonweg. Zwei weitere Grenzsoldaten stiegen gerade aus einem zum Militärjeep umgebauten Trabi. Anscheinend hatte die Anwesenheit eines westdeutschen Fotografen an der Grenze die Aufmerksamkeit bei den Kontrollpunkten ausgelöst. Einer der Soldaten trug ebenfalls eine Kamera mit einem langen Teleobjektiv. Ich hatte inzwischen auch durch einige Lücken in der Mauer gespäht und ebenfalls die Grenzer ausgemacht.
„Sind inzwischen weitere Grenzsoldaten angekommen?“
Die Frage des Mannes klang fast ein wenig amüsiert. Als würde er die Vorhersehbarkeit des Militärs belustigend finden. Mein Vater starrte noch immer wie gebannt durch den Mauerschlitz. Seinen Blick weiterhin auf die Abläufe an der Grenze gerichtet, begann er scheinbar zu sich selbst gewandt zu erzählen: „Nicht weit von hier habe ich als kleiner Junge Lebensmittel über die damals noch grüne Grenze geschmuggelt.“
Eine kurze Pause erfüllte den Raum. Dann fuhr er fort: „Dass das einmal irgendwann so aussehen würde …“
Der Mann hinter ihm setzte den Satz fort: „… hätte wohl niemand gedacht.“
Mein Vater trat einen Schritt zurück und schaute den Mann still an.
„Nein, wirklich nicht.“
Mir war dieser Blick vertraut. Es war einer dieser stillen Momente, die ich angesichts der Grenze häufig in seiner Gegenwart spürte. Wenn mein Vater mit dem gleichen stolzen Blick wie meine Großmutter über die Hügel des thüringischen Waldes blickte und dem Grenzverlauf mit seinen tiefliegenden Augen folgte. Der gerodete Streifen fraß sich durch die Wälder und hinterließ einen Abdruck in der Landschaft, als wäre er für die Ewigkeit gemacht. Wie ein Zeichen, eigenartig undurchdringlich. Und jetzt standen wir genau genommen auf dem Boden der DDR, starrten durch kleine Schlitze auf dieses eigenartige Bauwerk.
Mein Vater schien aus seiner Trance aufzuwachen.
„Ich würde gerne ein Bild von Ihnen vor diesen Mauerschlitzen machen. Das könnte vielleicht sogar das Titelbild des Artikels werden. Wären Sie damit einverstanden?“
Der Hausherr zuckte mit den Achseln und steckte seine Hände in seine Hosentaschen, als wäre er an dieser Sache gänzlich unbeteiligt.
„Klar — machen Sie nur.“
Annas Hand kraulte immer noch liebevoll Michaels Nacken. Hinter ihnen färbte sich bereits der Himmel zu einem zarten Rosa der Morgenröte. Vor ihnen leuchtete die unübersehbare, neon-farbene Reklamebeleuchtung einer Autobahntankstelle. Der glatte Straßenuntergrund ließ ihr Fahrzeug inzwischen wieder nahezu geräuschlos über die Fahrbahn gleiten. Der Westen hatte sie zurück.
„Wie lange brauchen wir noch?“ Anna gähnte.
„Versuch noch ein bisschen zu schlafen. Bis Bonn sind es noch zwei Stunden.“