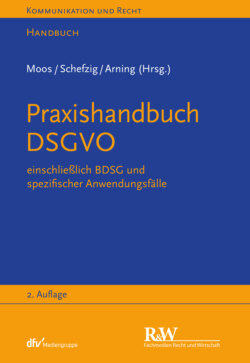Читать книгу Praxishandbuch DSGVO - Tobias Rothkegel - Страница 84
5. Verhältnis der Alternativen des Art. 6 Abs. 1 DSGVO zueinander
Оглавление105
Die verschiedenen in Art. 6 Abs. 1 DSGVO enthaltenen Erlaubnistatbestände stehen ausweislich des Wortlauts der Vorschrift („wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen“) gleichberechtigt nebeneinander. Das bedeutet insbesondere, dass keine dieser Alternativen eine Sperrwirkung gegenüber den anderen in Art. 6 Abs. 1 DSGVO enthaltenen Alternativen entfalten kann. Mit anderen Worten: Sind die tatbestandlichen Voraussetzungen einer Alternative erfüllt, kann eine nicht von dieser Alternative erlaubte Datenverarbeitung dennoch durch eine der anderen Alternativen erlaubt werden. So darf z.B. ein Verantwortlicher personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einem Vertrag mit der betroffenen Person verarbeiten, wenn dies nicht zur Erfüllung dieses Vertrages erforderlich ist – und damit die Voraussetzungen des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO nicht erfüllt sind –, aber z.B. seine berechtigten Interessen die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. In diesem Fall wäre die Verarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zulässig.156
106
Dies gilt nach hier vertretener Ansicht grundsätzlich ebenso im Verhältnis zwischen einer Einwilligung i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und den übrigen „gesetzlichen Erlaubnistatbeständen“, da die Einwilligung nur eine der in Art. 6 Abs. 1 DSGVO aufgeführten Bedingungen ist, die die Verarbeitung personenbezogener Daten zu rechtfertigen vermag.157 Solange eine dieser Bedingungen erfüllt ist, ist die Datenverarbeitung zulässig. Für die Praxis bedeutet dies, dass eine Datenverarbeitung nach hier vertretener Ansicht auch dann auf Art. 6 Abs. 1 lit. b–f DSGVO gestützt werden kann, wenn eine eingeholte Einwilligung unwirksam oder ein bestimmter Datenverarbeitungsvorgang von dieser nicht erfasst ist. Allerdings können die Umstände des Einzelfalls, warum eine eingeholte Einwilligung eine (geplante) Datenverarbeitung nicht erlauben kann, bei der Interessenabwägung im Rahmen des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO – und damit bei der Frage, ob die Daten auf Basis dieser Vorschrift (weiter-)verarbeitet werden dürfen – berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere für den Fall, dass eine betroffene Person ihre Einwilligung widerrufen hat.158
Standpunkte der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden und des Europäischen Datenschutzausschusses
107
Die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden scheinen „dem Nebeneinander“ von gesetzlichen Erlaubnistatbeständen und einer Einwilligung eher skeptisch gegenüberzustehen. So könne es z.B. gegen Treu und Glauben verstoßen, wenn ein Verantwortlicher sich auf eine gesetzliche Erlaubnisnorm berufe, wenn die betroffene Person ihre Einwilligung widerrufen habe. Damit wäre in diesem Fall bei der betroffenen Person durch die Einholung der Einwilligung der (falsche) Eindruck erweckt worden, dass die Verarbeitung ihrer Daten ihrem Wahlrecht unterliege.159
108
Auch der Europäische Datenschutzausschuss vertritt hierzu in seinen Leitlinien zur Einwilligung einen restriktiven Standpunkt. So sei es „gegenüber der betroffenen Person ein in höchstem Maß missbräuchliches Verhalten, ihr zu sagen, dass die Daten auf der Grundlage der Einwilligung verarbeitet werden, wenn tatsächlich eine andere Rechtsgrundlage zugrunde gelegt wird“. Deshalb könne ein Verantwortlicher nicht von einer Einwilligung zu einer anderen Grundlage wechseln. So müssten sich die Verantwortlichen vor der Erhebung der Daten entscheiden, auf welche Rechtsgrundlage sie die Verarbeitung stützen wollen, und die betroffenen Personen hierüber im Rahmen ihrer Informationspflichten informieren.160
109
Die Ausführungen des Europäischen Datenschutzausschusses beziehen sich nach hier vertretener Lesart allerdings (nur) auf den „nachträglichen Wechsel der Rechtsgrundlage“, also – überspitzt formuliert – ein Verantwortlicher, wenn die betroffene Person ihre Einwilligung widerruft oder sich herausstellt, dass diese unwirksam ist, dann prüft, ob er die Verarbeitung eventuell noch auf eine andere Rechtsgrundlage stützen könnte, um die Verarbeitung fortsetzen zu können. Mithin lässt sich diesen Ausführungen nach hier vertretener Ansicht nicht entnehmen, dass es der Europäische Datenschutzausschuss auch ablehnt, eine Verarbeitung von Anfang an (teilweise) sowohl auf eine Einwilligung als auch auf eine Rechtsgrundlage zu stützen (z.B. im Sinne einer Backup-Lösung).
Praxishinweis
Unternehmen sollten deshalb nur dann eine Einwilligung einholen, wenn die Datenverarbeitung nicht rechtssicher auf eine gesetzliche Erlaubnisnorm gestützt werden kann. Soll die Datenverarbeitung dennoch (z.B. im Sinne einer Backup-Lösung) sowohl auf gesetzliche Erlaubnistatbestände als auch auf eine Einwilligung gestützt werden, sollte das Unternehmen die betroffene Person über diesen Umstand transparent informieren, so dass bei dieser eben nicht der (falsche) Eindruck entsteht, dass sie die Datenverarbeitung „in der Hand habe“ – und sich der Verantwortliche nicht „nachträglich“ auf eine andere Rechtsgrundlage berufen muss.161