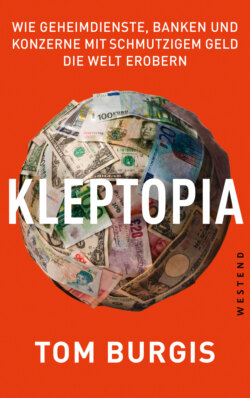Читать книгу Kleptopia - Tom Burgis - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Ein Fest
ОглавлениеWhitehall, Februar 2008
Im Februar 2008, als es noch möglich war, so zu tun, als gäbe es gar keine Krise, begab sich ein großer, hagerer Milliardär mit schmalem Gesicht und dünnem Haupthaar zum Banqueting House in Whitehall. Nur einen Steinwurf entfernt, in der Downing Street, verstaatlichte der Finanzminister gerade die pleitegegangene Bank Northern Rock. Wie überall im Westen begann jetzt auch in London die Rettung des Finanzsystems, ein Transfer staatlichen Vermögens in private Hand, der sich durchaus mit der Umverteilung messen konnte, die im Lauf des vorigen Jahrzehnts den märchenhaften Reichtum dieses Mannes und anderer Milliardäre geschaffen hatte. Die Krise war jetzt in aller Munde, aber in dem außergewöhnlich schönen Gebäude, das der Oligarch nun betrat, war nicht davon die Rede. Von der City aus brauchte man zu Fuß etwa eine halbe Stunde zu diesem Ort an einer Biegung der Themse, der entstanden war, nachdem James I. seinen Architekten Inigo Jones mit dem Bau eines Refugiums beauftragt hatte, in dem er seine Vorliebe für Masken und opulente Theateraufführungen zelebrieren konnte, bei denen Mitglieder der königlichen Familie sich verkleidet unter ihre Untertanen mischten. Später beauftragte James’ Nachfolger, Charles I., Peter Paul Rubens mit der Erstellung von neun Deckengemälden, die das gottgegebene Recht der Könige auf absolute Macht darstellen sollten. Im Januar 1649 gehörten diese Bilder dann zum Letzten, was Charles noch sah, als er – mit zwei Hemden am Leib, damit er in der Winterkälte nicht fror – durch die Festhalle zum Schafott geführt wurde, das vor dem Haus errichtet worden war und auf dem er als vom Parlament verurteilter Verräter sterben sollte. Heute blickten all die Putten und Löwen, der triumphale Sieg der Tugend über das Laster und der Weisheit über die Ignoranz auf für sieben Gänge gedeckte Tische und ein lebhaft musizierendes kasachisches Streichquartett hinunter.
Der Oligarch hieß eigentlich Alexander Maschkewitsch, doch seine zahlreichen Freunde zogen es vor, ihn einfach Sascha zu nennen. Ungeachtet seines Reichtums und obwohl er nun farbenprächtig und extrem teuer gekleidet war, war Sascha etwas von der Aura des Akademikers geblieben, der er einst gewesen war. Vielleicht war es seine Brille, vielleicht auch der penible Schnitt seines Oberlippenbarts. Sein Englisch hatte einen klaren Akzent, den ein ahnungsloser Westeuropäer oder Amerikaner sofort als russisch identifiziert hätte; aber obwohl Sascha tatsächlich die russische Staatsbürgerschaft besaß und einen Teil der turbulenten 1990er Jahre in Moskau verbracht hatte, war er ursprünglich Kirgise. Als Kirgisien noch eine an Asien grenzende Provinz des sowjetischen Imperiums war, war seine Mutter eine angesehene Staatsanwältin gewesen und Sascha ein vielversprechender junger Mann. Er hatte beachtliches sprachliches Talent und bekam einen Posten als Lehrbeauftragter für Philologie an der Universität von Bischkek. Vor ihm schien nun ein unbeachtetes Leben als Dozent zu liegen, aber dann kam der Kapitalismus. Mit einem Mal gab es noch etwas anderes, was er werden konnte: Geschäftsmann. Und Sascha wollte nicht einfach irgendwer sein, sondern ein Superstar. Er verglich sich mit einem Autor, der versucht, einen Bestseller zu schreiben. Das Geld wollte er, weil er erkannte, welche Macht es ihm verschaffen würde.
Vor drei Jahren hatte Saschas Name erstmals in der berühmten Forbes-Liste gestanden. Hierbei war auch sein »Nettovermögen« genannt worden: eine Milliarde Dollar. Er war nun gemeinsam mit Bill Gross, Martha Stewart, Michael Milken, Wilbur Ross und 66 weiteren gemeinsam die 620.-reichste Person der Welt. Das allein war schon ein großer Sieg gewesen. Und heute war sein Triumph sogar noch größer: Hier tummelte er sich unter Geldkönigen in Fleisch und Blut und begrüßte eine Berühmtheit nach der anderen im renommierten Banqueting House. Ivan Glasenberg, der Chef des großen Schweizer Handelshauses Glencore, der vermutlich größeren Einfluss auf die Rohstoffströme der Weltwirtschaft hatte als irgendein anderer, war hier. Auch der bedeutende israelische Diamantenhändler Beny Steinmetz war gekommen. Auch Sascha mochte wertvolle Steine: Er trug Schuhe mit eingelegter Diamantverzierung.
Aber so, wie viele der Monarchen, an deren Platz er nun saß, es hatten erfahren müssen, wusste auch Sascha, dass selbst scheinbar schrankenlose Macht nie absolut ist. Er und seine ebenfalls aus Zentralasien stammenden milliardenschweren Partner waren in der City als »das Trio« bekannt. Ihr Vermögen stammte aus den rohstoffhaltigen Erzen im Boden einer Steppen- und Bergregion, die zehnmal so groß wie Großbritannien war. Kasachstan war traditionell ein Land von Nomaden und Reitern (und zur großen Verärgerung seiner stolzen Herrscher auch die Heimat Borats). Weder Sascha Maschkewitsch noch seine Partner kamen ursprünglich von dort, aber dennoch kontrollierten sie inzwischen dem Vernehmen nach etwa 40 Prozent der Wirtschaft. Hier war ein riesengroßer Schatz vom sowjetischen Staat an Leute wie Sascha übergegangen, die das Talent hatten, sich in kürzester Zeit die kapitalistischen Spielregeln anzueignen. Mit Ausnahme Australiens, dessen Vorräte schon vor langer Zeit aufgeteilt worden waren, gab es dort mehr Uran als irgendwo sonst auf der Welt. Im Westen, unter dem Kaspischen Meer, lagerten schier endlose Vorräte von Öl. Solange die Menschheit – sei es aus Nuklearreaktoren oder der Verbrennung von Kohlenstoffen – Energie benötigte, würde Kasachstan Kunden für diese Rohstoffe haben. Dasselbe galt für sein Kupfer, mit dem die Drähte hergestellt wurden, die dafür sorgten, dass die Lichter der Zivilisation auch in Zukunft nicht ausgingen. Der größte Käufer dafür war in den 2000ern das benachbarte China. Zudem gab es noch Chrom, Eisen, Bauxit und Zink, und wie alle Länder, die hochwertige und dauerhafte Hightechprodukte herstellen wollten, brauchte auch China diese Materialien.
Es gab also Rohstoffe im Überfluss, und dieser Überfluss wurde von einem einzigen Mann kontrolliert.
Nursultan Nasarbajew war der letzte Vorsitzende der Kommunistischen Partei Sowjet-Kasachstans gewesen und ohne Unterbrechung seiner Herrschaft zum ersten kapitalistischen Führer des nunmehr von der Sowjetunion unabhängigen Kasachstan geworden. Er forderte vor allem zwei Dinge: Loyalität und einen Anteil an den Einkünften des Landes, der seinem Status als »Vater der Nation« angemessen war. Die Gunst dieses Mannes zu erlangen und zu behalten, war eine recht delikate Sache. Erst jüngst war der ehemalige Gatte seiner Tochter, ein dicklicher und etwas verschrobener Ex-Geheimdienstmann namens Rachat Älijew, der unter dem Namen »Sugar« bekannt war, nach Europa geflohen. Er behauptete, unter den Geheimdokumenten, die er angeblich vor seiner Flucht entwendet hatte, sei auch eine vom KNB, der kasachischen Nachfolgeorganisation des sowjetischen KGB, angefertigte psychologische Skizze des Präsidenten. »Er tendiert dazu, Personen in Gruppen, das heißt in ›seine‹ Gruppe und die der ›anderen‹, aufzuteilen. Wer seine Meinungen teilt und akzeptiert und tut, was von ihm erwartet wird, gehört zu ›seiner‹ Gruppe. Wer jedoch seine Meinung nicht akzeptiert, gehört zu den ›anderen‹ und ist daher ein Feind. […] Und wenn der Feind sich nicht ergibt, muss er vernichtet werden.«
Einer der Partner Saschas wurde einmal Zeuge eines Vorfalls, der den Charakter Nasarbajews klar zum Ausdruck brachte. Patokh Chodiev, ein »reinrassiger« Usbeke und Absolvent der prestigeträchtigen Moskauer Schule für Internationale Beziehungen, die seinerzeit von den Kindern der kommunistischen Elite besucht worden war, war sowjetischer Diplomat gewesen, bevor er zum Geschäftsmann wurde. In diesem Rahmen lernte er Nasarbajew kennen und stand schließlich in so enger Beziehung zu ihm, dass dieser ihn 1995 einlud, die »First Family« auf ihrem Urlaub an der französischen Riviera zu begleiten. Gastgeber war Behgjet Pacolli, ein Unternehmer aus dem Kosovo, der Geschäfte mit dem kasachischen Staat plante. Eines Tages organisierte Pacolli einen Ausflug zu einem Restaurant im Umland Monacos. Als die Gäste am vereinbarten Ort, dem Restaurant Le Pirate, ankamen, machte sich bei ihnen große Skepsis breit. Holzbänke, Kaminfeuer, rußgeschwärzte Balken, keinerlei Kristallleuchter irgendwo: So war ein Khan des heutigen Kasachstans nicht zu speisen gewohnt! Chodiev nahm ganz außen in der Nähe der Türe Platz. Nun servierten Kellner in Piratenkostümen den Gästen Gerichte, deren Teller einen von ihnen an Gefängnisgeschirr erinnerten. »Wo zum Henker habt ihr uns hier hingebracht?« herrschte der Präsident Pacolli an und Pacolli erblich. Sodann griff sich Nasarbajew einen der Teller und schmetterte ihn, gefolgt von betretenem Schweigen, zu Boden. Dann nahm er einen weiteren Teller und zerschmetterte auch diesen. »Sowas ist doch kein Erholungsurlaub, verdammt noch mal!«, schrie er. Seine Frau Sara war den Tränen nahe. »Nursultan, Nursultan, beruhige dich«, bettelte sie. »Wenn es dir hier nicht gefällt, lass uns woanders hingehen. Hör bitte auf und beruhige dich.« Aber Nasarbajew war nicht zu besänftigen und schleuderte als Nächstes einen Holzstuhl ins Feuer. Auch der Restaurantbesitzer – im Kostüm eines Piratenkapitäns – ließ sich jetzt plötzlich völlig gehen. Er schnappte sich ebenfalls einen Stuhl und schleuderte ihn ins Feuer. Nasarbajew warf noch einen Stuhl hinterher und dann noch einen. Die beiden gingen dazu über, die Bestuhlung völlig auseinanderzunehmen, doch schließlich änderte sich ihre Mimik vollkommen. Sie brachen in Gelächter aus. Pacolli stimmte mit ein und nun bogen sich alle drei vor Lachen. Atemlos vor Begeisterung erklärten sie dem verblüfften Publikum, dass alles nur ein Scherz gewesen sei. Die Inszenierung solch brachialer Spektakel zur Belustigung der in den »Witz« eingeweihten Auftraggeber war die Spezialität des Restaurants. Und da alle Scherze des Khans schon per Definition sehr lustig waren, ging der Rest der Reisepartie sofort zur Zertrümmerung des übriggebliebenen Geschirrs über.
Chodiev, Sascha und die anderen Oligarchen Kasachstans waren sich darüber im Klaren, dass ein Präsident das, was er gibt, auch wieder nehmen kann. Einer von ihnen, Muchtar Äbljasow, war so unverfroren gewesen, demokratische Reformen zu verlangen. Daraufhin war sein Unternehmen konfisziert und er selbst in ein Gefängnislager gesteckt worden. Sugar hatte Nasarbajew drei Enkel geschenkt, Nachkommen, mit denen er eine Dynastie aufbauen konnte, aber als er es wagte, sich gegen den Chef aufzulehnen, konnte nicht einmal das ihn retten. Ein Ex-Minister, der sich der Opposition angeschlossen hatte, wurde tot aufgefunden. Dem offiziellen Bericht zufolge hatte er Selbstmord begangen, indem er dreimal auf sich selbst schoss.
Für Oligarchen, die in einer solchen Lage nach Sicherheit suchten, gab es eine Option, die so wagemutig war, dass man sie für undurchführbar halten konnte. Das Erste, was man dazu tun musste, war die Umwandlung des eigenen Unternehmens in eine Aktiengesellschaft, eine der mächtigsten, im Westen nur zu gern geglaubten Fiktionen, die Schutz und Privilegien verleiht und die gleichzeitig herrlich einfach zu gründen ist. Zweitens musste man diesem Unternehmen alle Vermögensstände überschreiben, deren Erwerb Nasarbajew einem erlaubt hatte – Bergwerke, Banken und vieles andere mehr. Als Drittes musste man dann einen Teil der Unternehmensaktien für westliche Valuta verkaufen. Tatsächlich hatten Sascha, seine Partner und ihre Hunderte von äußerst bedeutenden Gästen sich zur Feier des erfolgreichen Abschlusses eines cleveren Geschäfts genau dieser Art im Banqueting House versammelt. Er und die beiden anderen Mitgründer der Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) hatten einen Großteil ihrer Aktien an meistbietende Interessenten verkauft, die nun an der Londoner Börse damit handeln konnten. Für den kirgisischen Philologen, den usbekischen Diplomaten und den undurchsichtigen uigurischen Gewerbetreibenden und dritten Mann des Trios, Alidschan Ibragimow, war das ein Traum, der Wirklichkeit geworden war. Und das Beste war, dass der Wert der Anteile so in die Höhe schoss, dass die ENRC schon jetzt auf dem Weg in die FTSE-100-Liste der vermögendsten britischen Aktiengesellschaften war. Dementsprechend investierten jetzt viele Manager von Stiftungen und Pensionsfonds in dieses vielversprechende Unternehmen und verknüpften so ihre eigene Zukunft mit der Zukunft Saschas.
Andererseits war die Aktion auch nicht billig gewesen. Um einen Fuß in die City zu kommen, bedurfte es vieler Unterstützer. Die Banker der Deutschen Bank, der Credit Suisse sowie von Rothschild, Morgan Stanley und ABN Amro verlangten 118 Millionen Dollar. Dazu kamen noch die Anwälte der Firmen Jones Day und Cleary Gottlieb. Weitere 30 Millionen Dollar gingen an die Wirtschaftsprüfer (oder »professionellen Dienstleister«, wie diese Unternehmen sich damals nannten) von PwC. Auch die Aufwendungen für all die Prominenten, die sich bereit erklärt hatten, Vorstandsmitglieder zu werden, gingen jedes Jahr in die Hunderttausende. Doch ohne diese Namen ging es nun einmal nicht. Die »City-Granden«, wie sie in der Wirtschaftspresse gern genannt wurden, flößten das notwendige Vertrauen ein. Unter ihnen waren auch zwei echte Ritter: Sir Paul Judge, der ehemalige Generaldirektor der Konservativen Partei, und Sir Richard Sykes, Vorsitzender von GlaxoSmithKline und Rektor des Imperial College. Ein weiteres Vorstandsmitglied, Ken Olisa, war führender Manager bei IBM gewesen und Roderick Thomson war, einem damals beliebten Euphemismus zufolge, »Risikokapitalanleger«. Bei Gerhard Ammann handelte es sich um den früheren Geschäftsführer der Schweizer Filiale der Wirtschaftsprüfungsfirma Deloitte, die wie PwC zu den »Großen Vier« in diesem Bereich gehörte, die nicht nur die Bücher der FTSE-100-Unternehmen, sondern auch die der Ministerien rund um das Banqueting House überwachten.
All diese Leute waren ihr Geld wert gewesen. Das Wichtige für Sascha und seine Partner war, die Geschichten zu formen, die über sie erzählt wurden. »Die Vergangenheit lauert in der Gegenwart auf dich«, lautet ein beliebtes kasachisches Sprichwort. Vor der Börsenakkreditierung der ENRC hatte es einen heiklen Moment gegeben, als die Regulatoren der Londoner Aktienbörse auf gewisse frühere Probleme des Trios in Belgien gestoßen waren. Einige Jahre vor seinem späteren Sturz und zu einer Zeit, als er seinen Schwiegervater noch kritiklos verehrte, hatte Sugar sich – erfolglos – als Intrigant betätigt und zur Stärkung seiner eigenen Position nach Wegen gesucht, die Position des Trios an Nasarbajews Hof zu schwächen. Also teilte er den belgischen Behörden mit, das Trio (und andere seiner Gegner) verwende Bestechungsgelder von westlichen Investoren zum Erwerb von Luxusimmobilien im Westen, darunter auch in Brüssel. Allerdings verfolgten die Ermittler in Europa die Hinweise Sugars intensiver, als dieser es beabsichtigt hatte, und entdeckten auch Nasarbajews geheime Bankkonten. Daraufhin klagten die Belgier das Trio wegen Geldwäsche an: des Verbrechens, aus kriminellen Aktivitäten stammendes Geld als ganz gewöhnliches Geld zu tarnen. Das Verfahren zog sich endlos hin und war noch immer nicht abgeschlossen, als die ENRC in London an die Börse gehen wollte. Doch falls das Trio je um die Fortführung seiner Geschäfte gefürchtet haben sollte, hätte es die Gier der City nach seinem Geld unterschätzt. Man traf einfach ein Gentlemen’s Agreement: Die Anteile der ENRC gingen wie geplant an die Börse, aber das Trio übernahm keine Vorstandsposten in dem neu gegründeten Unternehmen, obwohl ihm immer noch fast die Hälfte der Aktien gehörte. Die Behörden taten sogar noch mehr, um dem Trio das Gefühl zu geben, willkommen zu sein. James Leigh-Pemberton von der Credit Suisse überredete die Finanzaufsicht zu einer großzügigen Auslegung der Bestimmungen, die den wahren Besitzern der ENRC, das heißt dem Trio, dem kasachischen Staat und einem weiteren Oligarchen, erlaubte, lediglich 18 Prozent der Aktien auf den Markt zu bringen und damit nur ein Minimum an Kontrolle zu opfern, um das begehrte Ziel einer Listung an der Londoner Börse zu erreichen.
All das kam gerade noch zur rechten Zeit. Den Weitsichtigeren in der City war klar, dass ihr langer Marsch zu einer immer perfekteren Freiheit, der mit dem Paukenschlag Margaret Thatchers begann und dann, zu ihrer freudigen Überraschung, auch unter Blairs New Labour weiterging, für lange Zeit unterbrochen würde, sobald der Bevölkerung klar wurde, dass man ihr die Kosten der kommenden Krise aufbürden wollte. Die aus der ehemaligen Sowjetunion stammenden Moneymen und die Wirtschaftsliberalen der City waren sich einig in ihrer Verachtung für den Staat. Sie hatten hervorragende Geschäfte miteinander gemacht, bei denen sich die Triumphe der proletarischen Industrialisierung in reiche Aussichten auf dem Aktienmarkt verwandelten. An der Börse wurde das Einwerben von Listungen mit großzügigen Boni belohnt. Oder wie einer der Leiter der Börse meinte: »Warum sollten die ENRC und alle möglichen anderen denn nicht nach London kommen? Wir haben sie doch eingeladen. Sie mussten gar nicht groß darum bitten.« Und außerdem hatten die Londoner Banker und Anwälte und die Oligarchen und ihr Gefolge sehr ähnliche außergeschäftliche Vorlieben. »Prostituierte vom Allerfeinsten. Sämtliche nur vorstellbaren Drogen. Alle Arten von Mädchen. Geld ohne Ende. Ohne Ende.«
Obwohl niemand den genauen Tag oder die genaue Uhrzeit hätte nennen können, war diese Zeit zu Ende gegangen und eine andere angebrochen. Der offensichtlichste Grund dafür war die Krise, die ununterbrochen in aller Munde war und von der es kein Entkommen gab. Aber viel weiter in der Tiefe, im schwarzen Untergrund des geheimen Geldes fanden noch wesentlich grundlegendere Veränderungen statt. Hier und da drangen diese Verwerfungen an die Oberfläche vor und verursachten Betriebsstörungen, deren Bedeutung schwer auszumachen war. Als die Moskauer Polizei am 23. Januar 2008 einen beleibten einundsechzigjährigen Ukrainer namens Sergei Schneider festnahm, dem Steuerhinterziehung vorgeworfen wurde, hielten manche Beobachter das für eine Botschaft, während andere es als eine ungeheuerliche Dummheit ansahen. Ein Sprecher des russischen Innenministeriums behauptete, den fünfzig vermummten Beamten, die den beleibten Mann im Rahmen einer Razzia bei einem seiner Geschäftspartner festgenommen hatten, sei erst zu diesem Zeitpunkt klar geworden, dass Sergej Schneider nur einer seiner vielen Aliasnamen war. Tatsächlich handelte es sich bei dem Mann, den sie nun in Gewahrsam hatten, um Semjon Mogilewitsch, den vielleicht mächtigsten kriminellen Akteur der gesamten Weltwirtschaft. In den gesetzlosen 1990er Jahren konnte in Russland jeder Gangster Geld machen; man musste damals schon ein lausiger Betrüger sein, um nicht reich zu werden. Fälschen, erpressen, illegalen Handel treiben konnten sie alle. Mogilewitschs einzigartiges Talent bestand darin, das Geld aus solchen Geschäften unerkannt um die ganze Welt zu schleusen und es dabei so zu verwandeln, dass der Makel seiner Ursprünge verschwand. Und das war in der ehemaligen Sowjetunion ein Können, das gefragter war als alle andere: die Fähigkeit, die aus den Ruinen des zusammengebrochenen Imperiums zusammengerafften schmutzigen Gewinne in die valide Währung der kapitalistischen Welt zu verwandeln, die Währung, mit der man das erwerben konnte, was dort verkauft wurde: Eigentum, Sicherheit, Legitimität. Mogilewitsch kannte die Gesetze der Ökonomie, die er zuerst in der Ukraine an der Universität und dann seit Ende der 1980er Jahre im Moskau der Übergangszeit studiert hatte. Brainy Don (»schlauer Boss«), so nannte man ihn, den Banker der Unterwelt. Obwohl in den USA vierzig Anklagen wegen organisierten Verbrechens, Betrugs und Geldwäsche in Dutzenden von Ländern gegen ihn anhängig waren und er des Weiteren diverser Mordaufträge beschuldigt wurde, hatte er vor seiner Festnahme völlig unbehelligt in Moskau gelebt. Bald gingen Gerüchte um, der für seine Festnahme verantwortliche Polizeikommandant sei für seine Aktion scharf getadelt worden. Die Festnahme Mogilewitschs hatte das Regime Wladimir Putins in eine peinliche Lage gebracht. Da er sich auf der FBI-Liste der meistgesuchten Verbrecher befand, konnten die Behörden ihn schwerlich einfach gehen lassen. Gleichzeitig waren sie auch nicht erpicht, den Brainy Don weiter in Haft zu halten. Nach außen hin musste er in der Öffentlichkeit als Staatsfeind dargestellt werden, aber in Wirklichkeit war er für die Art von Staat, die Putin gerade aufbaute, nämlich einen Gangsterstaat, ein Alliierter. Dennoch war die Festnahme vielleicht kein bloßer Zufall, oder wenn doch, dann einer, der der neuen Ordnung nützlich sein konnte. Für die Kleptokraten, die Kräfte also, die durch Diebstahl herrschten, war die Krise, in die die Demokratien gerade hineinschlitterten, eine günstige Gelegenheit. Und so hatte Putin vielleicht den passenden Augenblick gewählt, um dem Herren des schmutzigen Geldes klarzumachen, dass die Plünderungsorgie der 1990er Jahre nunmehr vorbei war und dass der Diebstahl von nun an einem höheren Zweck, einer Hierarchie, zu dienen hatte, der sich sogar der Brainy Don unterwerfen musste. Und das traf nicht nur auf ihn zu. Die Bereitwilligkeit der City of London, reiche Ex-Sowjets in ihrer Mitte zu begrüßen, stieß in Russland nicht mehr auf Gegenliebe.
Im selben Monat, in dem das Trio zum Bankett in Whitehall einlud, im Februar 2008, kamen ein Amerikaner und ein Brite spätabends im Hyatt-Hotel in der Nähe von Mable Arch zusammen. Der Brite, ein intellektueller, hochgewachsener Mann namens John Lough, war Angestellter von TNK-BP, einem Joint Venture der britischen Ölgesellschaft BP und einiger russischer Oligarchen. Da Lough fließend Russisch sprach und Jahre damit zugebracht hatte, erst für eine Denkfabrik der britischen Armee und dann als Chef des NATO-Büros in Moskau die Sowjetunion und die postsowjetische Gesellschaft zu studieren, war dies für ihn eine höchst interessante Arbeit. Die Geologen der BP erkundeten die Öl- und Gasvorräte Russlands: Es gab weltweit kaum größere Vorkommen und erst recht keine, in die sich westliche Unternehmen einkaufen durften. Lough und seine Kollegen hatten die Aufgabe, sich mit den auftretenden politischen Fragen zu beschäftigen. Seine Arbeit wurde von seinen Vorgesetzten geschätzt. Dennoch war er sich fast sicher, dass man ihn bald entlassen würde. Diese Ahnung verstärkte sich, als der Amerikaner ankam und einen aufgewühlten Eindruck machte.
Normalerweise sprühte Shawn McCormick vor Selbstvertrauen. Er war Anfang vierzig, trug gediegene Anzüge und pflegte sein Gegenüber mit einem eisenharten Händedruck zu malträtieren, den Lough immer als Autoritätsdemonstration auffasste. Im Unterschied zu Lough hatte McCormick nie Russisch gelernt, verstand sich aber dafür auf das, was Lough als »amerikanisches Unternehmer-Blabla« bezeichnete; dazu unternahm er gelegentlich Reisen in die USA, um sich den neuesten »Manager-Schwachsinn« anzueignen. Seine Karriere als Geschäftsmann war noch jung: Zuvor hatte McCormick in einem nachrichtendienstlichen Think-Tank in Washington gearbeitet und war dann unter Bill Clinton Mitglied des Nationalen Sicherheitsrats gewesen, wo er die höchste Sicherheitsfreigabe hatte. 2003 wurde er von TNK-BP angestellt, um ein Team für die Beziehungen der Firma zu staatlichen Stellen aufzubauen. Er kannte Lough von BP-Projekten, an denen sie in London zusammengearbeitet hatten, und so rekrutierte er ihn eines Tages bei einem gemeinsamen Mittagessen für sein Team. Allerdings sollte Lough, um die Zahl der Festangestellten niedrig zu halten, lediglich als Berater arbeiten. Lough war das ganz recht, da seine Kinder in England zur Schule gingen. So musste seine Familie nicht umziehen, während er selbst jeden Monat für ein oder zwei Wochen nach Moskau flog.
Bei seiner neuen Arbeit hatte Lough unter anderem Kontakt mit Bob Dudley, der aus Mississippi stammte, seit vielen Jahren in der Ölbranche tätig war und den die BP-Chefs zur Leitung von TNK-BP nach Moskau entsendet hatten. Lough erstellte Memoranden für Dudley und schrieb Reden für ihn, wobei er dessen Sprachduktus so nahe kam, dass Dudley beim Vorlesen das Gefühl hatte, als hätte er sie selbst verfasst. Lough hatte ein besseres Verhältnis zu Dudley als zu McCormick, obwohl er auch gegen ihn nichts einzuwenden hatte und ihn für klug und sehr professionell hielt. Im Sommer 2007, als Lough wieder einmal in Moskau war, zog McCormick ihn im riesigen Großraumbüro der TNK-BP in eine Ecke in der Nähe der Kaffeemaschine, wo ihnen kein anderer zuhören konnte. »Sie sollten sich darüber im Klaren sein«, sagte er, »dass Sie vom FSB überwacht werden.«
Lough war nicht überrascht, dass seine Arbeit die Aufmerksamkeit des russischen Geheimdienstes FSB auf sich zog. Der FSB hatte sich gegenüber seinem sowjetischen Vorgänger, dem KGB, kaum verändert. Putin, selbst ein KGB-Veteran, hatte den FSB zu einem zentralen Instrument seines Machtsystems gemacht. Es war noch nicht einmal ein Jahr her, dass russische Agenten ihren Ex-Kollegen Alexander Litwinenko vergiftet hatten. Die Beziehungen zwischen London und Moskau befanden sich auf dem Tiefpunkt. Lough wusste, dass er bereits während seiner Arbeit für die NATO in Moskau unter Beobachtung gestanden hatte. Bei seiner Tätigkeit für die TNK-BP hatte er immer sorgfältig darauf geachtet, seine Kontakte zur britischen Botschaft auf ein Minimum zu beschränken. Er blieb zwar mit einigen alten Kontakten wie dem österreichischen Verteidigungsattaché in Verbindung, mit dem er gern über die russische Politik fachsimpelte, aber er wusste, dass jeder Umgang mit den britischen Nachrichtendiensten seiner beruflichen Arbeit schaden konnte, und auch diese nahmen ihrerseits keinen Kontakt mit ihm auf. Aber natürlich war Lough klar, dass er an Dingen arbeitete, die für das Putin-Regime eine zentrale Rolle spielten. TNK-BP hatte die Rechte an einigen der reichsten Gasvorräte der ganzen Welt erworben, konnte diese aber nur mit Genehmigung der staatlichen Gesellschaft Gazprom ausbeuten, zu deren Leiter Putin einen alten Verbündeten ernannt hatte. Lough war nun Berater eines Teams, das mit der Analyse der Entscheidungsprozesse bei der Gazprom beauftragt war.
Einige Wochen nach McCormicks Warnung trat Lough die Rückreise nach London an. Er fuhr nicht gern mit dem Auto zum Flughafen, da der Verkehr in Moskau oft genauso unberechenbar war wie die Entscheidungen des Kremls, und nahm daher den Zug. Das war für ihn normalerweise die Gelegenheit, vor dem Flug noch einmal ein kleines Nickerchen einzulegen. Aber diesmal nahm ein anderer Fahrgast ihm gegenüber Platz und begann ein Gespräch. Der Mann war in den Vierzigern, stämmig, trug ein T-Shirt und hatte eine längliche Tasche dabei.
Merkwürdig, dachte Lough.
Er war ein hagerer Engländer mit der Aura eines Oxford-Professors, der ganz offensichtlich aus dem Ausland stammte. Noch nie hatten Fremde in Moskau versucht, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Dieser Mann aber fragte Lough nach seiner Familie, nach seiner Arbeit, nach seinem Leben in Großbritannien. Irgendwann wollte er außerdem wissen: »Haben Sie Angst vorm Fliegen?« Als der Zug ankam, nahm der Mann seine Tasche an sich, in der sich offensichtlich gar kein Gepäck befand, und eilte mit ihr ins Terminal. Lough checkte ein und ging zur Sicherheitsschleuse. Während er sich ihr näherte, winkte ein Angestellter ihn zu einer Gruppe von Zollbeamten hinüber. Sie überprüften seine Dokumente und seine Reisetasche. Einer von ihnen fragte, ob er verbotene Gegenstände dabeihabe. Er verneinte. Nun tauchte die Tasche auf, die er eingecheckt hatte, und sie durchsuchten auch diese. Sie legten ihm Formulare vor, mit denen er sich mit einer Leibesvisitation einverstanden erklärte, und dann wurde er in einen Raum geführt, der bis auf eine Bank und ein Waschbecken leer war. Lough wappnete sich innerlich und dachte, man würde ihn jetzt vielleicht mit einem Beutel mit Drogen konfrontieren, den man in seinem Gepäck platziert hatte. Die Beamten inspizierten sorgfältig seine Kleidung und sahen sich auch seine Schuhe ganz genau an. Kurz darauf hieß es, er könne gehen. Während er seine Habseligkeiten zusammensammelte, begann einer der Beamten mit ihm zu plaudern. Zum Schluss sagte er: »Eine letzte Frage noch, Mr. Lough. Haben Sie Angst vorm Fliegen?«
Das war eine unmissverständliche Warnung. Er verstand die Botschaft, und sie lautete: Wir haben dich im Auge, sei vorsichtig, wenn du nach Russland kommst. Er berichtete den Vorfall seinen Vorgesetzten. Ein Kollege mit Kontakten zum FSB erkundigte sich dort und bekam zur Antwort, Lough werde zwar möglicherweise überwacht, aber vermutlich werde ihm nichts weiter geschehen. Dabei war es das Wort vermutlich, das Lough im Gedächtnis haften blieb. Trotzdem reiste er im Januar 2008 ein weiteres Mal für einige Tage nach Moskau. Bei seiner Abreise wurde er erneut am Zoll zur Seite genommen und durchsucht. Diesmal rief er, nachdem er die Passkontrolle hinter sich hatte, sofort den Chef der TNK-BP, Bob Dudley, an. Damit wollte er den russischen Geheimdienstbeamten, die ja zweifellos Dudleys Telefon abhörten, die Botschaft senden: »Ich stehe in direktem Kontakt mit dem Chef der Firma, lasst diese Dummheiten also besser sein.« Zurück in England erklärte er McCormick, solange die Angelegenheit nicht aufgeklärt sei, sei es für ihn zu riskant, wieder nach Moskau zu kommen.
Um diese Zeit herum begann sich McCormicks Verhalten ihm gegenüber zu verändern. Als sie sich kurz nach dem Vorfall in Brüssel trafen, wirkte er auf Lough ungeduldig, aufbrausend, nervös. Er teilte Lough mit, sie würden bald wieder sprechen. Und nun nahmen sie weitere zwei Wochen später im Londoner Hyatt Platz. McCormick teilte Lough auf geradezu peinlich freundliche Art mit, man müsse ihn leider entlassen, da er jetzt nicht mehr nach Russland kommen könne. Man werde ihm noch drei Monatsgehälter auszahlen, aber McCormick verlangte von ihm, sofort seine Arbeit und die Mitwirkung an allen laufenden Projekten einzustellen. Dabei sagte McCormick, Bob Dudley habe der Entlassung zugestimmt, erwähnte dabei allerdings nicht, dass er selbst es war, der Dudley zu dem Glauben veranlasst hatte, Lough wolle gehen. Lough fühlte sich von alldem völlig überrollt. Als sie gingen, bot er McCormick, wie es Engländer nun einmal tun, die Hand. Aber zu seinem Entsetzen – er hatte, wie er es ausdrückte, »keine Vorliebe für herzlichen körperlichen Kontakt« – fand er sich plötzlich in McCormicks Umarmung wieder.
Ein Monat verging. Lough war zunehmend davon überzeugt, dass etwas sehr Eigenartiges im Gange sein musste. Und dann stürmten in Moskau Dutzende von bewaffneten FSB-Beamten in die nur einige Häuserblocks vom Roten Platz gelegenen Büros von TNK-BP und bohrten die Safes auf. Einige Tage zuvor hatte das FSB Ilya Zaslavskiy, einen aus Russland stammenden Amerikaner, der in Oxford studiert hatte, verhaftet. Er und sein Bruder hatten zusammen mit Lough am Gazprom-Projekt der TNK-BP gearbeitet. Nun wurden sie der Spionage beschuldigt. Zaslavskiy erkannte ziemlich schnell, dass es hier darum ging, ihn als einen Maulwurf hinzustellen, der seinem Auftraggeber, dem heimtückischen britischen Spion John Lough, Zugang zu Staatsgeheimnissen verschafft hatte. Ein solches Szenario war den Bemühungen der russischen Oligarchen, ihren britischen TNK-BP-Partnern ein höheres Maß an Kontrolle abzuringen, höchst förderlich. Es half außerdem dem Putin-Regime, zum Gegenschlag überzugehen, nachdem die Briten Putins Agenten eines Mordes auf britischem Boden beschuldigt hatten. Auch der wohlhabende ehemalige FSB-Beamte Andrei Lugowoi, der überall in London Spuren von Polonium hinterlassen hatte, bevor er – mutmaßlich – das Gift Alexander Litwinenko in den Tee tat, erklärte aus der Sicherheit der Immunität, die er seit Dezember 2007 als Abgeordneter des russischen Parlaments genoss, seine Unterstützung für die Spionageermittlungen. Es spielte keine Rolle, dass die TNK-BP das wichtigste angeblich von Zaslavskiy gestohlene Dokument, den nichtssagenden Gazprom-Strategieplan, in Wirklichkeit ganz offiziell von den russischen Behörden erhalten hatte. Jetzt wurde dieses Dokument zu einem Geheimnis von unschätzbarem Wert aufgeblasen, das Russland dem Bericht einer Pro-Kreml-Zeitung zufolge Milliarden von Dollar gekostet hätte, wenn es dem Westen in die Hände gefallen wäre.
Zwei Wochen nach Zaslavskiys Verhaftung wurde Shawn McCormick vom FSB ins Lefortowo-Gefängnis zur Vernehmung bestellt. Es war ein Ort der Schrecken, die bis zu Stalins Säuberungen zurückgingen. Dissidenten und Vaterlandsverräter von Alexander Solschenizyn bis Litwinenko waren hier in Haft gewesen. Gegenüber US-Diplomaten in Moskau hatte McCormick behauptet, er mache sich über die Vorladung des FSB keine Sorgen, da man ihm mitgeteilt habe, man betrachte ihn nicht als Verdächtigen, sondern lediglich als Zeugen. Ein weniger mächtiger Mann hätte sich vielleicht größere Sorgen gemacht: Immerhin hatte eine wichtige russische Zeitung geschrieben, neben Zaslavskiy verdächtige das FSB auch »Shawn McCormick, den Chef der TNK-BP-Abteilung für Internationale Beziehungen, der demnach aus Russland ausgewiesen werden könnte«. Und das FSB hatte gegenüber der Presse erklärt, Ermittler hätten bei der Durchsuchung des TNK-BP-Büros Visitenkarten von CIA-Beamten gefunden. Zum genauen Fundort wurde dabei nichts gesagt, aber von den fraglichen Personen im FNK-BP-Büro hatten weder Lough noch Zaslavskiy je mit dem Geheimdienst zu tun gehabt – das war nur bei McCormick der Fall. Während seiner Arbeit im Weißen Haus hatte er Zugang zu Dokumenten der höchsten Geheimhaltungsstufe gehabt, was ihm ermöglicht hatte, die Berichte der US-Spione rund um die Welt zu lesen. Jetzt saß er deren russischen Kollegen gegenüber. In einer 17 Stunden dauernden Befragung gab er ihnen einen Bericht, der zwar leicht verzerrt war, aber sich dadurch umso besser in das Narrativ des FSB einfügte.
»Ich möchte hier auf den ungewöhnlichen Status John Loughs verweisen«, so McCormick. Damit bezog er sich darauf, dass Lough auf Honorarbasis statt als Angestellter gearbeitet hatte – ein banales Arrangement, das nun mit einem Mal verdächtig wirkte. McCormick versäumte auch nicht, auf Loughs ehemalige Tätigkeit für die NATO aufmerksam zu machen. Des Weiteren kannte Lough zwar einige kleine Fische im Foreign Office und keine wichtigen Politiker, aber in McCormicks Bericht wurden daraus »umfangreiche Beziehungen zur britischen Regierung«. McCormick schien in jeder Hinsicht bemüht, die Fakten an das Szenario des FSB anzupassen, und das besonders da, wo es um Loughs Beziehungen zu dem eigentlichen Schurken im Stück des FSB, dem russisch-amerikanischen Unternehmer und Aktivisten Ilya Zaslavskiy, ging.
Wenn Zaslavskiy und Lough im Rahmen ihrer Arbeit miteinander gesprochen hatten, hatten sie das in förmlichem Russisch getan; ansonsten hatten sie gar keinen Umgang miteinander gehabt. Aber obwohl McCormick selbst gar kein Russisch konnte, behauptete er nun, die beiden hätten sehr locker miteinander geplaudert und ein Verhältnis gepflegt, »das über Geschäftsbeziehungen hinausging«. Er erläuterte den Ermittlern: »Man könnte durchaus sagen, dass sie Freunde waren.« Weiter meinte McCormick, Lough habe die TNK-BP dazu aufgefordert, Zaslavskiy als Berater einzustellen. In Wirklichkeit hätte er, selbst wenn er das gewollt hätte, in der Firma dazu gar nicht die Befugnis gehabt. Lough und Zaslavskiy hatten beide im Gazprom-Team der TNK-BP gearbeitet und unterstanden dort einem Schotten als Chef. Auch hier entsprach die Version McCormicks nicht der Realität: Er erzählte dem FSB, Zaslavskiy sei der Untergebene Loughs gewesen und dieser sein »Vorgesetzter«. In ihrem Protokoll verwendeten seine Vernehmer dafür dasselbe Wort, das man im Russischen für die Führungsperson eines Agenten benutzen würde.
Die FSB-Ermittler fertigten eine Zusammenfassung der Aussagen McCormicks an, die dieser unterschrieb. Diese fügten sie dann ihrer Akte hinzu, die bereits eine ähnlich hilfreiche Aussage enthielt, welche ein anderer Zeuge am Tag zuvor gemacht hatte. Sergei Novosyolov war einer der höchsten Ermittler der Abteilung des russischen Innenministeriums für organisiertes Verbrechen im russischen Innenministerium gewesen, bevor er Vizepräsident der TNK-BP für wirtschaftliche Sicherheit wurde. In seiner Vernehmung hatte er behauptet, McCormick habe ihm erzählt, John Lough sei auf Empfehlung Bob Dudleys eingestellt worden, eine Fehlinformation, die nun auch den obersten Mann von BP in Russland in das Spionageszenario verwickeln konnte. Dabei gab Novosyolov einige Aspekte der Arbeit Loughs and Zaslavskiys durchaus korrekt wieder, erzählte den Ermittlern des FSB aber auch eine Reihe verfälschter Einzelheiten, die ihnen bei der Konstruktion eines imaginären Spionagerings helfen konnten. So nahm dieser Fall wie bei den besten »aktiven Maßnahmen« des KGB im Kalten Krieg Gestalt an: Man braucht dazu neben ein paar wahren Fäden eine Anzahl unentbehrlicher Fiktionen und muss dann alles zu der Lüge verdrehen, die man gerade benötigt.
Ilya Zaslavskiy und sein Bruder waren nun mit der Aussicht auf fünf bis zwanzig Jahren Haft konfrontiert. Weil sie die Nerven behielten und kein Geständnis ablegten, konnte das Pseudogericht, vor das sie gestellt wurden, sie lediglich wegen versuchter Wirtschaftsspionage verurteilen. Sie erhielten eine Haftstrafe von einem Jahr, die auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde, entschieden sich aber dann dafür, ins Exil zu gehen. John Lough erhielt ein Einreiseverbot. Kurze Zeit später begann Bob Dudley, sich körperlich unwohl zu fühlen. Er machte einem Bluttest und in seinem Umfeld hieß es, man habe Gift in seinem Blut gefunden. Weiter hieß es, er habe sich erst erholt, als er aufhörte, die Produkte der Kantine der TNK-BP zu konsumieren. Als er hörte, dass die Behörden vorhatten, ihn zu verhaften, begab er sich so rasch wie möglich außer Landes. Hunderte von weiteren BP-Angestellten waren ebenfalls gezwungen, Russland zu verlassen.
Kurze Zeit später kündigte Shawn McCormick bei BP. Er hatte sein Talent demonstriert, bei der Schaffung alternativer Realitäten mitzuwirken, die dann als Waffe verwendet werden konnten. Es war ein Talent, das sich für seinen nächsten Arbeitgeber noch als nützlich erweisen sollte – das Trio.
Die Fähigkeit zur Widerspiegelung einer alternativen Realität war wertvoller als jedes Ölfeld und sämtliche Reserven kostbarer Metalle. Dennoch war es nicht schlecht, hin und wieder, wie zum Beispiel in der Ungestörtheit eines eigens für den Abend angemieteten königlichen Maskenpalastes, die köstlichen Momente zu genießen, in denen man die echte Realität betrachtete und die Dinge so sah, wie sie wirklich waren. In just einem solchen Augenblick erhob sich jetzt Ivan Glasenberg, der als Chef von Glencore der König aller Handelshäuser war, um in seinem steifen Johannesburger Englisch einige Kommentare abzugeben. Laut Glasenberg schuldeten die Anwesenden seinem Heimatland einigen Dank. Die Regierung Südafrikas kämpfte immer wieder mit dem Zusammenbruch der Stromversorgung, was das Leben der Bevölkerung noch schwerer machte, als es ohnehin schon war. Außerdem hatte die Regierung der Bergbauindustrie die Subventionen gestrichen, was den Preis der dort abgebauten Metalle in die Höhe trieb. Dann kam Glasenberg zur Pointe: Diese Probleme Südafrikas waren gut für alle Unternehmen, die diese Metalle anderswo abbauten – nicht zuletzt für die ENRC, deren Aktienkurs sich dadurch verdoppelt hatte. Die Anwesenden johlten vor Gelächter und klatschten sich mit den Fäusten in die Hand.
An diesem Abend begann Sascha, immer noch unter den Bildern von Gottkönigen am Tisch des Gastgebers sitzend, das Ausmaß zu begreifen, in dem sich Geld in Macht verwandeln ließ. »Es ist unfassbar aufregend«, berichtete er einem befreundeten Geschäftsmann in der kasachischen Heimat kurz nach der Listung der ENRC. »Du kapierst gar nicht, was für Provinzler wir sind. Hier tun sich ganz neue Horizonte auf.«