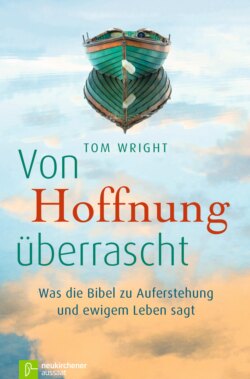Читать книгу Von Hoffnung überrascht - Tom Wright - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Die Auswirkungen der Verwirrung
ОглавлениеDiese vielschichtige Verwirrung zeigt sich in den Kirchenliedern, die wir singen, in der Art und Weise, wie wir das christliche Kalenderjahr begehen, und in der Art unserer Beerdigungen oder Kremationen. Ein paar Worte zu jedem dieser Dinge werden verdeutlichen, was ich meine.
Zunächst: Choräle. Ein flüchtiger Blick durch ein durchschnittliches Gesangbuch offenbart, dass ein Großteil der Verweise auf das zukünftige Leben jenseits des Todes näher an Tennyson oder gar an Shelley ist als am orthodoxen Christentum:
Bis wir im Ozean deiner Liebe
uns im Himmel über uns verlieren.
Die Worte stammen vom frommen John Keble, aber er ist es, der sich für einen Moment verliert, und zwar nicht im Christentum, sondern in einer buddhistischen „Tropfen-im-Ozean-Eschatologie“.35 Und wie steht es mit seinem Kollegen aus der Oxford Bewegung, John Henry Newman, mit seinen fast schon gnostisch anmutenden Liedzeilen?
So lange hat deine Kraft mich gesegnet, sicher
wird sie mich weiterführen,
über Moor und Marsch, über Klippe und Flut, bis
die Nacht vorüber ist.
Und mit dem Morgen lächeln jene Engelgesichter
die ich seit langem geliebt habe und eine kurze Zeit verloren hatte.
Glaubte Newman wirklich daran, dass er ein früheres Leben bei den Engeln gehabt hatte, sei es vor seiner Zeugung oder in der frühen Kindheit, und dass er recht bald dorthin zurückkehren wird? Und: Wenn die Vorstellung von einem einsamen Pilger, der einem „freundlichen Licht“ über Moore und Marschen folgt, auch eine machtvolle romantische Vorstellung ist – dachte er wirklich, man könne die gegenwärtige Welt und das gegenwärtige Leben schlicht als „Nacht“ beschreiben?36
Oder wie steht es mit dem unverhohlenen Platonismus des Chorals „Abide with me“, in manchen Kreisen immer noch ein Lieblingslied?
Der himmlische Morgen bricht an, und die eitlen Schatten der Erde fliehen.
Es gibt viele Kirchenlieder und Hymnen, die diesen Gedanken verkörpern. Ein kurzes Durchblättern des Gesangbuchs bringt Dutzende von Beispielen ans Licht, von denen nicht alle dadurch erklärt werden können, dass die vorherrschende Theologie diese Meinung zur Zeit der Buchtkomposition betonen wollte.
Oder wie steht es mit dem Weihnachtslied „I Came upon the Midnight Clear“, das in der letzten Strophe erklärt:
Denn sieh: Die Tage kommen schnell,
von prophetischen Stimmen angekündigt,
wenn mit den ewig kreisenden Jahren
das goldene Zeitalter anbricht.
Wenn Friede seine alte Pracht
über die ganze Erde wirft
und die ganze Welt das Lied zurückgibt,
das jetzt die Engel singen.
Das ist ein ganz beliebtes Weihnachtslied, aber die Vorstellung von geschichtlichen Zyklen, die schlussendlich in ein goldenes Zeitalter zurückkehren, ist weder christlich noch jüdisch, sondern entschieden heidnisch. Und da wir gerade bei Weihnachtsliedern sind: Sehen wir uns „Away in the Manger“ an, in dem folgendes Gebet auftaucht: „Mach uns bereit für den Himmel, um mit dir dort zu leben.“ Keine Auferstehung, keine neue Schöpfung, keine Hochzeit von Himmel und Erde.
Einige Choräle und Lieder der Erweckungsbewegung und der charismatischen Tradition machen den sich leicht einschleichenden Fehler, dass sie nahe legen, Jesus würde wiederkommen, um seine Leute von der Erde weg in den Himmel „nach Hause“ zu holen. Das passt, wie wir sehen werden, gut zu irreführenden Ansichten über die „Wiederkunft Christi“. So erklärt zum Beispiel der wunderbare Choral „How Great thou Art“:
Wenn Christus kommen wird, begleitet von Jubelrufen,
und mich nach Hause holen wird, welche Freude wird dann mein Herz erfüllen.
Die zweite Zeile (um unsere spätere These vorwegzunehmen) sollte besser lauten: „und diese Welt heilt, welche Freude wird dann mein Herz erfüllen.“ In der Tat spricht die ursprüngliche schwedische Version des Chorals nicht davon, dass Christus kommt, um mich nach Hause zu holen; das war die Anpassung des Übersetzers. Ursprünglich spricht der Choral davon, dass die Schleier der Zeit fallen, dass der Glaube in ein klares Schauen verwandelt wird und dass die Glocken der Ewigkeit uns zur Sabbatruhe rufen – vieles spricht dafür, diese Version zu empfehlen.37
Natürlich gehen einige Choräle gegen diesen Trend. „Jerusalem the Golden“ lenkt die Aufmerksamkeit auf die entscheidenden letzten Kapitel der Offenbarung. Ein paar Choräle sprechen davon, „beim letzten schrecklichen Aufruf aufgeweckt“ zu werden, oder davon, „am letzten Tag herrlich aufzuerstehen“. Ein großartiger Choral spricht davon, dass Gott seine Absichten durchsetzt, sodass „die Erde mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt sein wird wie das Meer voll Wasser ist“. Aber über all diesen Chorälen steht der große Choral zu Allerheiligen, „For All the Saints“, dessen Gedankenfolge die Betonung des Neuen Testaments genau trifft. In den ersten Strophen wird zunächst das Leben der Heiligen gefeiert, dann in der vierten Strophe unsere Gemeinschaft mit ihnen, in der fünften die Tatsache, dass sie uns stärken. Die sechste Strophe spricht davon, dass wir uns mit ihnen an ihrem derzeitigen Aufenthaltsort vereinen, der jedoch nicht die endgültige Ruhestätte ist, sondern vielmehr der zwischenzeitliche Ort der Ruhe, Freude und Erfrischung; Paradies ist einer der Namen für diesen Ort:
Der goldene Abend leuchtet im Westen;
bald, bald kommen die treuen Kämpfer zur Ruhe;
süß ist die Stille des gesegneten Paradieses.
Halleluja, Halleluja!
Erst danach kommt es zur Auferstehung:
Doch sieh! Es bricht ein noch herrlicherer Tag an;
die triumphierenden Heiligen stehen in strahlender Herrlichkeit auf;
der König der Herrlichkeit zieht an ihnen vorbei.
Halleluja, Halleluja!
Das mündet dann in die triumphale letzte Strophe, in der wir endlich im neuen Jerusalem ankommen.38
Nicht nur unsere Kirchenlieder offenbaren die Verwirrung, in die wir uns manövriert haben – dasselbe wird auch durch die Art und Weise sichtbar, auf die viele Christen das Kirchenjahr begehen. Ich habe an anderer Stelle schon über die schiere Konfusion geschrieben, die in den letzten Jahren ein zwei Tage dauerndes Fest aus Allerheiligen und Allerseelen zugelassen hat, dem noch Halloween vorausgeht, um das Chaos komplett zu machen.39
Mehr noch: Weihnachten hat heute Ostern in der populären Kultur als den wahren festlichen Kern des christlichen Jahres weit übertroffen – eine Tendenz, die der Betonung des Neuen Testaments völlig entgegenläuft. In Liedern, Gebeten und Predigten versuchen wir manchmal, eine komplette Theologie auf Weihnachten aufzubauen, aber Weihnachten kann diese Last nicht tragen. Wir halten dann die Passionszeit, die Karwoche und Karfreitag so streng ein, dass wir kaum noch Energie für Ostern übrig haben, nur noch für den ersten Abend und den ersten Tag. Ostern sollte jedoch im Zentrum stehen. Nimmt man Ostern weg, bleibt beinahe wörtlich nichts mehr übrig.
Dieselben Verwirrungen werden in der Art, wie wir unsere Beerdigungen abhalten sichtbar. In den letzten Jahren wurden viele Beerdigungsriten erdacht und veröffentlicht, oft nach langen Auseinandersetzungen. Aber bevor wir zu diesen kommen, sei ein Wort zur impliziten Theologie gestattet, der viele von denen anhängen, die sich für die Feuerbestattung im Gegensatz zur Beerdigung entscheiden. Hygiene und Überbevölkerung waren Gründe, die die Reformer gegen Ende des letzten Jahrhunderts dazu bewegten, diesen Schritt Richtung Kremation vorzuschlagen. Dies wird, was viele westliche Christen nicht wissen, sowohl von orthodoxen Ostkirchen (trotz eines Mangels an für Friedhöfe geeigneten Landmasse, zumindest in Griechenland) als auch von orthodoxen Juden sowie Moslems vehement abgelehnt. Tendenziell gehört die Feuerbestattung doch eher zu einer hinduistischen oder buddhistischen Theologie, und das ist, wie wir gesehen haben, auf einer populären Ebene die Richtung, in die sich unsere Kultur immer schneller bewegt. Wenn Menschen darum bitten, ihre Asche möge auf ihrem Lieblingshügel, in einem geliebten Fluss oder entlang einer Küste verstreut werden, können wir mitfühlen (wenn auch vielleicht nicht mit der Weigerung, den Trauernden einen bestimmten Ort zu geben, den sie in ihrer Trauer aufsuchen können). Aber unterschwellig beinhaltet dieser Wunsch das Verlangen, einfach wieder mit der übrigen geschaffenen Welt zu verschmelzen, ohne jede positive Aussage über ein zukünftiges Leben oder eine neue Verkörperung, und widerspricht damit deutlich der klassischen christlichen Theologie.
Ich sage damit natürlich nicht, dass die Feuerbestattung eine Irrlehre ist. Ich werde am passenden Ort später über die Beziehung zwischen Feuerbestattung und Auferstehung sprechen. Ich möchte nur anmerken, dass der große Umschwung in Richtung Kremation im letzten Jahrhundert zumindest teilweise einige der Verwirrungen widerspiegelt, die wir uns angesehen haben. Ich merke auch nebenbei an, dass eine Zeremonie in einem Gebäude, das für nichts anderes verwendet wird, ein völlig anderes Ereignis ist als eine Beerdigung in einem Gebäude, das täglich und wöchentlich zum Gebet, für das Abendmahl, für Feiern, Taufen, Hochzeiten, in einem Wort: für das gesamte gottesdienstliche Leben einer Gemeinschaft verwendet wird – egal, ob so eine Trauerfeier von einer Kremation gefolgt wird oder nicht. Oder, um die Sache aus der umgekehrten Perspektive anzuschauen: Es hat etwas Wunderbares und Tiefgründiges, wenn man zum Eingang einer Kirche über einen Friedhof gelangt, auf dem all diejenigen begraben sind, die in der betreffenden Kirche in den vergangenen Jahrhunderten angebetet haben. Aber auch alle diese Dinge sind eine andere Geschichte.
Was die Beerdigungen selbst angeht, kann man sagen, dass sich die andernorts ausgemachte Verwirrung dort getreu (wenn das hier das passende Wort ist) wiederfindet. In den verschiedenen Kirchen laufen so viele unterschiedliche Dinge ab, dass ich mich hier mit ausgewählten Kommentaren in Bezug auf meine eigene Kirche, der Church of England, begnüge. Stichproben an anderen Orten deuten darauf hin, dass meine Kirche jedoch nicht untypisch ist. Die Auferstehung ist nicht völlig verschwunden, aber sie wird immer wieder an den Rand gedrängt, und die unterschwellig im Gottesdienst erzählte Geschichte über den kürzlich Verstorbenen handelt nicht davon, dass er oder sie zwar friedlich ruht, aber in Erwartung der letztendlichen Erneuerung aller Dinge (das wäre im Einklang mit dem Neuen Testament), sondern sie handelt davon, dass er oder sie auf eine Reise geht, die im „Königreich Gottes“ endet. Man könnte es wie folgt ausdrücken: Würde jemand ohne Vorkenntnisse über die klassische jüdische und christliche Lehre zu einer solchen Beerdigung kommen, würde der Trauergottesdienst wenig Erhellendes beitragen, aber vieles, was irreführt, oder vieles, was die Verwirrung noch verstärken würde. Ich hoffe, dass diejenigen, die die These des vorliegenden Buches ernst nehmen, die gegenwärtige Praxis der Kirche untersuchen werden, von ihren offiziellen Liturgien bis zu all den inoffiziellen Einzelheiten, und dass sie versuchen, auf neuen Wegen das auszudrücken, zu verkörpern und zu lehren, was das Neue Testament tatsächlich lehrt, anstelle der verhackstückten, nur halb verstandenen und nur vage vertretenen Theorien und Meinungen, denen wir in diesen ersten beiden Kapiteln begegnen. Offen gestanden: Was wir heute haben, ist nicht „die sichere und gewisse Hoffnung der Auferstehung der Toten“, wie die alten Liturgien sagen, sondern der vage und unscharfe Optimismus, dass die Dinge letztlich irgendwie in Ordnung kommen.
Im Verlaufe der Argumentation dieses Buches wird klar werden, dass wir diese Situation nicht einfach als ein Problem ansehen können, angesichts dessen wir nur mit den Achseln zucken können, nach dem Motto: „Tja, es gibt eben unterschiedliche Ansichten zu diesen Fragen.“ Was wir über den Tod und die Auferstehung sagen, gibt allem anderen Form und Farbe. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir bloß eine „Hoffnung“ anbieten, die keine Überraschung mehr ist, die nicht mehr fähig ist, in der Gegenwart Leben und Gemeinschaften zu verändern, eine Hoffnung, die nicht mehr von der Auferstehung Jesu selbst erzeugt wird und die sich nicht mehr auf den verheißenen neuen Himmel und die neue Erde freut.
Kirchenlieder, das Kirchenjahr und Begräbnisrituale erzählen also alle eine ähnliche Geschichte. Die umfassendere Theologie und die Weltsicht, welche die gegenwärtige Verwirrung begleiten, sind vielleicht genauso wichtig.