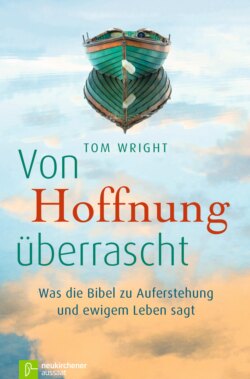Читать книгу Von Hoffnung überrascht - Tom Wright - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort der englischen Ausgabe Was erwarten wir? Und was tun wir dafür in der Zeit bis dahin?
ОглавлениеDiese beiden Fragen geben diesem Buch seine Gestalt. Zunächst handelt es von der ultimativen Zukunftshoffnung, die das christliche Evangelium in Aussicht stellt: also von der Hoffnung auf Errettung, Auferstehung, ewiges Leben und auf all die anderen Dinge, die dazu gehören. Des Weiteren handelt es von der Entdeckung der Hoffnung innerhalb der gegenwärtigen Welt: von den praktischen Wegen, auf denen Hoffnung lebendig werden kann, Hoffnung für Gemeinschaften und Einzelpersonen, die unter einem Mangel an Hoffnung leiden, aus welchem Grund auch immer. Und es handelt von den Wegen, auf denen die Annahme des ersten Aspektes den zweiten Aspekt hervorrufen und aufrechterhalten kann und soll.
Nach meiner Erfahrung wissen die meisten Menschen – inklusive vieler Christen – nicht, worin die ultimative christliche Hoffnung wirklich besteht. Die meisten Menschen – traurigerweise wiederum inklusive vieler Christen – erwarten zudem nicht, dass Christen viel über die Hoffnung innerhalb der gegenwärtigen Welt zu sagen haben. Sie kommen gar nicht auf den Gedanken, dass diese beiden Aspekte irgendetwas miteinander zu tun haben könnten. Daher der Titel dieses Buches: Hoffnung kommt überraschend, und das auf mehreren Ebenen gleichzeitig.
Auf der einen Seite geht es in diesem Buch offensichtlich um den Tod und darum, was aus einer christlichen Perspektive über das gesagt werden kann, was jenseits des Todes kommt. Ich werde keine medizinische oder physikalische Analyse des Todes und seines Nachspiels versuchen, auch keine psychologische oder anthropologische Beschreibung von Glaubensüberzeugungen und Praktiken, die mit dem Tod zu tun haben. Es gibt bereits zahlreiche Bücher zu derartigen Themen. Ich nähere mich dieser Frage vielmehr als Bibeltheologe. Ich bediene mich auch anderer Disziplinen, doch ich hoffe, das zu liefern, was diesen meistens fehlt und was die Kirche meiner Ansicht nach wiedergewinnen muss: die klassische christliche Antwort auf die Frage nach dem Tod und nach dem, was danach kommt. Diese Antwort trifft heute nicht so sehr auf Unglaube – das eigentliche Problem ist, dass diese Antwort schlicht unbekannt ist (in der Welt und in der Kirche gleichermaßen). Eine Umfrage zu den Glaubensüberzeugungen im Hinblick auf das Leben nach dem Tod, die 1995 in Großbritannien durchgeführt wurde, ergab folgendes Ergebnis: Obwohl die meisten Menschen an irgendeine Art von weitergehendem Leben glauben, glaubt nur eine verschwindend kleine Minderheit an die klassische christliche Position, also an eine zukünftige körperliche Auferstehung. Ich stelle in der Tat oft Folgendes fest: Obwohl Christen das Wort Auferstehung immer noch benutzen, verwenden sie es als Synonym für „Leben nach dem Tod“ oder „in den Himmel kommen“. Wenn man nachhakt, zeigt sich, dass unter Christen die gleiche Verwirrung herrscht wie in der Welt im Allgemeinen. Einige christliche Autoren, die über das Thema Tod schreiben, schaffen es sogar, die Auferstehung und alles, was damit zusammenhängt, zur Randerscheinung zu machen – offenbar ohne anzunehmen, dass damit ein erheblicher Schaden angerichtet wird.
Ich sollte erklärend anmerken, dass ich in gewisser Hinsicht nicht besonders qualifiziert bin, über das Thema Tod zu sprechen. Ich bin nun Ende fünfzig, und von allen Personen mittleren Alters, die ich kenne, bin ich derjenige, der am wenigsten getrauert hat. Mein Leben war erstaunlich frei von Tragödien; fast alle meine Verwandten haben ein hohes Alter erreicht. Das überrascht mich, ich bin dankbar dafür, aber ich halte das sicher nicht für selbstverständlich. Dazu kommt, dass ich zwar seit mehr als dreißig Jahren ordiniert bin, meine Berufung mich jedoch einerseits an Universitäten und andererseits an Kathedralen und in Diözesen geführt hat, sodass ich weniger Beerdigungen und Gedenkgottesdienste gehalten habe als viele Geistliche in den ersten zwei oder drei Jahren ihres Dienstes. Ich habe auch selten an einem Totenbett gestanden. Doch obgleich ich offensichtlich aus erster Hand noch eine Menge über diese Dinge zu lernen habe, denke ich, dass ich das dadurch ausgleichen kann, dass ich wie nur wenige die Chance habe, mich vertieft mit dem Leben und der Gedankenwelt der ersten Christen auseinanderzusetzen.1 Bei dieser vertieften Auseinandersetzung komme ich immer wieder zu dem Schluss, dass der Stimme der ersten Christen nicht nur nicht geglaubt wird, sondern dass diese Stimme überhaupt nicht gehört wird. Mit diesem Buch beabsichtige ich, ihre Glaubensüberzeugungen ans Licht zu bringen und, so hoffe ich, wieder lebendig zu machen, und das in der Überzeugung, dass die ersten Christen nicht nur die beste, sondern die am besten begründete Hoffnung (an)bieten, die wir haben. Mehr noch: Es handelt sich um eine Hoffnung, die sich wie gesagt mit derjenigen Hoffnung verbindet, die unsere Arbeit für Gottes Königreich in der gegenwärtigen Welt antreiben sollte.
Auf der anderen Seite handelt das Buch dann von der Grundlagenarbeit für eine praktische und sogar politische Theologie – also von christlicher Reflexion über das Wesen der Aufgabe, die uns gestellt ist, da wir versuchen, Gottes Königreich auf die wirkliche und Schmerz beladene Welt zu beziehen, in der wir leben. (Ich entschuldige mich bei allen Bibliothekaren, dass ich hier Verwirrung hervorrufen könnte: Soll man das Buch unter „Eschatologie“ katalogisieren – Tod, Gericht, Himmel und Hölle – oder unter „Politik“?) Auch an dieser Stelle ist eine Erklärung nötig. Ich bin kein Politiker, auch wenn es stimmt, dass ich aufgrund meines Amtes ein Mitglied des britischen House of Lords bin. Ich habe mich nie um ein öffentliches Amt beworben und auch nicht aktiv an Kampagnen für viele der Dinge teilgenommen, an die ich glaube – jedenfalls nicht im Sinne der harten Arbeit des Redenhaltens, des Schreibens, des Marschierens oder des Überredens. Ich habe versucht, mich auf andere Weise ordentlich ins Zeug zu legen. Aber die Gebiete, auf denen ich mich spezialisiert habe, und die pastoralen Aufgaben, die mich nun täglich in einer Diözese fordern, die in einigen Bereichen extrem unter den gesichtslosen Grausamkeiten der letzten fünfzig Jahre leidet, haben mich gezwungen, einiges zu durchdenken, was Christen zur Wiederentdeckung der christlichen Hoffnung in der öffentlichen und politischen Welt sagen und denken sollten.2 Dabei bin ich immer wieder auf diese beiden Hoffnungsthemen gestoßen, die sich gegenseitig verbinden. Ich biete meinen Kritikern offen diese beiden Erklärungen an: meine Unerfahrenheit sowohl in Bezug auf die Trauer als auch in der Politik, und ich hoffe, dass die Überraschung der christlichen Hoffnung nichtsdestotrotz auf beiden Gebieten diejenigen neu befeuern und erfrischen wird, die konkreter mit den Sterbenden und den Enteigneten arbeiten, als es mir möglich war.
Ein letztes allgemeines einleitendes Wort. Alle Sprache über die Zukunft ist, wie jeder Ökonom oder Politiker bestätigen wird, nicht mehr als eine Reihe von Schildern, die in den Nebel weisen. Wir schauen durch ein dunkles Glas, sagte Paulus, als er auf das schaute, was kommt. Unsere gesamte Sprache über zukünftige Zustände der Welt und von uns selbst besteht aus komplexen Bildern, die mehr oder auch weniger gut mit der letztendlichen Wirklichkeit übereinstimmen. Das heißt aber nicht, dass die Sache völlig unklar ist oder dass jede Meinung zu diesen Dingen gleichwertig ist. Und was wäre, wenn uns jemand aus dem Nebel entgegenkäme, um uns zu begegnen? Das ist natürlich die zentrale, wenn auch oft ignorierte christliche Glaubensüberzeugung.
Dieses Buch entstand aus Vorlesungen, die ich zwischen 2001 und 2007 an verschiedenen Orten gehalten habe. Ich bin sehr dankbar für alle, die mich bei den verschiedenen Gelegenheiten eingeladen, willkommen geheißen und versorgt haben, besonders denjenigen, die mir durch ihre Fragen und scharfsinnigen Kommentare geholfen haben, weiter über die Themen nachzudenken und dadurch zumindest einige Fehler zu vermeiden. Ich danke der Internetseite Ship of Fools, die den Artikel in Auftrag gab, der hier am Ende abgedruckt wird, und für die Erlaubnis, eine leicht veränderte Version zu veröffentlichen. Ich danke Dr. Nick Perrin, der während seiner Zeit in Westminster Abbey den Text in der Form, in der er damals war, durcharbeitete und alle möglichen hilfreichen Anmerkungen machte. Und ich danke wie immer Simon Kingston, Joanna Moriarty und den dynamischen und wachsamen Mitarbeitern bei SPCK und den entsprechenden Mitarbeitern bei HarperOne, nicht zuletzt Mickey Maudlin.
N. T. (Tom) Wright
Auckland Castle
Himmelfahrt 2007
1 Siehe insbesondere meine Bücher The New Testament and the People of God (1992); Jesus and the Victory of God (1996); The Resurrection of the Son of God (2003) und Paul: Fresh Perspectives (2005). Auf Deutsch ist neben dem allgemeinverständlichen Buch Warum Christ sein Sinn macht (2009) mein stärker fachspezifisches Buch Worum es Paulus wirklich ging (2010) erschienen. Die ersten drei hier genannten Bücher sind Teil der Reihe Christian Origins and the Question of God.
2 Anmerkung des Verlages: N. T. (Tom) Wright war Bischof in der Diözese Durham, deren wirtschaftliche Grundlage – Kohle und Stahl – durch die weltweite Konkurrenz weg gebrochen ist und die Tausende ohne Arbeit zurückließ, ähnlich wie seinerzeit z.B. im Ruhrgebiet.