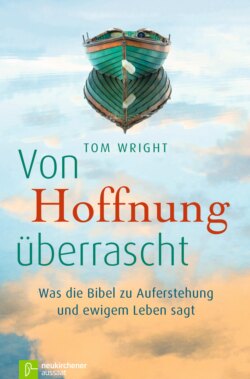Читать книгу Von Hoffnung überrascht - Tom Wright - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 3:
Die frühchristliche Hoffnung in ihrem historischen Kontext 1. Einleitung
ОглавлениеIn einem großen Zimmer im King’s College, Cambridge, trafen am Freitag, dem 25. Oktober 1946, um 20.30 Uhr zwei der größten Philosophen des 20. Jahrhunderts zum ersten und letzten Mal persönlich aufeinander. Es war keine erquickliche Angelegenheit. Als die ebenfalls Anwesenden hinterher ihre Notizen verglichen, konnten sie sich nicht darauf einigen, was genau vorgefallen war.
Die beiden Philosophen waren Ludwig Wittgenstein und Karl Popper. Wittgensteins Brillanz hatte ihm bereits hohes Ansehen beschert; viele waren von seinen revolutionären Ideen verzaubert. Er war Vorsitzender des Cambridge Moral Science Club (in Cambridge bedeutet „moral science“ Philosophie). Viele andere Philosophen, inklusive Karl Popper, beobachteten ihn jedoch mit tiefem Misstrauen. Popper machte sich gerade durch die Veröffentlichung der englischen Übersetzung seines Meisterwerkes Die offene Gesellschaft und Ihre Feinde42 einen Namen. Beide Männer waren als assimilierte Juden im Wien der Vorkriegszeit aufgewachsen: Wittgenstein war aus einer reichen Familie, wo ihm die Welt zu Füßen lag, Popper hingegen kam aus einem wesentlich gewöhnlicheren Umfeld. Popper hatte sich nach einer Gelegenheit gesehnt, bei der er die Torheit der Ansätze Wittgensteins aufzeigen konnte, und diese Gelegenheit war nun gekommen. Er war nach Cambridge gekommen, um einen Vortrag zu halten, in dem er den großen Mann direkt angreifen würde. Es war ein kühler Abend; das Kaminfeuer wurde angezündet, und Wittgenstein saß daneben. Viele der Anwesenden hatten bereits einen Namen in der Philosophie oder würden sich später einen Namen machen: Bertrand Russell, Peter Geach, Stephen Toulmin, Richard Braithwaite. Andere gingen in andere Berufsrichtungen, z. B. in Richtung der Juristerei. Viele leben noch und erinnern sich sehr gut an den Abend. Zumindest behaupten sie das.
Popper wusste nicht, dass Wittgenstein nicht die Angewohnheit hatte, Vorträgen bis zum Ende zuzuhören oder dass ihm der Ruf vorauseilte, arrogant und unhöflich zu sein, oder dass er Treffen oft vorzeitig verließ. An jenem Abend dauerte es nicht lange – und an diesem Punkt beginnen die Berichte, auseinanderzugehen –, bis Wittgenstein Popper unterbrach und die beiden Männer einen kurzen, erbitterten Wortwechsel starteten. Zu einem bestimmten Zeitpunkt nahm Wittgenstein das Schüreisen aus dem Kamin und fuchtelte damit herum. Kurz danach verließ er den Raum und kehrte nicht zurück.
Innerhalb kurzer Zeit verbreiteten sich die Gerüchte im wörtlichen Sinne um die ganze Welt. Popper erhielt einen Brief aus Neuseeland, in dem er gefragt wurde, ob es stimme, dass Wittgenstein ihn mit einem glühenden Schüreisen bedroht hätte. Bis heute können sich die großen Geister, die dabei waren, nicht einigen, was genau an jenem Tag passiert war. Einige sagen, dass das Schüreisen glühte, andere, dass es kalt war. Einige sagen, Wittgenstein fuchtelte damit herum, um seinem Punkt Nachdruck zu verleihen (was nicht ungewöhnlich gewesen wäre); andere, auch Popper, sagen, er scheint seinen Gegner damit bedroht zu haben. Einige meinen, Wittgenstein habe den Raum nach einem zornigen Wortwechsel mit Russell verlassen, und Popper hätte, nachdem Wittgenstein nicht zurückgekehrt war, als Beispiel für ein offensichtliches moralisches Prinzip den Satz formuliert: „Bedrohe einen Gastredner niemals mit einem Schüreisen.“ Andere, inklusive Popper, sagen, Wittgenstein wäre gegangen, als Popper ihm diesen Satz ins Gesicht gesagt hatte. Einige sagen, er schlug die Tür lautstark zu, andere, dass er sich leise entfernte. Es ist eine faszinierende Geschichte, und sie ist kürzlich in einem originellen Buch aufgeschrieben worden.43 Das Hauptresultat dieses Buches lautet, dass Wittgenstein wahrscheinlich den Raum verließ, bevor Popper den Satz sagte. Poppers Erinnerung hat ihm wahrscheinlich einen Streich gespielt; für ihn stand persönlich und beruflich so viel auf dem Spiel, dass er ein hohes Interesse hatte, dieses Ereignis als eine Geschichte seines Sieges über Wittgenstein zu erzählen – was er dann auch sehr schnell tat. Und über kurz oder lang glaubte er seiner eigenen Darstellung.
Im Hinblick auf die genauen Einzelheiten herrschen also völlig unterschiedliche Meinungen. Aber niemand bezweifelt, dass das Ereignis stattgefunden hat. Niemand bezweifelt, dass Wittgenstein und Popper die Hauptgegner waren und dass Russell eine Art Oberschiedsrichterrolle spielte. Niemand bezweifelt, dass Wittgenstein mit einem Schüreisen herumgefuchtelt hat und ziemlich plötzlich verschwand.
Ich beginne dieses Kapitel aus einem recht offensichtlichen Grund mit dieser Story. Unter Juristen ist es eine Binsenweisheit, dass Augenzeugen sich widersprechen. Das bedeutet jedoch nicht, dass gar nichts geschehen ist. Es ist umso bemerkenswerter, dass Widersprüche auftauchen, wenn alle Zeugen äußerst gebildet sind und beruflich mit Erkenntnis und Wahrheit zu tun haben. Aber so ist das nun mal. Und eine zentrale Tatsachenbehauptung des christlichen Evangeliums, ohne die es gar kein Evangelium geben würde, lautet, dass ungefähr 50 Jahre vor unseren detailliertesten Berichten über das Ereignis tatsächlich etwas geschehen ist – und diese Berichte stimmen im Einzelnen nicht exakt überein. Einige haben gesagt, dass diese Tatsache Zweifel daran aufkommen lässt, ob am ersten Ostertag überhaupt etwas geschehen ist. In den ersten vier Evangelien (mit der Apostelgeschichte und den Paulusbriefen) haben wir ein Äquivalent aus dem ersten Jahrhundert zu den variierenden Berichten über Wittgensteins Schüreisen, womit meine Frage nun endlich klar wird: Was für eine Art von Ereignis war das? Wie leer war das Grab am Ostermorgen?
Mit diesen Fragen tauchen wir natürlich direkt in das Zentrum einer Debatte ein, die dem Hauptstrom der westlichen Kirche seit mehr als einem Jahrhundert Kopfschmerzen bereitet hat. William Temple, der spätere Erzbischof von Canterbury, wurde nicht ordiniert, bevor er sich nicht entschieden hatte, dass er wirklich an die leibliche Auferstehung Jesu glaubt. Spätere Geistliche, inklusive vieler Bischöfe, haben nicht denselben Weg gewählt, und David Jenkins löse eine stürmische Kontroverse aus mit seinen Bemerkungen über das leere Grab, Jesu Knochen und Zaubertricks – obwohl seine Worte genauso wie der Wortwechsel zwischen Popper und Wittgenstein eine interessante spätere Karriere in der mündlichen und schriftlichen Tradition gemacht haben. Was sollen wir im Hinblick auf Jesu Auferstehung glauben, und warum sollten wir das glauben?
Diese Frage ist mit mehreren anderen ähnlichen, aber doch zu unterscheidenden Fragen vermischt worden, und es ist heute oft schwierig, den Menschen einen ausreichend klaren Kopf zu verschaffen, damit sie sich auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren können. Es geht nicht um die Frage, ob die Bibel die Wahrheit sagt oder nicht. Es geht auch nicht um die Frage, ob Wunder geschehen oder nicht. Ebenso geht es auch nicht um die Frage, ob wir an etwas glauben, das „das Übernatürliche“ genannt wird, oder nicht. Und es geht auch nicht um die Frage, ob Jesus heute lebendig ist und ob wir ihn selbst kennenlernen können. Wenn wir die Osterfrage schlicht als einen Präzedenzfall in einer dieser Diskussionen behandeln, vergessen wir den entscheidenden Punkt.
Auch können wir nicht behaupten, obwohl viel das gerne tun, dass wir im Gegensatz zu den Menschen des ersten Jahrhunderts die Naturgesetze kennen und wir deshalb heute wissen, dass Jesus nicht von den Toten auferstehen konnte. Wie ich in großer Ausführlichkeit andernorts gezeigt habe, bestand die antike Welt – mit Ausnahme der Juden – darauf, dass Tote nicht auferstehen; und die Juden glaubten nicht, dass irgendjemand bereits auferstanden war oder dass das irgendjemand aus eigener Kraft vor der Auferstehung der Toten tun würde.44 Doch selbst wenn wir diese Missverständnisse ausgeräumt haben, bleiben tiefe Fragen zurück. Was genau glaubten die ersten Christen? Warum benutzten sie die Sprache der Auferstehung, um diesen Glauben auszudrücken? Ist es möglich, eine historische Argumentation für oder gegen das leere Grab und die leibliche Auferstehung aufzubauen, oder wird es sich dabei immer um eine Sache handeln, mit der man es halten kann, wie man will? Wie weit kann uns die Geschichtsforschung helfen, welche Rolle spielt der Glaube, und wie spielen diese beiden Dinge zusammen? Die Frage ist nicht nur, was wir wissen können, sondern auch, wie wir etwas wissen können, und an diesem Punkt wird unser gesamtes Wissen in Frage gestellt.
Edmonds und Eidinow treiben ihre Untersuchung der Begegnung zwischen Popper und Wittgenstein mithilfe von zwei prinzipiellen Methoden voran. Erstens: Sie befragen die Augenzeugen, um sicherzustellen, dass die Zeugnisse aus erster Hand auf dem Tisch liegen. Zweitens: Sie rekonstruieren den Hintergrund des Treffens akribisch im Hinblick auf die komplexen Biographien und Absichten der beiden Hauptdarsteller. Sie ziehen dann ihre Schlüsse im Sinne einer verknüpften historischen Erzählung und behaupten nicht, dass ihre Version absolut wahr ist, aber dass sie die wahrscheinlichste Art und Weise ist, um die verschiedenen Behauptungen miteinander zu versöhnen.
Wir müssen im Blick auf das leere Grab und auf das Osterereignis etwas Ähnliches tun. Die Augenzeugen – wenn sie tatsächlich welche waren – sind wohl bekannt. Wir haben sie im Neuen Testament vor uns. Wir können den Hintergrund im Hinblick auf die jüdischen Glaubensüberzeugungen und Erwartungen, auf Jesu eigenes öffentliches Wirken und auf die Glaubensüberzeugungen und Hoffnungen seiner Jünger ziemlich vollständig rekonstruieren. Aber es gibt ein drittes Element, das keine Parallele zur Debatte in Cambridge 1946 hat. Die philosophischen Fragen, die dort diskutiert wurden, und die erhitzten Auseinandersetzungen, die sie erzeugten, gehörten in jene Zeit und sind „gestorben“. Popper ist zunehmend ein alter Hut; Wittgensteins brillanteres Erbe ist zutiefst mehrdeutig. Wer sich die nachfolgende Philosophie anschaut, kann nicht sagen, wer an jenem Abend die Debatte gewann – wenn sie überhaupt jemand gewann. Selbst wenn die Leistung des einen oder des anderen heute als überlegen eingestuft werden würde, dann könnte diese Einschätzung gut und gerne nichts mit den zehn Minuten erhitzter Cambridge-Rhetorik von damals zu tun haben. Aber mit Ostern verhält es sich anders. Was immer damals geschah: Es erzeugte etwas ziemlich Neues: Etwas, das wuchs und sich auf bestimmte Weise entwickelte, das aber immer behauptete, auf diesen Ursprung zurückzugehen. Ein wichtiger Teil unserer Befragung muss also in einem scharfen Blick auf die entstehende christliche Bewegung bestehen: Was war die Ursache für diese Bewegung? Auch wenn sich unsere Augenzeugen in den Einzelheiten uneins sind: Es muss etwas geschehen sein.
Da ich andernorts ausführlich über diese Dinge geschrieben habe, können wir nun direkt zum Kern der Sache kommen. In diesem Kapitel werde ich die frühchristlichen Glaubensüberzeugungen über das Leben nach dem Tod auf der Landkarte der antiken Ansichten verorten, und zwar sowohl der heidnischen als auch der jüdischen Ansichten. Die bemerkenswerten Resultate dieser Verortung werden uns im nächsten Kapitel an die Ostererzählungen selbst zurückverweisen. Dort werden wir ihren Charakter und ihre Herkunft neu untersuchen und über die Optionen nachdenken, die dem Historiker offenstehen.