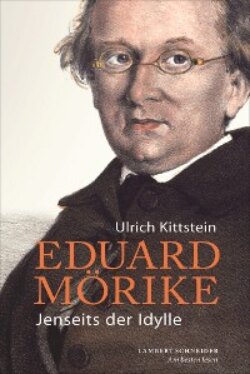Читать книгу Eduard Mörike - Ulrich Kittstein - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Jugendfreunde
ОглавлениеDie Atmosphäre in Urach und am Tübinger Stift dürfte sich nicht allzu sehr von der unterschieden haben, die noch heute in streng geführten internatsähnlichen Einrichtungen herrscht, und dasselbe galt vermutlich für die Art und Weise, wie die Heranwachsenden mit ihrer Situation umgingen. Gefühlsüberschwang, Phantasie und Begeisterungsfähigkeit der jungen Leute, die vom zumeist recht trockenen Stoff ihrer Studien schwerlich voll befriedigt werden konnten, suchten sich andere Wege und Ziele. Politische Schwärmerei zählte dazu: Trotz der staatlichen Repressionen in der Ära der Restauration war in Tübingen die Burschenschaft aktiv, die von einem freien und geeinten deutschen Nationalstaat träumte, und der verbreitete Enthusiasmus für den Aufstand der Griechen gegen die türkische Herrschaft erfasste in den zwanziger Jahren auch die Studenten – einige Stiftler machten sich sogar auf den Weg nach Griechenland, um am Kampf teilzunehmen. Dichtung, in die man sich vertiefen und mit der man sich identifizieren konnte, stellte ein lockendes Refugium der Einbildungskraft dar und bot die Möglichkeit, wenigstens im Gedankenflug die engen Grenzen des nüchternen Alltags zu überwinden. Vor allem aber ist hier von den Freundschaftsbündnissen zu sprechen, die in Mörikes Schul- und Studienzeit eine beherrschende Rolle spielten.27
Das lange Zusammensein in weitgehender Abgeschlossenheit und die gleiche Prägung durch Erziehung und Bildung begünstigten innige Gefühlsbindungen zwischen den Kommilitonen, die als willkommenes Gegengewicht zur strengen Zucht von Seminar und Stift empfunden wurden. Vielfach mögen dabei auch homoerotische Regungen im Spiel gewesen sein. Mörike und seine Freunde schufen sich ihre eigenen Rückzugsorte, beispielsweise in Gestalt eines von Waiblinger angemieteten Gartenhauses in der Nähe von Tübingen oder der Gartenlaube Rudolf Lohbauers. Vermittelnd wirkte immer wieder die Literatur: Man las gemeinsam, begeisterte sich für einzelne Lieblingsautoren und tauschte eigene poetische Versuche aus. In den Briefen und Dichtungen der jungen Leute herrschte ein schwärmerisch-empfindsamer Ton vor, der auf den heutigen Leser mitunter gewaltig übersteigert wirkt, aber ganz zeittypisch war. Daneben zeigte sich jedoch auch eine Neigung zu Spott, Satire und grotesker Komik, zu vulgärer jugendlicher Kraftmeierei und heimlichen nächtlichen Exzessen, die auf ihre Art ebenfalls eine Entlastung vom allgegenwärtigen Druck des Internatslebens versprachen. Wie es da mitunter zuging, illustriert eine Aufzeichnung, die sich unter dem Datum des 22. Dezember 1822 in Waiblingers Tagebüchern findet:
So ein Tag, wie der heutige, ist schon ein paar Worte wert: ein wahres Fastnachtsleben, ganz im Genuß des Augenblicks. Nach der Kirche ins „Ballhaus“: hier Bier gesoffen und über Griechenland und den Orient bis zur Hitze gestritten – im „Museum“ 2 Heringe gefressen, Bier gesoffen und geraucht – von 6–7 literarisches Gespräch – nach dem Fraß gegen 6 Schoppen Wasser gesoffen – ich und Mörike hinterm Pult: ich mit einem abgeschabten Magisterhut, wie ein Zigeuner, die Pfeife in der Physiognomie – Mörike mit hinunterhängenden Hosen, den Bauch aus dem Hemd streckend – Eisbär und Buttersack beständig mit Teemachen beschäftigt – Eine Bouteille Tee um die andere – Ein Furz um den andern – Fratzengesichter bis ins Abscheuliche – Lumpenlieder – Travestien:
In einem Tal, bei schwarzen, schwarzen Haaren,
Erschien mit jedem neuen Jahr,
Sobald die ersten Lerichen, Lerichen schwirriten,
Ein Schwänzichen, schön und wunderbar.
Das unaufhörlich gesungen – kein vernünftig Wort bis um Mitternacht gesprochen – bloß gelacht, gesoffen und geraucht – wie Säue, auf einander liegend – Den Unsinn aufs Höchste getrieben – Alles persifliert und ins Komische hinübergezogen – Endlich lachend mit vollem Teebauch ins Bett gegangen.28
Waiblingers umfangreiche Tagebücher bilden eine ergiebige Quelle für den Alltag im Stift wie auch für die vielfältigen Eskapaden der Studenten. Die Notizen müssen zwar mit Vorsicht ausgewertet werden, weil sie manche Stilisierungen und sogar einige gänzlich fiktionale Passagen enthalten, doch Schilderungen wie die eben zitierte dürften durchaus authentisch sein. Dass Mörike am burschikosen studentischen Treiben gerne teilnahm, bestätigen auch andere Zeugnisse, darunter das beachtliche, in den Stiftsakten dokumentierte Register seiner Strafen, die er sich beispielsweise durch Unpünktlichkeit, unvorschriftsmäßige Kleidung oder Rauchen in der Öffentlichkeit zuzog.
Wilhelm Waiblinger besuchte zunächst das Gymnasium in Stuttgart und erschien nur gelegentlich als Hospitant im Niederen theologischen Seminar in Urach. Dennoch ergab sich seit dem Herbst 1821 ein enger, teils durch Briefverkehr aufrecht erhaltener Kontakt mit Mörike, der sich noch vertiefte, als beide im folgenden Jahr das Stift bezogen. Obwohl Waiblinger in Mörikes Alter war, besaß er in dessen Augen eine gewisse Autorität und fungierte, wie wir bereits gehört haben, zeitweilig als sein literarischer Mentor. Der selbstbewusste und frühreife junge Mann hatte Verbindungen zur Literaturszene in der Residenzstadt, wo er mit Schwab, Matthisson, Haug und Uhland verkehrte, war selbst literarisch ungemein produktiv und konnte sogar bereits Veröffentlichungen vorweisen – neben einigen Gedichten erschien 1823 sein Roman Phaëton. Da er überdies schon in Liebesdingen erfahren und ausgesprochen skandalerprobt war, muss ihn eine faszinierende Aura der Verruchtheit umgeben haben. Übrigens ließ er es sich viel Zeit und Mühe kosten, dieses Image zu pflegen: Die Tagebücher, die unter ausgewählten Freunden zirkulierten, dienten seiner Selbstinszenierung als Genie, das den gewöhnlichen Regeln des bürgerlichen Lebens nicht unterworfen ist. Da war es durchaus passend, dass er sich dem wahnsinnigen Hölderlin wesensverwandt fühlte, dessen Hyperion auch das Muster für Phaëton abgab. Mörike und Ludwig Bauer bildeten mit Waiblinger für eine Weile eine engere Freundesgruppe, die unter anderem durch die gemeinsame Leitfigur Hölderlin zusammengehalten wurde.
Während die anderen Studenten in der Regel keine Zusammenstöße mit den Autoritäten des Stifts und der Gesellschaft riskierten, die Schlimmeres als den Karzer nach sich gezogen hätten, konnte sich Waiblinger auf die Dauer nicht mit der disziplinarischen Ordnung seiner Bildungsstätte vertragen. Die Konflikte häuften sich, und eine Liebesaffäre mit der Professorentochter Julie Michaelis erregte schließlich massives öffentliches Ärgernis, zumal ein beleidigter Nebenbuhler zweimal bei ihrer Familie Feuer legte. Waiblingers Stellung in Tübingen wurde allmählich unhaltbar. Im Dezember 1824 kündigte ihm Bauer unter dem Einfluss seiner besorgten Angehörigen die Freundschaft auf, und bald darauf ging auch Mörike auf Distanz, der weder willens noch imstande war, sich gegen die bürgerlichen Normen und Erwartungen aufzulehnen und damit seine Zukunft aufs Spiel zu setzen – ganz zu schweigen von den beschwörenden Mahnungen seiner Schwester Luise. Typisch für ihn war allerdings, dass er den offenen Bruch geflissentlich vermied und den ohnehin überaus diplomatisch formulierten Absagebrief an den Freund, der das Datum des 8. April 1825 trägt, allem Anschein nach nie abschickte.29
Kurz vor dem Examen wurde Waiblinger im Herbst 1826 endgültig vom Stift verwiesen. In Württemberg war seines Bleibens nun nicht länger, und so zog er umgehend nach Italien, wo er weiterhin eine reiche literarische Produktion entfaltete, schon um sich finanziell über Wasser zu halten. Nach einigen Monaten erhielt Mörike aus Rom einen letzten Brief, der ausführlich Waiblingers dortiges Leben und seine Eindrücke schilderte.30 Dass er dieses Schreiben unbeantwortet ließ, hat er nach dem frühen Tod des ehemaligen Freundes – am 17. Januar 1830 – zutiefst bereut.31 Immerhin erwies er dem in der Heimat Verfemten einen postumen Dienst, indem er 1844 eine gründlich bearbeitete Auswahlausgabe seiner Gedichte herausgab. Waiblingers Schicksal muss ihm demonstriert haben, wohin der Bruch mit den gesellschaftlichen Konventionen und eine genialische Ungebundenheit führen konnten. Die vorsichtige Diätetik, die er später entwickelte und die sein beschränktes, zurückgezogenes Dasein leitete, ist wohl nicht zuletzt als Gegenentwurf zu der rauschhaften, zügellosen Existenz und dem „schauderhaften Sturz“ (11, S. 80) dieses einstigen Weggefährten zu begreifen.
Die anderen Freunde Mörikes aus Schüler- und Studententagen waren weniger abenteuerliche Gestalten. Herausgehoben seien hier neben dem schon mehrfach erwähnten Ludwig Bauer zwei von ihnen, die er bereits in Urach kennenlernte und von denen künftig noch des Öfteren die Rede sein wird, nämlich Wilhelm Hartlaub, der seit den späten dreißiger Jahren der engste Vertraute des Dichters werden sollte, und Johannes Mährlen. Mit Friedrich Theodor Vischer und David Friedrich Strauß, die aus Ludwigsburg gebürtig, aber einige Jahre jünger waren und 1825 vom Seminar in Blaubeuren ans Stift kamen, hatte Mörike in Tübingen zwar bereits Kontakt, doch datieren die engeren freundschaftlichen Beziehungen zu ihnen erst aus späterer Zeit.
Von allen diesen Freunden sind Äußerungen über den jungen Mörike überliefert, aus denen sich ein erstes und vorläufiges, aber bereits recht aufschlussreiches Bild seiner Persönlichkeit gewinnen lässt. Schon die verstreuten Notizen in Waiblingers Tagebüchern verraten, dass Mörike damals auf seine Weise nicht minder faszinierend wirkte als sein unruhiger, genialischer Kommilitone. Ausführlich charakterisiert Waiblinger ihn am 2. April 1822:
Mörike ist ein tiefes, schönes Gemüt, ringend, und doch nicht krampfhaft, nicht wund, sondern stark, kräftig und gesund. Überall, selbst da, wo sein Gefühl in den reinsten, schönsten Strahlen, wo seine Wehmut in den heißesten Tränen hervortritt, wo beide den heiligsten Regenbogen trunkener Liebe, schwellender Sehnsucht bewirken, ist keine Mattheit, keine Verzärtelung, keine Entkräftigung sichtbar. Es verlangt ihn endlos nach einem Gegenstand, den er lieben kann, und wenn er ihn gefunden hat, so hängt er an ihm mit einer wunderbaren Liebe. Sein heitrer Humor, sein Witz, der mich unendlich an ihn fesselt, gleicht schimmernden Regentropfen in wechselndem Farbenspiele, die das glühende Licht der Sonne durchschauert. Diese Sonne ist sein Herz. Er ist ganz Natur, nie legt er Fremdes in sich hinein, seine Eigentümlichkeit ist ihm genug. Er ist die Beute des Augenblicks, und so mag mancher Vorsatz, mancher Entschluß wieder ins Nichts zurückkehren, vor der Macht eines drängenderen Impulses, wie leichte, flücht’ge Wölkchen vor dem Hauch lebendiger Winde. Er ist unendlich liebenswürdig in diesem Hinleben, und wird zum angenehmsten Gesellschafter, wie er denn auch, arglos und beruhigt, sich der tüchtigsten Lustigkeit hingeben kann. So ist er auch gleichgültig gegen alles lose Spielwerk der Eitelkeit.32
Gewisse Eigenarten, die hier angedeutet werden, konnte man freilich auch ungünstiger beurteilen, und in der Tat hielt Waiblinger bereits zwei Wochen später fest: „Mörike ist über keine Stunde seines Lebens Meister. Er verspricht tausenderlei, aber wer weiß, was dazwischen kommt, kurz, es bleibt immer beim Versprechen oder beim Vorsatz. Es ist denn doch Mangel an Selbstständigkeit.“33 Gegen Jahresende heißt es dann zusammenfassend: „ich liebe sein Gemüt und seinen Humor, aber hasse seinen Leichtsinn, seine Veränderlichkeit.“34 Aus den Jahren 1823/24 sollen wenigstens noch zwei Passagen zitiert werden: „Manchmal fühl’ ich bei Mörike etwas, das mir noch kein Freund gab, – etwas unaussprechlich Heimisch-Kindlich-Gemütliches“, und: „er ist mir nicht wie ein Freund, ist mir wie ein Traumgesicht, wie der Glaube an eine schöne Fabelwelt“.35
Von der heiteren und gewinnenden Persönlichkeit des jungen Mörike zeugen auch andere Dokumente, darunter Hartlaubs rückblickende Schilderung seiner ersten Begegnung mit dem Vierzehnjährigen im Uracher Seminar, wo Mörike kurz nach der Ankunft an Scharlach erkrankt war: „Als er besucht werden durfte, strömten die Mitschüler in den Freistunden zu ihm. Wundershalber ging ich auch einmal mit. Aber wie ward mir! Mit hundert Scherzen erfreute und unterhielt er den Haufen um sich her; jedoch nichts Gewöhnliches kam aus seinem Munde; den heitersten Sonnenschein verbreitete sein Wesen, in dem es jedem sogleich wohl wurde.“36 Bemerkenswert früh haben die Freunde Mörike die Rolle des Dichters schlechthin zugeschrieben – eine auffallende Auszeichnung in einem Umfeld, in dem sich kaum jemand fand, der nicht irgendwann einmal Verse gemacht hätte. David Friedrich Strauß porträtierte ihn später im Kontrast zu Waiblinger:
War Waiblinger imposant, so erschien Mörike räthselhaft. Er blendete schon deßwegen nicht, weil er sich entzog. Von dem geheimnißvollen Brunnenstübchen, von dem am Tage künstlich verdunkelten und kerzen erleuchteten Gartenhause, wo er mit seinen Erwählten im Shakespeare lese, oder von Orplid, der Stadt der Götter, sich unterrede, gingen nur dunkle, wunderliche Sagen im Volke. Nur wurde es Einem einmal so gut – das hielt aber schwer, – in seine Nähe zu kommen, und, war er ernst, von seinem aus innerstem Seelengrunde heraufquellenden Worte getroffen, oder in heiterer Stunde von seinem unvergleichlichen Talente humoristischer Mimik fortgerissen zu werden. Man wußte nicht, wie einem geschah; an die Geniefrage dachte man gar nicht, so wenig als Mörike selbst daran dachte; das aber wußte man, fast noch ohne seine Gedichte zu kennen, daß hier ein Dichter sei. Ja, Mörike ist für uns alle, die sein Wesen unmittelbar oder mittelbar berührt hat, das Modell dessen geworden, was wir uns unter einem Dichter denken.37
Zwar wurden diese Erinnerungen erst gut zwanzig Jahre nach der Tübinger Zeit niedergeschrieben, aber es mangelt nicht an Belegen dafür, dass sie die damalige Sicht der Freunde zutreffend wiedergeben. Eine Zeichnung Rudolf Lohbauers, die vermutlich aus dem Jahre 1826 stammt, zeigt in sorgfältiger Komposition eine gesellige studentische Runde in einer Laube.38 Die beherrschende Gestalt ist Lohbauer selbst, den wir im Vordergrund mit erhobenem Trinkpokal auf einer Bank breit hingelagert sehen. Dagegen sitzt Mörike als der Unauffälligste von allen halb verdeckt im Hintergrund – aber als einziger trägt er auf dem Kopf einen Kranz, das Symbol des Dichtertums! In Briefen, die Bauer ihm 1824 schrieb, finden sich Bemerkungen wie: „Die Poesie des Lebens hat sich mir in dir verkörpert, und alles, was noch gut an mir ist, sehe ich als ein Geschenk von dir an“, oder: „Deine bloße Erscheinung ist ja ein Gedicht“.39 Wie schon bei Strauß angedeutet, wirkte Mörike offenbar nicht nur und nicht einmal in erster Linie deshalb als reine Dichternatur, weil er Verse schrieb, sondern weil dank seines Humors, seiner menschlichen Wärme und seiner lebendigen Phantasie in seinem ganzen Wesen etwas Poetisches zu liegen schien.
Wie rücksichtsvoll man in seinem Kreis mit ihm umging, fiel Luise Mörike im kritischen Sommer 1824 auf: „Seine Freunde behandlen ihn mit einer Schonung einer Zärtlichkeit und Nachsicht, schon in den gesunden Tagen, die sich kaum von unsrem Geschlechte erwarten ließen.“40 Das blieb auch in späteren Jahren so – die noble Hilfsbereitschaft der Freunde, von der er immer wieder profitieren sollte, und die Nachsicht, die sie für seine vielen Eigenheiten aufbrachten, flossen aus der grenzenlosen Bewunderung, die man dem Poeten Mörike zollte. Als Theodor Storm 1855 in Stuttgart weilte, gewann er einen Eindruck davon, „welch hohe Stellung der Dichter bei seinen Jugendgenossen einnahm, und wie sie überall nur das Schönste und Beste von ihm erwarteten“, denn während Mörike aus der soeben vollendeten Novelle Mozart auf der Reise nach Prag vorlas, fiel dem norddeutschen Besucher die „verehrende Begeisterung“ auf, mit der der ebenfalls anwesende Hartlaub lauschte: „Als eine Pause eintrat, rief er mir zu: ‚Aber, i bitt Sie, ist das nun zum aushalte!‘“41