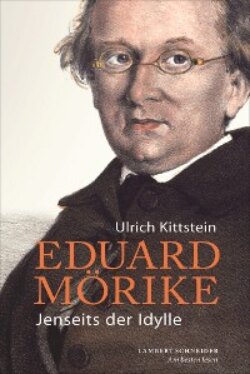Читать книгу Eduard Mörike - Ulrich Kittstein - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. DER KAMPF UM DIE „OECONOMIA INTERIOR“: KONTUREN EINES SCHWIERIGEN CHARAKTERS Eine Krankengeschichte
ОглавлениеNachdem die ersten Kapitel bereits einige Aspekte von Mörikes Charakterbild berührt haben, soll im Folgenden der Versuch unternommen werden, dieses Bild noch genauer und vor allem systematischer zu zeichnen. Es ist sicherlich ein heikles Unterfangen, allein auf der Grundlage schriftlicher Zeugnisse die Persönlichkeit eines Menschen schildern zu wollen – zumal wenn ihm eine ausgeprägte Neigung zum Sich-Verstecken und Sich-Entziehen eigen war –, doch lassen sich bei Mörike tatsächlich manche auffallenden Wesenszüge und bestimmte typische Empfindungs- und Verhaltensmuster rekonstruieren, die einen plastischen Eindruck von seiner Eigenart vermitteln. Unsere wichtigste Quelle bildet das umfangreiche Korpus der Briefe, aber als erster Anknüpfungspunkt soll eine Notiz dienen, die der Dichter sehr wahrscheinlich während der Cleversulzbacher Jahre niedergeschrieben hat und die in ihrer Mischung aus präziser Selbstdiagnose und behutsamer Verallgemeinerung ein bemerkenswertes Dokument seiner feinen psychologischen Beobachtungskunst darstellt. Festgehalten werden darin persönliche Erfahrungen, die er wohl auch einmal literarisch zu verwerten und auszugestalten gedachte:
Wie kommts daß mir gewiße Menschenwerke, zumal an e. fremden Ort, auch die gemeinsten Gegenstände, wenn sie nur etwas Tüchtiges, Festes, Massiges haben auf eine Art imponiren, eine Überlegenheit auf mich ausüben, ja mir bange machen können? Ein starkes Thor eine Eichenthür, mit schwerem Schloß Ring, Knauf u. Schrauben? (Es ist die überall hervortretende u. gerüstete Menschenkraft, Verstand u. Wille.) Sie scheinen sich gegen mich zu kehren, wenigstens mich auszuschließen; fremd gegen mich zu thun. Eine mächtig gefügte Brücke, die nur zweckmäßig nicht schön u. leicht ist, vielleicht finster u. plump, empfängt mich feindselig u. läßt mich nur gleichsam um Gottes willen durch. Ich rede aber hier nur v. solchen Potenzen die eigentl. geistlos und gemein. materieller Art sind. Was Geist u. Herz anspricht das ist gl. zugänglich, verwandt u. freundl. […] Jene drückende Wirkung sezt aber immer schon eine schwache Seite des Subjekt, eine ängstl. schüchterne Stimmung Gefühl von Fremde, Armuth, Unbehülflichkeit voraus. Mit einem gefüllten Beutel in der Tasche sieht man dergl. ganz anders oder gar nicht an. Denkt man sich die Menschen, deren Werk so stattlich u. herausfordernd aussieht in ihrer ganzen Menschlichkeit, Kümmerlichkeit, mit ihrer Dummheit, ihren Sorgen pp so schwindet gleich auch das Anspruchsvolle in ihren Produkten. (7, S. 286f.)
Wer Artefakte, die sich durch etwas „Tüchtiges, Festes, Massiges“ auszeichnen, gleich als einschüchternd empfindet, muss ausgesprochen unsicher und ängstlich veranlagt sein. Was von „Menschenkraft, Verstand u. Wille“ zeugt, macht ihm „bange“, weil er solchen Gewalten nichts entgegenzusetzen weiß: Ausdrücklich wird angemerkt, dass dieses Unbehagen „immer schon eine schwache Seite des Subjekt“ voraussetzt, „eine ängstl. schüchterne Stimmung“, ein „Gefühl von Fremde, Armuth, Unbehülflichkeit“, das jedes Selbstbewusstsein, wie es etwa ein wohlgefüllter Geldbeutel verschaffen könnte, im Keim erstickt. Begreiflicherweise stellen sich derartige Erfahrungen besonders leicht an fremden Orten ein, wo keine vertraute Umgebung dem beklemmenden Eindruck vorbeugt, hoffnungslos unterlegen und ausgeliefert zu sein.
Als Heilmittel empfiehlt Mörike eine Gedankenoperation, die die imposanten Gebilde auf dem Umweg über ihre Schöpfer gleichsam depotenziert, indem sie bewusst macht, dass auch hinter den eindrucksvollsten Bauwerken letztlich nur Menschen mit all ihren kreatürlichen Unzulänglichkeiten stehen. Noch aufschlussreicher ist jedoch seine Einschränkung im Hinblick auf die Gegenstände, die überhaupt unerfreuliche Gefühle der beschriebenen Art zu wecken vermögen. Übermächtig und fast bedrohlich wirken nämlich allein „solche Potenzen die eigentl. geistlos und gemein. materieller Art sind“, eine Brücke etwa, die „nur zweckmäßig“ und dabei vielleicht gar „finster u. plump“ ist. Ganz anders sieht es aus, wenn das fragliche Bauwerk sich „schön u. leicht“ präsentiert und damit „Geist u. Herz anspricht“. Mörike differenziert also begrifflich zwischen „Verstand“ und „Geist“: Während der Erstere für ihn nüchtern das Zweckmäßige, Funktionale kalkuliert, bezeichnet er mit „Geist“ die Fähigkeit des Menschen, auch höhere Qualitäten als bloße Nützlichkeit zu schätzen. Eine Brücke, deren schöne und leichte Bauweise den Geist ihres Schöpfers verrät und deshalb auch den des Betrachters anzieht, kündet von einer Formung der Materie im Dienste des ästhetischen Empfindens und damit von einer Erhebung über die beschränkte Sphäre des Nutzens und der Zwecke in das freie Reich der Schönheit, des künstlerischen Spiels. In diesem Reich aber fühlt sich der Schreiber der Zeilen wie zu Hause, und was dort beheimatet ist, mutet ihn sogleich „zugänglich, verwandt u. freundl.“ an. Ganz konkret erlebte Mörike das beispielsweise, als er 1831 das Ulmer Münster besichtigte: „Ich hatte noch selten Gelegenheit, bey grandiosen Gebäuden, es so zu empfinden, wie der beugende Eindruck des Ungeheuern sich in dem ruhigen Gefühl der Schönheit lößt, mit welcher unser Geist sich homogen empfindet“ (11, S. 206).
Über die Bedeutung der Kunst und des Spiels für Mörike werden wir an anderer Stelle ausführlicher sprechen; jetzt sollen uns zunächst die Schwierigkeiten beschäftigen, die ihm die praktische Auseinandersetzung mit der von „Menschenkraft, Verstand u. Wille“ geprägten Lebenswirklichkeit bereitete. Ein eklatanter Mangel an Durchsetzungsvermögen und energischer Zielstrebigkeit war nämlich in der Tat ein Charakteristikum des Dichters, an dem man nicht vorbeisehen kann. Dieses Manko hatte gewiss zum Teil äußerliche Gründe wie etwa den Umstand, dass Mörike von Kindheit an wenig Gelegenheit bekam, Willensstärke und Tatkraft zu entwickeln und zu erproben. Frühzeitig ohne eigenes Zutun auf eine festgelegte und recht komfortable Bahn gesetzt, musste er im Grunde nur noch dem vorgeschriebenen Weg von der Schule über das Studium bis ins Vikariat und ins Pfarramt folgen, was er zwar ohne Enthusiasmus, aber im Ganzen doch gehorsam tat. Auch die Bedingungen im Seminar und im Stift waren, wie wir bereits hörten, nicht dazu angetan, seine Initiative und seinen praktischen Sinn zu stärken. Die strengen Regeln dieser Bildungsinstitutionen, die Wertvorstellungen der bürgerlichen Gesellschaft, speziell der Ehrbarkeit, und nicht zuletzt der Erwartungsdruck von Seiten der Familie sorgten dafür, dass der junge Mann auf Kurs blieb – ausgenommen den einen Versuch, sich beruflich auf eigene Füße zu stellen, der 1828 prompt in ein Fiasko mündete. Mörike war zwar handwerklich nicht unbegabt; er betätigte sich nebenher unter anderem als Zeichner, Elfenbeinmaler und Steinmetz und erwog in seiner Cleversulzbacher Zeit sogar, eine eigene Laterna magica – einen Projektionsapparat – zu konstruieren und serienmäßig herstellen zu lassen. Aber in Angelegenheiten des Alltags zeigte er sich noch im fortgeschrittenen Erwachsenenalter oft ungeschickt und hilflos: Auf sich allein gestellt, empfand er schon Feuermachen und Kaffeekochen als ernsthafte Herausforderungen.1 So blieb er in seiner Unselbständigkeit auf die Hilfe praktischer veranlagter (weiblicher) Vertrauenspersonen wie Mutter, Schwester oder Ehefrau angewiesen. Übrigens fand er auch zum Geld zeitlebens kein rechtes Verhältnis, und seine gedrückte materielle Lage dürfte ihren Teil zu der ängstlichen Unsicherheit beigetragen haben, mit der er den Härten des Daseins begegnete – wir wissen ja: „Mit einem gefüllten Beutel in der Tasche sieht man dergl. ganz anders oder gar nicht an.“
Vor allem aber muss in diesem Zusammenhang auf Mörikes Krankengeschichte eingegangen werden, denn seine anfällige Gesundheit war von beträchtlichem Einfluss auf seine seelische Verfassung und seine Verhaltensmuster. Krankheit und Kränklichkeit stellten für ihn Lebensthemen dar, denen die Briefe an Freunde und Bekannte so breiten Raum widmen, dass im Folgenden nur eine kleine Auswahl der einschlägigen Stellen angeführt werden kann. Schon in der Tübinger Zeit beschrieb er Justinus Kerner, den er damals noch gar nicht persönlich kannte, in einem ausführlichen Brief sein Augenleiden, das sich in Kurzsichtigkeit und Doppelsehen äußerte.2 Außerdem machten ihm von Jugend an seine schlechten Zähne zu schaffen, die ihn bereits mit Anfang zwanzig fürchten ließen, „in ein paar Jahren ein ganzes Lazareth im Munde“ zu haben (10, S. 108). Urlaubsanträge, die er später beim Konsistorium, der obersten Kirchenbehörde, einreichte, wurden meist mit gesundheitlichen Problemen begründet, aber verschiedene Kuraufenthalte, so eine „Brunnenkur mit Molken“ in Stuttgart im Frühjahr 1831 (11, S. 199), brachten keine nachhaltige Besserung. Überdies war Mörike sehr wetterfühlig und scheint in seinem ganzen Leben keinen Ort entdeckt zu haben, dessen Klima ihm dauerhaft zuträglich gewesen wäre. Bei seinen zahlreichen Wohnsitzwechseln kam immer wieder die Frage nach den klimatischen Bedingungen ins Spiel.
Wirklich kritisch wurde der Zustand des Dichters in Cleversulzbach. Nachdem er schon Ende 1834 wochenlang an einer „UnterleibsEntzündung“ – vielleicht einer Blinddarmreizung – laboriert hatte, die ihn, wie er meinte, dem Tode nahebrachte (12, S. 76), lag er zwischen Spätsommer 1835 und Frühling 1836, vermutlich aufgrund einer heute nicht mehr exakt zu diagnostizierenden Nervenkrankheit, mit schweren Lähmungserscheinungen zu Bett. Diese Krankheit markierte einen entscheidenden Einschnitt in seinem Lebensgang, denn spätestens von da an scheint er seiner körperlichen Verfassung nicht mehr recht getraut und nie mehr ein volles und sicheres Gefühl von Gesundheit erlangt zu haben. Auf Jahre hinaus quälten ihn nun Unterleibs- und Verdauungsbeschwerden sowie rheumatische Schmerzen, die ihn manchmal aufs Neue lähmten. Vor allem aber war seine Arbeitsfähigkeit seither erheblich eingeschränkt, weil ihn schon die bescheidensten Aktivitäten im Handumdrehen geistig und körperlich erschöpften. „Ich muß mich schlechterdings noch von Allem enthalten was einige Anstrengung und Nachdenken erfordert und selbst das Leichtere darf ich nicht anhaltend betreiben“, teilte er im Februar 1838 seinem Freund Mährlen mit; schreiben könne er höchstens „½–¾ Stunde Morgens nüchtern im Bett“ (12, S. 163). 1847 versicherte er Vischer, er habe „in folge eines tief eingreifenden körperlichen Leidens seit 1835 mit Arbeiten fast ganz aufhören“ müssen (15, S. 217), und noch vier Jahre später erklärte er, dass er allenfalls früh am Tage in halbliegender Stellung etwa eine Stunde lang imstande sei, sich mit „einer strengern Denkarbeit“ zu befassen (16, S. 15). Verbrachte er einmal einige Zeit in Stuttgart, wie es im November und Dezember 1838 geschah, empfand er bei dem bewegteren geselligen Leben „gar zu oft u. täglich die engen Grenzen meiner körperlichen Kräfte“ (12, S. 225). So war gerade die Cleversulzbacher Zeit sehr viel bitterer und leidvoller, als es das verbreitete Klischee vom beschaulichen ländlichen Pfarrhaus-Idyll wahrhaben will. Die bewegende Klage „um verlorene Jahre des Siechbetts“, die Mörike damals dem lyrischen Ich von Auf dem Krankenbette in den Mund legte (1.1, S. 115), war ihm aus eigener Erfahrung wohlvertraut.
Man kann sich leicht denken, warum es ihn so sehr nach dem wundersamen „Kräutlein“ mit Namen „assiduitas in laborando“ – Ausdauer bei der Arbeit – gelüstete, das er gerne auf den Felsen der Schwäbischen Alb gepflückt hätte (11, S. 264); es gelang ihm jedoch zeitlebens nie, dieser nützlichen Pflanze habhaft zu werden. Dass er sich seit Mitte der dreißiger Jahre selbst in Phasen relativen Wohlbefindens nicht mehr auf umfangreichere literarische Projekte einließ, deutet keineswegs nur auf eine programmatische Wertschätzung der kleinen Dichtungsformen hin, sondern auch auf die Einsicht in die Grenzen seiner physischen Kräfte: „Denke ich aber an ein größeres Werk, so wird mir immer bang bei der unglaublichen Beschränkung die mein körperlicher Zustand u.s.w. mir bei der Arbeit auferlegt“ (15, S. 76). Und wenn ihn seine Kränklichkeit schon 1843 bewogen hatte, sich als Pfarrer pensionieren zu lassen, so war es natürlich erst recht schwierig, ein neues berufliches Tätigkeitsfeld zu finden: „ich fürchte für meine Gesundheit, wofern ein solches Amt Ansprüche an mich machte, denen ich bei der Eigentümlichkeit meines körperlichen Zustandes und der dadurch mit tyrannischer Strenge gebotenen Lebensweise (in Einteilung der Stunden für Arbeit Ruhe etc.) nicht völlig gewachsen wäre“ (14, S. 227).
1847 war noch einmal ein besonders schlimmes Jahr, in dem Mörike aufgrund eines diffusen Übels, das er als Rückenmarkserkrankung interpretierte, fast durchgängig ans Bett oder zumindest an sein Zimmer gefesselt und oft kaum imstande war, auch nur einen Brief zu schreiben. Noch im folgenden Sommer bezeichnete er sich mit Galgenhumor als ein „Pflanzenthier das beinah seine ganze Zeit auf das Verdaun u. Vegetiren angewiesen ist“ (15, S. 256). Ein Kuraufenthalt in Möttlingen und Teinach im Schwarzwald bewirkte dann zwar eine „wunderbare Besserung“ seines Befindens, die er vor allem dem segensreichen Einfluss seines geistlichen Freundes Christoph Blumhardt zuschrieb (S. 270), aber von langer Dauer waren diese Heilerfolge nicht. Bereits 1850 ist wieder von dem „Mangel an allem Gesundheitsgefühl“ die Rede, der ihm jeden Genuss vergälle (S. 340); Gliederschmerzen, Lähmungserscheinungen und angegriffene Nerven werden genannt.
Mörikes Krankengeschichte, die wir jetzt ungefähr bis zum Beginn der Stuttgarter Zeit verfolgt haben, gibt manche Rätsel auf. Angesichts der beredten Klagen, die seine Briefe durchziehen, mutet es einigermaßen verblüffend an, dass er das für die damalige Zeit durchaus beachtliche Alter von siebzig Jahren erreichte und die meisten seiner weitaus rüstigeren Jugendfreunde überlebte. Außerdem scheint er, von den Monaten unmittelbar vor seinem Tod abgesehen, noch im fortgeschrittenen Alter keineswegs besonders hinfällig gewesen zu sein. Auch akribischen medizinhistorischen Untersuchungen ist es nicht gelungen, den Leiden des Dichters zuverlässig auf die Spur zu kommen.3 Unser Interesse richtet sich allerdings ohnehin weniger auf vermeintlich objektive Befunde und Diagnosen als vielmehr darauf, wie Mörike selbst seine Situation auffasste und wie er sich mit ihr zu arrangieren suchte.
Der Frage nach eventuellen psychosomatischen Ursachen der oben beschriebenen Beschwerden können wir freilich nicht aus dem Wege gehen. Sie drängt sich geradezu auf, wenn man bedenkt, wie sehr Mörike oftmals unter seiner unbefriedigenden Lebenssituation und insbesondere unter der Last des geistlichen Amtes gelitten hat. Als Pfarrverweser in Ochsenwang, wo ihm auch noch die fatale „Alpluft“ zusetzte (11, S. 287), schüttete er Luise Rau sein Herz aus: „mich ergreift dabei ein Gefühl von Bitterkeit von Trotz und Ungeduld, das nur derjenige verstehen und verzeihlich finden wird, der sich je auf ähnliche unsinnige Art durch Indolenz oder Pedanterie seiner Vorgesezten von seinem natürlichen Elemente abgeschnitten und nach seinem besten Theile gelähmt und vernichtet sah“ (S. 327). Die Metapher der Lähmung begegnet in solchen Kontexten des Öfteren: Von „lähmenden Gesangbuchs-Einflüssen“ ist bereits 1827 die Rede (10, S. 167), und im Jahr darauf hören wir den gequälten Ausruf: „Alles, nur kein Geistlicher! hier bin ich ganz u. durchaus gelähmt“ (S. 199). Kann man es da noch für einen Zufall halten, dass Mörikes Krankheitsschübe sich immer wieder ausgerechnet in Form von Lähmungen äußerten, die ihm die Erfüllung seiner dienstlichen Pflichten schlechterdings unmöglich machten?
Ihm selbst war der Gedanke an einen untergründigen Zusammenhang von Physis und Psyche keineswegs fremd. Er erfasste ihn mit dem Begriff der Hypochondrie, der im unbestimmten Sprachgebrauch der Zeit eine abgeschwächte Variante der Melancholie, der tiefen Schwermut bezeichnete und eine Mischung aus Menschenscheu, düsteren Stimmungen, allgemeiner Ängstlichkeit und einer furchtsam gespannten Aufmerksamkeit für den eigenen körperlichen Zustand einschloss. Schon in jungen Jahren sprach Mörike von seiner „bößen hypochondrischen Natur“ (10, S. 104) oder verfluchte den „Satan Hypochondrie“, der ihn nie zu voller Zufriedenheit mit seiner Lage kommen lasse (S. 196), und noch 1854 erläuterte er dem Briefpartner Theodor Storm seine Neigung zu „extremen Sorgen“ mit den schlichten Worten: „Ich bin Hypochonder von Hause aus“ (16, S. 177). Die Angst um seine Gesundheit verfolgte ihn manchmal sogar im Schlaf, wo sie sich in alptraumhafte Bilder umsetzen konnte, wie er sie Ende 1838 in einem Brief an Mutter und Schwester schilderte. Der beigefügte Kommentar wird die Adressatinnen kaum getröstet haben: „Ihr dürft mich über diesen Traum nicht erst beruhigen; ich weiß, er hat nichts zu bedeuten, indem darin nur etwas stark dasselbe concentrirt u. ausgesprochen erscheint, was mich am Tag zuweilen in hypochondrischen Augenblicken wohl flüchtig beschlich. Wir wollen keineswegs den Muth verlieren. Ich hoffe alles Ernsts das Beste“ (12, S. 240).
Vor allem war ihm bewusst, dass er unter einer extremen Verletzlichkeit, einer geradezu krankhaft gesteigerten Sensibilität für störende Reize und Einflüsse litt, die letztlich nichts anderes gewesen sein mag als die Kehrseite jener Offenheit für subtile äußere und innere Eindrücke, für Naturwahrnehmungen und feinste Stimmungsnuancen, die zu den großen Gaben des Dichters Mörike gehörte. Im Sommer 1824 schrieb er an Waiblinger:
Es ist überhaupt in meinem wirklichen [d.h. gegenwärtigen] Zustand ein besonderer peinlicher Zug, daß Alles auch das Kleinste, Unbedeudenste was v. außen Neues an mich kommt – irgend eine mir nur einigermaßen fremde Person, wenn sie sich mir auch nur flüchtig nähert, mich in das entsezlichste bangste Unbehagen versezt u. ängstigt, weßwegen ich entweder allein oder unter den Meinigen bleibe, wo mich nichts verlezt, mich nichts aus dem unglaublich verzärtelten Gang meines innern Wesens heraus stört u. zwingt. (10, S. 58f.)
Ganz in diesem Sinne erwähnte er sechzehn Jahre später gegenüber Hartlaub seine „kranke Ängstlichkeit“ und seine „vis inertiä“, also eine paradoxe Kraft der Trägheit, der Untätigkeit (13, S. 112). Einen besonders bildkräftigen Vergleich gebrauchte er 1839 in einem Brief an Wilhelm Zimmermann: „Nun bin ich aber wie ein schaallos Ei seit meiner Krankheit, an deren Folgen ich noch immer trage“ (S. 21). Schutzlos allen Verletzungen preisgegeben wie ein Ei ohne Schale, so muss sich Mörike tatsächlich oft gefühlt haben. Wo aber Ängstlichkeit, Dünnhäutigkeit und echte physische Leiden eine solch unheilvolle Verbindung eingingen, konnte auf die Dauer nur eines helfen: ein umfassendes diätetisches Programm mit strengen Verhaltensregeln und Vorsichtsmaßnahmen, die das zerbrechliche innere Gleichgewicht schützten.