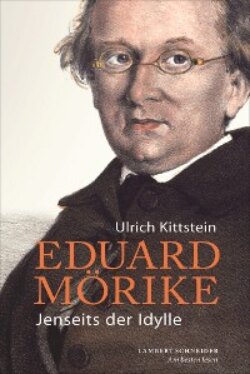Читать книгу Eduard Mörike - Ulrich Kittstein - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Unauffällige Meisterschaft
ОглавлениеWenn es ein generelles Merkmal gibt, das Mörikes Lyrik auszeichnet, so ist dies der markante Zug des Konkreten und Plastischen, der überall ins Auge sticht. Das gilt nicht nur für Schilderungen von Gegenständen oder Naturphänomenen, sondern auch für Gedanken und Empfindungen sowie für die Nuancen der sinnlichen Wahrnehmung. Nirgends trifft man in seinen Gedichten auf Unklares und Verschwommenes; alles ‚Nebeln und Schwebeln‘, jede diffuse Gefühligkeit war ihm ein Gräuel. Drastisch formuliert wird diese Abneigung in dem humoristischen Gedicht Restauration, dessen Sprecher sich durch den übermäßigen Konsum von miserabler Lyrik „ohne Saft und Kraft“ die Laune und den Magen verdorben hat: „Mir ward ganz übel, mauserig, dumm“. Aber er weiß sich zu helfen:
Ich sah mich schnell nach was Tüchtigem um,
Lief in den Garten hinter’m Haus,
Zog einen herzhaften Rettig aus,
Fraß ihn auch auf bis auf den Schwanz,
Da war ich wieder frisch und genesen ganz.
(1.1, S. 357)
Die besondere Qualität von Mörikes Lyrik bezeichnet man vielleicht am besten mit dem Begriff Genauigkeit, der auf die subtile Abstimmung von Gehalt, Ton, Redegestus, Bilderwelt und metrisch-rhythmischer Form zielt. Seine Werke sind mit größter Sorgfalt durchgeformte Schöpfungen und von träumerischem Phantasieren oder spontanem ‚Singen‘ weit entfernt; mit Recht nannte Theodor W. Adorno diese Gedichte „Virtuosenstücke, die kein Meister des l’art pour l’art überbot“.13 Der Kunstverstand, der sie beherrscht, macht sich jedoch nicht aufdringlich geltend, sondern verfährt überaus diskret, weshalb viele seiner Produkte auf den ersten Blick auch so einfach und kunstlos wirken. Mörike kultivierte als Poet eine unauffällige Meisterschaft – man könnte auch von raffinierter Schlichtheit sprechen. Dergleichen lässt sich aber nur anhand konkreter Beispiele aufweisen. Wenden wir uns deshalb jetzt einer exemplarischen Textanalyse zu, die wiederum zum Ausgangspunkt für einige verallgemeinernde Überlegungen werden kann.
Septembermorgen
Im Nebel ruhet noch die Welt,
Noch träumen Wald und Wiesen:
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt,
Den blauen Himmel unverstellt,
Herbstkräftig die gedämpfte Welt
In warmem Golde fließen.
(1.1, S. 144)
Das im Oktober (!) 1827 entstandene Gedicht zählt zu Mörikes bekanntesten und ist zugleich eines von denen, die gar keiner Erläuterung zu bedürfen scheinen, weil sie dem Leser gewissermaßen auf Anhieb einleuchten. Betrachtet man diesen Sechszeiler aber näher, erweist er sich rasch als ein erstaunlich komplexes Gebilde.
Schon die äußere Form birgt einige Überraschungen. Septembermorgen schließt nicht an einen überlieferten Strophentypus an, sondern schafft sich selbst seine ganz individuelle Gestalt. Nach den ersten drei Versen mit dem Reimschema a b a erwartet man eigentlich einen Kreuzreim, doch der b-Klang, der ihn vervollständigen müsste, bleibt zunächst aus, da die Verse 4 und 5 statt dessen wieder den a-Reim aufnehmen. Erst mit beträchtlicher Verzögerung, nämlich ganz am Schluss, findet das Wort „Wiesen“ endlich seinen Reimpartner, wobei sich mit „fließen“ freilich nur eine Assonanz statt eines reinen Reims einstellt. Gleichwohl ist damit die Spannung gelöst, die das Gedicht durch seine unkonventionelle Reimstruktur hervorgerufen und Schritt für Schritt gesteigert hat. Und schon hier stoßen wir auf eine Analogie zum Inhalt der Verse, der ebenfalls von einer Spannung geprägt ist – einer zeitlichen nämlich zwischen dem gegenwärtigen „Noch“- und dem angekündigten „Bald“-Zustand: Wo sich mit dem letzten Wort die Reimkette schließt, vollendet sich zugleich die Befreiung der „Welt“ aus ihrem erstarrten und verhüllten Zustand. Auch auf der Ebene der Kadenzen spiegelt sich diese Bewegung, denn da die b-Verse einen zweisilbigen (weiblichen) Versschluss aufweisen, klingt das Gedicht wirklich buchstäblich ‚fließend‘ aus. Beachten wir schließlich noch, dass im Übergang vom vorletzten zum letzten Vers der bis dahin dominierende Zeilenstil zum ersten und einzigen Mal durch ein Enjambement aufgehoben wird – ein weiterer formaler Aspekt, der den Effekt des Fließenden, Gelösten verstärkt.
Der Gegensatz von „Noch“ und „Bald“ wird des Weiteren durch die feine Variation der metrischen Struktur akzentuiert. Grundsätzlich hat das Gedicht einen jambischen Gang mit vier Hebungen in den männlichen und drei in den weiblichen Versen. Hin und wieder lässt sich aber eine gewisse Reibung zwischen diesem Muster und der natürlichen Betonung beobachten, und sie lenkt die Aufmerksamkeit auf eben jene Wörter, auf denen die Zeitstruktur des Gedichts aufbaut, denn zu Beginn der Verse 2 und 3 müssen beide, ihres inhaltlichen Gewichts wegen, zweifellos mit einer schwebenden Betonung belegt werden, obwohl sie in einer Tonsenkung stehen. Dasselbe geschieht im vorletzten Vers, wo man gewiss auch die erste Silbe des Neologismus „Herbstkräftig“ betonen wird. Im Verein mit der ausdrucksstarken Wortneuschöpfung als solcher unterstreicht diese Abweichung vom metrischen Schema den leuchtenden Eindruck der lichtdurchfluteten herbstlichen Natur.
Einer Intensivierung der ästhetischen Wirkung dient auch die Lautgestalt des Gedichts. Schon der Titel lässt die Sorgfalt erahnen, die Mörike auf sie verwendete: Warum der Dichter, dem Entstehungszeitpunkt seiner Verse zum Trotz, nicht etwa den Titel „Oktobermorgen“ gewählt hat, wird ohne weiteres einsichtig, wenn man nur die Klangfärbung der beiden Alternativen miteinander vergleicht! Den Text selbst durchziehen ganze Ketten von Alliterationen und anderen Klangkorrespondenzen (Nebel – noch – Noch; Welt – Wald – Wiesen; Himmel – Herbstkräftig; Welt – warmem), und während der erste Vers seinen Schwerpunkt in dem langen, dunklen u-Laut von „ruhet“ findet, der den tiefen Schlaf der nebelumsponnenen Welt förmlich hörbar macht, vermittelt der letzte durch seine weiche Lautfärbung, die schon erwähnte ausschwingende weibliche Kadenz und die Synästhesie, in der die Bewegung des Fließens, die Farbe des Goldes und die taktile Empfindung der Wärme miteinander verschmelzen, ganz sinnlich greifbar die Atmosphäre einer sonnenbeglänzten, zu Licht und Leben erwachten Herbstlandschaft.
Die Spannung zwischen zwei Zeitdimensionen, zwischen dem, was noch ist, und dem, was bald sein wird, beherrscht den gesamten Text. So steht dem Nebel, den die Inversion im ersten Vers unmittelbar an den Anfang des Gedichts rückt, am Ende das „warme Gold“ des Sonnenlichts gegenüber, und diesen Kontrast kann man mit weiteren Schlagwörtern vertiefen und differenzieren: Sehen wir auf der einen Seite Schlaf, Ruhe und Traum, Schleier und Verhüllung, Starre und Farblosigkeit, so auf der anderen Leben, Kraft und Fülle, Bewusstheit und Klarheit, Enthüllung und Offenbarung, Wärme und Fließen sowie die kräftigen Farben Blau und Gold. Allerdings ist der künftige Zustand, dem immerhin vier der sechs Verse gewidmet sind, eben noch kein wirklicher und sichtbarer, sondern lediglich ein verheißener. Kann schon die im Nebel ruhende Welt in der Dichtung nur sprachlich beschworen werden und daher allein in der Einbildungskraft des Lesers anschauliche Gestalt gewinnen, so potenziert sich dieser Sachverhalt ab dem dritten Vers, weil die Landschaft jetzt noch nicht einmal in der poetischen Fiktion des Gedichts so vorhanden ist, wie sie evoziert wird – umso entschiedener sieht sich der Rezipient auf das bilderschaffende Vermögen seiner Phantasie verwiesen. Und wird er mit dem Du, das ausgerechnet in diesem dritten Vers erscheint, nicht sogar unmittelbar angesprochen und aufgefordert, sich im Geiste jene Vision auszumalen, die der Text nur mit suggestiven Worten entwerfen kann? Septembermorgen ist mithin auch ein Gedicht über das produktive Wechselspiel zwischen der poetischen Rede und der Vorstellungskraft des Lesers.
Aber noch aus anderen Gründen würde eine Deutung als reines Naturgedicht den Gehalt des Werkes schwerlich erschöpfen. So legt zum Beispiel die zentrale Schleiermetapher, die in religiösen wie in philosophischen Kontexten traditionell mit dem Thema der Erkenntnis verknüpft ist, eine symbolische Auffassung der Verse nahe. Das verheißene Fallen des Schleiers wäre dann als Offenbarung der Wahrheit oder gar als Epiphanie des Göttlichen zu verstehen, dessen Verbindung mit dem belebenden Licht der Sonne ebenfalls einen geläufigen Topos darstellt. Und dass hier nicht zuletzt auch seelische Vorgänge im Inneren des Menschen gemeint sein könnten, etwa der Übergang von träumerischer Versunkenheit zu einer selbstbewussteren, realitätszugewandten Haltung, deutet schon die unübersehbare Anthropomorphisierung der „Welt“ an, die aus ihrem traumbefangenen Dämmerschlaf zur Klarheit und zur Wirklichkeit erwacht.
Die skizzierten Interpretationsvarianten sind keineswegs beliebig, da sie sich auf den Wortlaut und die ästhetische Faktur des Textes stützen, doch sollte man auch der Versuchung widerstehen, sie zugunsten eines einzigen Deutungsansatzes zu reduzieren. Der Reiz des Gedichts liegt gerade in der Überlagerung der unterschiedlichen ‚Lesarten‘, die es offeriert und die den Versen im Zusammenspiel mit dem Reichtum der formalen Mittel eine staunenswerte Komplexität verleihen – Septembermorgen ist ein Paradebeispiel für die außerordentliche Verdichtung, die große lyrische Kunstwerke auszeichnet. Einen wichtigen Aspekt dieser Verdichtung macht die starke Semantisierung der Formmerkmale aus, der wir vorhin im Einzelnen nachgegangen sind: Reim und Metrum, Klangfarben und Stilfiguren dienen nicht etwa bloß der Ausschmückung des Textes, sondern sind geradezu mit Bedeutung aufgeladen. Die Überzeugung, dass sich Form und Inhalt eines Gedichts gar nicht voneinander trennen lassen, gehört übrigens zu den wenigen poetologischen Grundsätzen, die Mörike auch explizit ausgesprochen hat. 1838 versuchte er sie dem eifrigen, aber glücklosen Verseschmied Friedrich Ostertag zu vermitteln: „Die Form ist doch in ihrer tiefsten Bedeutung ganz unzertrennlich vom Gehalt, ja in ihrem Ursprung fast Eins mit demselben, u. durchaus geistiger, höchst zarter Natur. […] Sie muß daher so vollendet als möglich seyn“ (12, S. 175f.).
Diese meisterhafte Verschmelzung von „Form“ und „Gehalt“, die so gut wie jedem Mörike-Gedicht seine ganz eigentümliche Prägung verleiht, haben wir oben mit dem Wort Genauigkeit zu fassen versucht. Ihr verdankt Mörikes Lyrik insbesondere die unübertreffliche Anschaulichkeit, die sie überall da erreicht, wo sie von sinnlichen Eindrücken spricht. Man lese nur einmal nach, wie das zweite Gedicht des Peregrina-Zyklus in Maler Nolten das Bild eines nächtlichen Zaubergartens entwirft, der zum Schauplatz einer erotischen Begegnung werden soll – „Wo im Gebüsche die Rosen brannten,/Wo der Mondstrahl um Lilien zuckte,/Wo die Bäume vom Nachtthau trofen“ (3, S. 362) –, oder wie in Auf einer Wanderung die enthusiastisch aufgeregte Stimmung des Ich die ganze Welt verwandelt, „[d]aß die Blüthen beben,/Daß die Lüfte leben,/Daß in höherem Roth die Rosen leuchten vor“ (1.1, S. 157). Wegen dieser Tendenz zur sinnlichen Konkretheit betrachtete Mörike sein Schaffen auch als wahlverwandt mit der bildenden Kunst. Größte Befriedigung bereitete ihm 1847 der Brief, in dem eine Gruppe von Dresdner Künstlern ihren Enthusiasmus für seine Idylle vom Bodensee ausdrückte: „Daß es gerade nur Maler, Bildhauer, Kupferstecher sind, von denen mir ein solcher Zuruf kommt ist mir auch deßhalb so besonders erfreulich, weil es bezeichnend eben für diejenige Eigenschaft des Gedichtes scheint, die mir –, wie billig bei dieser Art v. Darstellung – fast einer andern vorgehn mußte“ (15, S. 134f.). Und noch 1871 versicherte er dem Schwind-Schüler Julius Naue, dass ihm „ein Wort des Beifalls von Seiten eines bildenden Künstlers jederzeit das angenehmste“ sei (19.1, S. 173). Mit bloßem Reichtum an äußeren Details oder gar mit ‚malender Poesie‘ hat Mörikes poetische Genauigkeit allerdings nichts zu tun. Noch besser als an Septembermorgen kann man das an dem berühmten Gedicht Er ist’s erkennen, das den nahenden Frühling spüren lässt, ohne dabei über „Lüfte“ und „Veilchen“ hinaus irgendwelche Naturelemente direkt zu benennen oder gar in die Nähe einer dichterischen Landschaftsschilderung zu geraten (1.1, S. 41).
Mörikes „Drang, sich Alles, auch das Abstrakteste, gegenständlich auszuprägen“, fiel schon Theodor Storm bei seinem Treffen mit dem Dichter auf.14 Auch Reflexionen werden in seiner Lyrik für gewöhnlich mit sinnlichen Wahrnehmungen verwoben oder aus ihnen abgeleitet; so geht die vieldiskutierte Sentenz „Was aber schön ist, selig scheint es in ihm selbst“, die das Gedicht Auf eine Lampe beschließt (1.1, S. 132), unmittelbar aus der Anschauung eines individuellen Kunstgebildes hervor. Und die wichtigste inhaltlich-strukturelle Grundform von Mörikes Gedichten kann man als lyrische Situation bezeichnen, wenn man darunter eine stark verdichtete Konstellation aus äußeren Eindrücken und einer spezifischen Gefühls- und Stimmungslage des Ich versteht: Die Empfindungen des Sprechers sind an einen bestimmten raum-zeitlichen Kontext gebunden, dem sie ihrerseits eine eigentümliche atmosphärische Färbung verleihen. Beispiele dafür lassen sich in allen Phasen von Mörikes Schaffen finden; Im Frühling und Das verlassene Mägdlein gehören ebenso hierher wie Erinna an Sappho und die Bilder aus Bebenhausen.
Solche lyrischen Situationen ruhen aber meist nicht statisch in sich selbst, sondern unterliegen einer Entwicklung, die durch gewisse überraschende Impulse in Gang gebracht wird. Lieblingswendungen Mörikes wie „plötzlich“ oder „auf einmal“ signalisieren entscheidende Momente des Übergangs, die immer wieder den Dreh- und Angelpunkt eines Gedichts bilden, Momente eines intensiven Sinneseindrucks oder einer Einsicht, die das Ich blitzartig überfällt. Ulrich Hötzer schreibt dazu: „Der Augenblick des Mörikeschen Gedichts ist ein Moment des Dazwischen: zwischen Werden und Vergehen. Er repräsentiert den Umschlag vom einen ins andere und damit das Fließen der Zeit.“15 Deshalb spricht Hötzer gerade den Wörtern „noch“ und „schon“ eine strukturbildende Funktion zu, die man nicht nur in Septembermorgen, sondern auch in Früh im Wagen, In der Frühe oder An einem Wintermorgen, vor Sonnenaufgang studieren kann. Wie bereits die Titel verraten, findet die Zeitstruktur solcher Gedichte oftmals ihre Entsprechung in einer äußeren Übergangsphase, vor allem in der von Mörike so sehr bevorzugten Morgendämmerung, die sich wiederum leicht mit jenen gemischten Gefühlsregungen verbindet, auf die wir schon in anderen Zusammenhängen gestoßen sind.
Das kleine Gedicht Septembermorgen hat uns die Komplexität von Mörikes Lyrik eindrucksvoll vor Augen geführt. Semantische und formale Komplexität ist jedoch nicht mit Hermetik oder einem selbstgenügsamen Spiel der poetischen Sprache zu verwechseln. Die Virtuosität seiner unauffälligen Meisterschaft erhebt Mörike weit über das Klischee vom arglosen, gemütlichen Provinzdichter, doch auf der anderen Seite wahrte er auch Abstand zum ‚l’art pour l’art‘, zu einer Kunst um der Kunst willen. Als er mit Storm über das poetische Schaffen sprach, erklärte er, „es müsse nur so viel sein, daß man eine Spur von sich zurücklasse; die Hauptsache aber sei das Leben selbst, das man darüber nicht vergessen dürfe“.16 Tatsächlich gab es für Mörike, wie Friedrich Sengle feststellt, im Gegensatz zum reinen Ästhetizismus „noch eine Welt […], die Leben und Werk umgreift.“17 Da er weder die Existenz des Dichters noch die poetische Sprache von der Gesellschaft, die ihn umgab, und von der Erfahrungswirklichkeit ablöste, bleibt in seinen Texten die kommunikative Beziehung zu einem anvisierten – gebildeten – Lesepublikum durchgängig erhalten. Das gilt natürlich in besonderem Maße für die Gelegenheitslyrik, der er im Alter immer größere Aufmerksamkeit widmete, aber auch sonst spielen Geselligkeit und Gespräch als Thema wie als Bezugsrahmen seiner Dichtung eine gewichtige Rolle, die wir an späterer Stelle noch ausführlicher diskutieren werden.