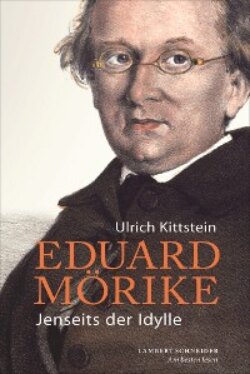Читать книгу Eduard Mörike - Ulrich Kittstein - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vom Reiz des Nervenkitzels
ОглавлениеIn einem Brief an Mährlen vom 5. Juni 1832 erzählt Mörike, wie ihn an einem „peinlich-müßigen Tag“ in Ochsenwang ein unerwartetes Naturereignis schlagartig von dem „Verdruß der Langenweile“ erlöst habe:
Da sah ich am Fenster ein Gewitter von der TeckSeite herziehen, eine Minute drauf rollte der erste Donner und alle meine Lebensgeister fingen an heimlich vergnüglich aufzulauschen. In unglaublicher Schnelle stand uns das Wetter überm Kopf. Breite, gewaltige Blize, wie ich sie nie bei Tag gesehen fielen wie Rosen-Schauer in unsre weisse Stube; und Schlag auf Schlag. Der alte Mozart muß in diesen Augenblicken mit dem Kapellmeister-Stäbchen unsichtbar in meinem Rücken gestanden und mir die Schulter berührt haben, denn wie der Teufel fuhr die Ouvertüre zum Titus in meiner Seele los, so unaufhaltsam, so prächtig, so durchdringend mit jenem oft wiederholten ehernen Schrei der römischen Tuba daß sich mir beide Fäuste vor Entzücken ballten. (11, S. 299)
Dass Mörike bei Blitz und Donner ausgerechnet Mozart-Musik zu hören glaubte, wollen wir vorerst nur als besonders auffallendes Detail vermerken, denn in Anbetracht seiner strengen diätetischen Maximen und seiner ängstlichen Zurückhaltung gegenüber allem Gewaltsam-Kraftvollen ist ja schon die Faszination für das Gewitter an sich eigenartig genug. Dabei stellt die zitierte Passage keinen Einzelfall dar. Eine ganz ähnliche Schilderung findet sich in einem Brief an Luise Rau aus dem Jahr zuvor: „Ein prächtiger Akkord des schnell entwickelten Gewitters gab meinen Träumereyen plötzlich eine kräftigere und freudigere Gestalt: es war als zerrisse ein Flor in meinem Innern: ich fühlte mich frey u. erhoben, ja ich empfand mich Dir näher“ (11, S. 213). Dazu passt die Rolle des Gewittermotivs in einigen frühen Gedichten, etwa in Im Freien oder Besuch in Urach, wo die entfesselten Naturgewalten eine vergleichbare Wirkung auf das lyrische Ich ausüben:
Da, plötzlich, hör’ ich’s durch die Lüfte treiben,
Und ein entfernter Donner schreckt mich auf;
Elastisch angespannt mein ganzes Wesen
Ist von Gewitterluft wie neu genesen.
(1.1, S. 47)
Der „kühne Anblick des feurig aufgeregten Elements“ versetzt auch Theobald Nolten, den Protagonisten von Mörikes Roman, für gewöhnlich in eine „muthige Fröhlichkeit“ (3, S. 365). Und die Vorliebe des Dichters für solche Erlebnisse verlor sich selbst im reiferen Alter nicht: Noch 1847 schwärmte er Karl Mayer von der „Herrlichkeit eines Gewitters“ vor (15, S. 198).
Was in den zitierten Textpassagen beschrieben wird, fällt in die Kategorie des Erhabenen, die schon im 18. Jahrhundert zunächst in England, dann auch in Deutschland zunehmend das Interesse der Philosophen erregt und sich in der Ästhetik gleichrangig neben dem Schönen etabliert hatte. Waren Naturmächte, die das menschliche Maß weit übersteigen, bis dahin lediglich als fürchterlich und grauenerregend wahrgenommen worden, so entdeckte man sie nun als ästhetisches Faszinosum, als reizvollen Nervenkitzel, wie wir heute sagen würden. Das galt für Erscheinungen wie das Meer, das Hochgebirge oder das Weltall, deren Größe unsere Fassungskraft sprengt, aber mehr noch für gewaltsame Entladungen, die jedes Individuum mühelos vernichten könnten und zu denen beispielsweise das Gewitter zählt. Für Mörike gab es aber noch Phänomene anderer Art, auf die er in ganz ähnlicher Weise affektiv reagierte. 1828 bekam er einen Kupferstich in die Hände, der eine der ägyptischen Plagen darstellte: „ich schauderte tief bei diesem Anblick, mir war als entlade jener schwarze Himmel sich auch über meinem Haupt mit begeisterndem Verderben. Ich brannte vor Lust“ (10, S. 200). Große historische Gestalten und außergewöhnliche zeitgeschichtliche Ereignisse konnten ebenfalls solche Gefühle hervorrufen. So verdankte sich beispielsweise Mörikes Bewunderung für Napoleon dem Reiz des Erhabenen – das Gedicht Nachtgesichte aus den zwanziger Jahren schildert eine Traumbegegnung mit Napoleon, die dem lyrischen Ich „Lust“ und „Entsetzen“ gleichermaßen einflößt17 –, und 1830 jagten ihm die Neuigkeiten von der französischen Juli-Revolution einen „freudigen Schauder“ über den Rücken (11, S. 151).
Diese Angstlust, die sich bei den unterschiedlichsten Anlässen einstellte und von Mörike offenbar intensiv genossen wurde, war eine ins Extrem gesteigerte Form jener gemischten Empfindung, die wir schon als ein typisches Muster in seinem Seelenleben kennen. Anspruchsvolle philosophisch-moralische Überlegungen, wie sie etwa Schiller an das Konzept des Erhabenen knüpfte, nach dessen Auffassung der Mensch gerade in der Begegnung mit der physisch übermächtigen Natur seiner Würde als unabhängiges Geistwesen inne werden kann, stellte Mörike jedoch nicht an. Er war tatsächlich an dem angenehmen Nervenkitzel als solchem interessiert, der seine vorsichtige diätetische Selbstbeschränkung wohltuend ergänzte, ohne sie doch aufzuheben: Das Erlebnis des Erhabenen versetzte ihn in Spannung, weckte seine Lebensgeister und erlöste ihn aus hypochondrischen Selbstquälereien, konfrontierte ihn aber nicht mit einem echten Risiko. Denn Voraussetzung für das Vergnügen an erhabenen Erscheinungen ist stets die Sicherheit des Betrachters, die beispielsweise durch eine beruhigende Distanz zum Geschehen gewährleistet sein kann – oder eben dadurch, dass dieses Geschehen bloß als Fiktion in einer künstlerischen Darstellung existiert. Aufschlussreich ist in dieser Hinsicht eine weitere Gewitterschilderung Mörikes, diesmal aus dem Jahre 1845. Damals, in Mergentheim, gewann das Unwetter nämlich eine solche Stärke, dass man es ernstlich mit der Angst zu tun bekam:
Ich hatte anfangs Lust gewohntermaßen mich an dem Schauspiel zu erfreuen, allein es verging einem bald. Der weite Marktplatz stand in einem fast ununterbrochenen Feuer, daß man die hellen Bretter einzeln zählen konnte, wessen Augen es aushalten mochten. Der Donner jedoch ohne besonders heftige Schläge, war nur ein beständiges Rollen. Wir hatten alle Laden zu mit Ausnahme des Blumenfensters, an das der Regen, wie es schien, mit starken Schlossen, so entsetzlich schlug daß wir in jedem Augenblick befürchteten die starken Tafelscheiben in das Zimmer fallen zu sehen. (14, S. 257f.)
Die Hausbewohner, darunter Mörikes spätere Frau Margarethe Speeth, flüchteten ins Treppenhaus, wo sie ausharrten, bis das Schlimmste vorüber war. Sobald der Beobachter also wirklich Gefahr für Leib und Leben zu fürchten beginnt, verliert die Situation schlagartig jeden Reiz für ihn! Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende, denn die Begebenheit hinterließ bei Mörike einen bleibenden Eindruck. Noch fast zwei Jahre später besann er sich in einem Brief an Margarethe darauf, nannte sie nun aber eine „schaurig-herrliche Nachtscene“ (15, S. 151) – jetzt, wo der Abstand der Erinnerung die nötige Sicherheit verbürgte, konnte der Kitzel der Angstlust doch wieder seine Wirkung entfalten. Übrigens ist es kein Zufall, dass Mörike in seinem Bericht von 1845, um sein gewohntes Verhältnis zu einem erhabenen Gewitterspektakel zu charakterisieren, die Schauspiel-Metapher verwendet, die im selben Zusammenhang auch schon in Besuch in Urach und Im Freien auftaucht. Die Analogie zum Theater liegt ja auf der Hand, denn wo kann man besser als dort ein aufwühlendes, oft gewaltsames Geschehen aus der sicheren Perspektive des Zuschauers verfolgen und Genuss daraus ziehen? Für Schiller war die Theorie des Erhabenen bekanntlich zugleich eine Theorie der Tragödie.
Betrachten wir zuletzt noch ein Gedicht, das ein anderes erhabenes Natur-„Schauspiel“ zum Thema hat. Es entstand 1846 als späte Frucht einer Reise in die Bodensee-Region, die Mörike sechs Jahre zuvor unternommen hatte, und ist in Distichen abgefasst, einer metrischen Form aus der antiken Poesie, auf die der Autor in jener Zeit häufig zurückgriff:
Am Rheinfall
Halte dein Herz, o Wanderer, fest in gewaltigen Händen!
Mir entstürzte vor Lust zitternd das meinige fast.
Rastlos donnernde Massen auf donnernde Massen geworfen,
Ohr und Auge wohin retten sie sich im Tumult?
Wahrlich, den eigenen Wuthschrei hörete nicht der Gigant hier,
Läg’ er, vom Himmel gestürzt, unten am Felsen gekrümmt!
Rosse der Götter, im Schwung, eins über dem Rücken des andern,
Stürmen herunter und streu’n silberne Mähnen umher;
Herrliche Leiber, unzählbare, folgen sich, nimmer dieselben,
Ewig dieselbigen – wer wartet das Ende wohl aus?
Angst umzieht dir den Busen mit Eins und, wie du es denkest,
Über das Haupt stürzt dir krachend das Himmelsgewölb!
(1.1, S. 163)
„Rastlos donnernde Massen auf donnernde Massen geworfen“ – mit seiner Wortwahl, seiner ganz von abwechselnden a- und o-Lauten geprägten Klangfärbung und seiner Wiederholungsstruktur lässt dieser Vers sowohl die lärmende Wucht der herabstürzenden Fluten als auch die unveränderliche Einförmigkeit ihres Anblicks anschaulich werden. Ewig in Bewegung und doch an seinen Ort gebannt, bildet der mächtige Wasserfall ein ideales Objekt der erhabenen Betrachtung. Zutiefst ergriffen von dem „Tumult“, der über „Ohr und Auge“ hereinbricht, und doch physisch in Sicherheit, wird der Sprecher von jener extremen gemischten Empfindung der Angstlust gepackt, deren beide Elemente im Text in der zweiten beziehungsweise vorletzten Zeile sogar ausdrücklich benannt sind. Aber nicht nur die Struktur des Naturerlebnisses als solche ist hier bezeichnend; auffälligerweise schaltet das Gedicht selbst bei seiner ästhetischen Annäherung an die tobende Elementargewalt noch einige zusätzliche Vermittlungsebenen ein. Von der eigenen Erfahrung spricht das Ich eher beiläufig und nur aus der Distanz des Rückblicks, von der das Präteritum im zweiten Vers zeugt, um sich statt dessen darauf zu konzentrieren, den angesprochenen „Wanderer“ in eine entsprechende Situation zu versetzen. Die wird dann zwar streckenweise äußerst plastisch und suggestiv ausgemalt, doch die Bildungsreminiszenzen in Gestalt mythologischer Versatzstücke, also die Anspielung auf den Sturz der Giganten, die den Olymp erstürmen wollten, und die metaphorische Umschreibung der brausenden Wogen als „Rosse der Götter“, sorgen wiederum für eine merkliche Brechung der sinnlichen Unmittelbarkeit. Und nicht zuletzt bändigt auch das Versmaß des Distichons die elementare Wucht, da es als ein höchst artifizielles Metrum den Kunstcharakter des Werkes unterstreicht, seine bewusste und souveräne sprachlich-formale Gestaltung akzentuiert. So wird der erhabene Gegenstand vom Dichter gleich in mehrfacher Hinsicht eingehegt und auf Abstand gehalten, damit das Gefühl der Sicherheit, ohne das ein genüssliches Auskosten der Angstlust unmöglich wäre, nicht ins Wanken gerät. Unter solchen Bedingungen kann es sich der Schluss des Gedichts sogar erlauben, apokalyptische Assoziationen an den Weltuntergang und damit den erhabensten Schrecken, der überhaupt denkbar ist, zu beschwören.
Der Reiz, den erhabene Phänomene in Form von Naturschauspielen oder ästhetischen Inszenierungen auf Mörike ausübten, widersprach seinen diätetischen Vorsichtsmaßnahmen nicht. Wieder einmal haben wir es mit einer der für ihn so typischen Kompromissbildungen zu tun, die ihm in diesem Fall lustvolle seelische Erschütterungen vermittelte, ohne dass er dafür die beruhigende und heilsame maßvolle Begrenztheit seiner Lebensführung aufs Spiel setzen musste. Dass Mozarts Musik ihn zumindest teilweise aus ähnlichen Gründen anzog, hat sich bereits angedeutet. Es lohnt sich, diese Einsicht im Gedächtnis zu behalten, denn sie wird später bei der Interpretation einer zentralen Passage aus Mozart auf der Reise nach Prag von Nutzen sein.