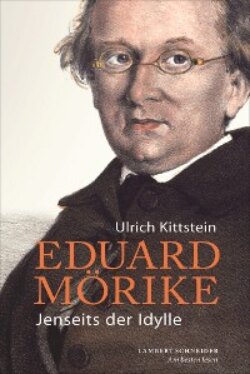Читать книгу Eduard Mörike - Ulrich Kittstein - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Familie Mörike
ОглавлениеMörikes Vorfahren väterlicherseits kamen aus Norddeutschland, genauer gesagt aus der Mark Brandenburg. Mindestens zweimal stieß der Dichter bei der Beschäftigung mit seiner Familiengeschichte in amtlichen Dokumenten auf einen gewissen Bartholomäus Möricke, der im späten 17. Jahrhundert aus dem fernen Havelberg nach Neuenstadt am Kocher – früher auch Neuenstadt an der Linde genannt – übergesiedelt war und durch seine Heirat mit der verwitweten Augusta Maria Vischer zum Stammvater der württembergischen Möri(c)kes wurde.7 Bartholomäus etablierte sich in Neuenstadt als Hof- und Stadtapotheker und rief damit eine Tradition ins Leben: Noch zu Eduard Mörikes Zeiten war die Neuenstädter Apotheke im Besitz seines entfernten Verwandten Karl Abraham Möricke. Während der Jahre, die Mörike im nahegelegenen Cleversulzbach verbrachte, stattete er dem wohlhabenden Vetter und seiner Frau Marie, deren Gesangstalent er sehr zu schätzen wusste, hin und wieder einen Besuch ab. Bei einer solchen Gelegenheit inspizierte er auf dem Kirchhof von Neuenstadt „alte u. moderne Grabsteine der Mörikeschen Familie“ (13, S. 218) – und entdeckte auf einem Grab eine Pflanze, die ihn zu dem Gedicht Auf eine Christblume anregte.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Familie Mörike in Württemberg bereits weit verzweigt. Die Ludwigsburger Linie hatte der Großvater des Dichters begründet, Johann Gottlieb Möricke, seines Zeichens Arzt und ein Enkel jenes Bartholomäus aus Havelberg. Sein Sohn, Karl Friedrich Mörike (1763–1817), war eigentlich für die geistliche Laufbahn bestimmt und absolvierte daher einen ähnlichen Ausbildungsweg, wie ihn Eduard später beschritt. Noch während des Vikariats entschied er sich aber doch für die Medizin und ließ sich nach abgeschlossenem Studium ebenfalls als Arzt in Ludwigsburg nieder. Neben seiner Berufstätigkeit betrieb er ehrgeizige wissenschaftliche Studien, deren Krönung ein umfangreiches philosophisch-medizinisches Werk in lateinischer Sprache bilden sollte, das schließlich als Fragment liegen blieb.8 1793 heiratete er Charlotte Dorothea Beyer (1771–1841), die einer schwäbischen Pfarrersfamilie entstammte.
Als studierter Mediziner und Oberamtsarzt war Karl Friedrich Mörike in Ludwigsburg eine angesehene Persönlichkeit. Die Mörikes zählten zu der sogenannten Ehrbarkeit, jener exklusiven Schicht bürgerlicher Honoratioren, die in Württemberg, wo es an landsässigem Adel fehlte, seit jeher eine wichtige Rolle gespielt, die Magistrate in den Städten besetzt und die meisten höheren Beamten des Staates gestellt hatte. Ihr politischer Arm war seit dem 16. Jahrhundert die „Landschaft“ gewesen, die Ständevertretung, deren spannungsreiches Verhältnis zu den regierenden Herzögen bis in die napoleonische Epoche hinein die württembergische Geschichte prägte. Als Eduard Mörike geboren wurde, vollzogen sich allerdings gerade jene Umbrüche, die die Ehrbarkeit ihrer politischen Funktionen und Machtmittel beraubten – in dem Kapitel, das sich mit der politischen Einstellung des Dichters befasst, wird darüber mehr zu sagen sein. Gleichwohl behielt sie ihre hohe Bedeutung für das gesellschaftliche und kulturelle Leben Württembergs. Die gemeinsame lutherische Konfession, verbindliche Wertvorstellungen und der relativ einheitliche weltanschauliche Horizont sorgten für eine gewisse Homogenität der Ehrbarkeit, die auch durch die teilweise erheblichen Unterschiede in den Vermögensverhältnissen der einzelnen Familien kaum beeinträchtigt wurde, zumal diese Honoratioren in der Regel einen recht bescheidenen Lebensstil von eher kleinbürgerlichem Zuschnitt pflegten. Überdies bestanden zwischen ihnen vielfältige verwandtschaftliche Beziehungen, die der Ehrbarkeit den Charakter eines komplexen Netzwerks verliehen und, wie man sich leicht denken kann, eine ausgeprägte Vetternwirtschaft begünstigten. In die oberste Spitze der Ehrbarkeit, die im ausgehenden 18. Jahrhundert noch die Schlüsselpositionen im Geheimen Rat des Herzogs und im Engeren Ausschuss der Landschaft innegehabt hatte, stieg die Familie Mörike zwar nicht auf, doch gab es durchaus Verbindungen zu dieser Sphäre. So war Eberhard Friedrich von Georgii, der verschiedene hohe Verwaltungsämter im Staat bekleidete und zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der württembergischen Politik zählte, in erster Ehe mit einer älteren Schwester von Mörikes Vater verheiratet gewesen. Für den Neffen sollte dieser einflussreiche Mann später ein wichtiger Förderer und zugleich eine väterliche Autoritätsfigur werden.
Einige Einblicke in das Leben im Elternhaus des Jungen gewährt das erste poetische Werk, das wir von ihm kennen, das Gedicht Ein Wort der Liebe den besten Eltern von Eduard Mörike an seinem eilften Geburtstage, das er für den 8. September 1815 anfertigte. Die elf achtzeiligen Strophen, die bereits von einem recht souveränen Umgang mit Metrum und Reim zeugen, orientieren sich inhaltlich weitgehend an den stereotypen Motiven, die man in solchen Gelegenheitsversen erwarten kann, doch sind die Strophen 3 und 4 gerade in ihrer Konventionalität aufschlussreich für die Rollenverteilung innerhalb der Familie:
Ach! der Leidenden so viele,
Die der Krankheit Last gedrückt,
Hat mit warmem Mitgefühle,
Ihre Hülfe schnell erquickt.
Vater! der Sie durch Ihr Leben
Mir des Fleißes Beispiel geben,
Möcht ich immer mich bestreben,
Menschenfreund! wie Sie zu sein!
Mutter! Ihrer zarten Liebe,
Ihres Beispiels hoher Kraft
Dank ich alle edlen Triebe,
Jede gute Eigenschaft.
Sie, die Ernst mit Milde paaren,
Nicht die größte Mühe sparen,
Meine Sitten zu bewahren,
Seien durch mich selbst belohnt.9
Der Vater wird in seinem ärztlichen Beruf und als unermüdlicher „Menschenfreund“ vorgestellt, der für den Sohn ein Muster an Fleiß und Pflichterfüllung verkörpert. Er ist gewissermaßen eine öffentliche Person, ihm obliegt die tätige Bewährung im Leben. Anders die Mutter, der das Gedicht „zarte Liebe“ und die Sorge um die „Sitten“ des Kindes zuordnet, also die Aufgabe der Erziehung und der sittlichen Bildung, die im Binnenbereich von Haus und Familie angesiedelt ist. Hier erkennt man unschwer die typischen komplementären Geschlechterrollen in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts wieder, und es ist nicht daran zu zweifeln, dass sie das familiäre Leben und die Alltagspraxis tatsächlich in hohem Maße geprägt haben. Obwohl die bürgerlich-patriarchalische Welt an der ideologischen Überhöhung der väterlichen Autorität festhielt, lag die Erziehung des Nachwuchses also vorwiegend in der Hand der Mutter, die für die Kinder die entscheidende Bezugsperson gewesen sein muss. Das bestätigen auch noch die einschlägigen Passagen in dem offiziellen Lebenslauf, den Mörike 1834 aus Anlass seiner Investitur in Cleversulzbach verfasste und der in der Kirche verlesen wurde:
Die Verhältnisse meiner Eltern waren für die erste Entwicklung der Kinder günstig genug; allein es konnte der Vater bei einem äußerst geschäftvollen Amte, das ihn den Tag über meist außer dem Hause festhielt, bei der rastlosen Thätigkeit womit er selbst daheim nur seiner Wissenschaft lebte, an unserer Erziehung nur den allgemeinsten Anteil nehmen. Wenn er auf uns wirkte, so geschah es zufällig durch einzelne Winke oder gewißermaßen stillschweigend durch den so liebevollen als ernsten Eindruck seiner ganzen Persönlichkeit; ausdrücklich, belehrend war seine Unterhaltung selten u. gegen die Jüngern, zu denen ich gehörte, fast niemals. Dagegen konnte uns im Sittlichen die Mutter auch statt alles Andern gelten. Durch ihre Zärtlichkeit, ihr reines Beispiel und durch ein Wort zur rechten Zeit gesprochen, übte sie ohne studirte Grundsätze u. ohne alles Geräusch eine unwiderstehliche sanfte Gewalt über die jungen Herzen aus. (7, S. 329)
Charlotte Mörike brachte insgesamt dreizehn Kinder zur Welt, eine für die damalige Zeit keineswegs ganz ungewöhnliche Zahl. Zur Normalität gehörte freilich auch, dass viele dieser Kinder schon bald nach der Geburt starben: Nicht weniger als sechs Geschwister Eduards ereilte dieses Schicksal. Übrig blieben Karl (1797–1848) und Luise (1798–1827), die älter waren als er, sowie August (1807–1824), Ludwig (1811–1886), Adolph (1813-1875) und die Nachzüglerin Klara (1816–1903). Von ihnen und ihren Schicksalen wird im Folgenden noch die Rede sein.
Eduards unbeschwerte Kindheit fand im Jahre 1815 ein plötzliches Ende, als Karl Friedrich Mörike, den ein Schlaganfall teilweise gelähmt hatte, seinen Beruf aufgeben musste. „Mit diesem Tage begann das Glück unseres Hauses in mehr als Einem Betrachte zu sinken“, konstatiert der Investiturlebenslauf lakonisch (7, S. 330). Die Zustände in der Familie gewannen nun eine ganz andere und äußerst beklemmende Gestalt; Mörike spricht von „Augenblicke[n] des herzzerreissenden Elends, die unauslöschlich in meiner Erinnerung stehen“, vom „Ernst des Lebens“ und von der „Hinfälligkeit alles Menschlichen“, die er „mit erschütternder Wahrheit“ empfunden habe (S. 331). Mag hier auch eine gewisse pathetische Stilisierung hineinspielen, die dem offiziösen Anlass dieser biographischen Skizze geschuldet ist, so gibt es doch keinen Grund, an der Stärke der Eindrücke zu zweifeln, die damals auf den Jungen wirkten.
Am 22. September 1817 beendete der Tod die Leiden des Vaters. Die Familie, ihres Oberhauptes und Ernährers beraubt, sah sich nicht nur in materieller Hinsicht in einer bedrängten Lage. Den heranwachsenden Söhnen fehlte nun jener Mentor, der ihnen den Weg aus dem umhegten Raum des elterlichen Hauses in die Sphäre der Öffentlichkeit, der Ausbildung und des Berufs hätte weisen sollen, und dieser Umstand mag mit dafür verantwortlich gewesen sein, dass die meisten von ihnen im bürgerlichen Leben auf unerfreuliche Weise Schiffbruch erlitten. Zunächst bewährte sich jedoch das verwandtschaftliche Beziehungsnetz, das weit über den engen Kreis der Kernfamilie hinausreichte. Schon in der Todesanzeige ihres Gatten hatte Charlotte Mörike der Hoffnung Ausdruck verliehen, „Gönner, Freunde und Verwandte“ würden der Witwe und den sieben Halbwaisen künftig beistehen10, und in der Tat kümmerte sich der bereits erwähnte Onkel Georgii um den jungen Eduard, indem er ihn zu sich nach Stuttgart nahm, um seine Bildung und seine Karriere zu fördern. Im Oktober 1817 verließ Mörike Ludwigsburg und zog in die Residenzstadt.
Zu einer Zeit, als die öffentlichen Wohlfahrts- und Fürsorgeeinrichtungen noch in den Anfängen steckten und der moderne Sozialstaat mit seinen vielfältigen Sicherungssystemen in weiter Ferne lag, waren ausgedehnte Verwandtschaftsnetzwerke, die wechselseitige Unterstützung garantierten, von lebenswichtiger Bedeutung, und gerade in der württembergischen Ehrbarkeit hatte die Familiensolidarität Tradition. Aber Mörike profitierte nicht nur von dieser Solidarität, er erfüllte später auch seinerseits gewissenhaft die Verpflichtungen, die sie ihm auferlegte. Es war keine bloße Phrase, wenn er 1843 in seinem Pensionsgesuch von den schweren „Opfern“ sprach, die er „als Sohn und als Bruder“ gebracht habe (14, S. 111). Die verwitwete Mutter nahm er zu sich, sobald er sich dazu imstande sah. Schon während seiner Zeit als Pfarrverweser in Ochsenwang teilte sie seine bescheidene Wohnung mit ihm, und 1834 zog sie mit in das geräumige Pfarrhaus von Cleversulzbach, wo sie dem Sohn bis zu ihrem Tod den Haushalt führte. Auf die „kindliche Pflicht“ gegen die Mutter, deren „sorgenvolle Lage“ er zu erleichtern wünsche, berief sich Mörike sogar in dem hochoffiziellen Brief an König Wilhelm I. von Württemberg, mit dem er sich 1830 – vergeblich – um die Pfarrei Erpfingen bewarb (11, S. 159), und der Dekan als sein unmittelbarer Vorgesetzter griff das Argument in seiner beigefügten Stellungnahme auf.11 Offenbar war es nicht unüblich, dass derartige Gesichtspunkte in solchen Fällen geltend gemacht und bei der Stellenvergabe, sozusagen als Ausgleich für das Fehlen institutionalisierter sozialer Absicherungen, auch nach Möglichkeit berücksichtigt wurden. Ähnlich lautende Passagen kehren in späteren Bewerbungsschreiben Mörikes wieder, unter anderem in dem, das ihm schließlich seine feste Pfarrstelle einbrachte.12 In Cleversulzbach fand auch die jüngste Schwester Klara Aufnahme, die unverheiratet blieb und fortan bis an sein Lebensende mit dem Dichter zusammenwohnte.
Schwierig und belastend gestalteten sich für Mörike auf lange Sicht die Beziehungen zu seinen Brüdern.13 Der nächstjüngere, August, kam schon 1824 in der Ludwigsburger Apotheke, in der er als Gehilfe arbeitete, unter etwas mysteriösen Umständen zu Tode, ein Vorfall, der auf Eduard traumatisch gewirkt haben muss.14 Dagegen berechtigte die Laufbahn des Ältesten anfangs zu großen Erwartungen, denn Karl Mörike, der in Tübingen Kameralistik studiert hatte, brachte es rasch zum respektablen Amtmann in Scheer an der Donau. Dort scheint er jedoch bald seine Dienstaufgaben vernachlässigt und seine Kanzlei in Unordnung gebracht zu haben. Um bei den bereits misstrauisch gewordenen vorgesetzten Behörden den Anschein gründlicher Pflichttreue zu erwecken, verfiel er 1830 unter dem Eindruck der Juli-Ereignisse in Frankreich auf den unseligen Gedanken, eigenhändig anonyme Plakate und Briefe mit revolutionären Parolen zu verfassen, die er anschließend ‚aufspürte‘ und meldete. Die ungeschickt angelegte Intrige flog auf und brachte ihm die Amtsenthebung und ein Jahr Festungshaft im Staatsgefängnis auf dem Hohenasperg ein. Eduard, der Karl seit frühester Kindheit besonders nahegestanden und sich ihm durch „Familien Äther“ und „Geistesübereinkunft“ verbunden gefühlt hatte (10, S. 211), schrieb voller Zorn: „Ich bin ganz aus allem Geleise gebracht. Stündlich durchkreuzen sich bange Gedanken in mir und oft ist Empörung u. Grimm gegen meinen Bruder mein einziges Gefühl – gegen den, für welchen ich sonst Blut u. Leben hätte lassen können“ (11, S. 183). In ein geregeltes Dasein fand Karl trotz verschiedener Bemühungen um einen beruflichen Neuanfang nie mehr zurück. Er ließ sich in seiner Verbitterung zu Erpressungen und Urkundenfälschungen hinreißen und verbüßte noch mehrere Haftstrafen, bis er 1848 an Lungentuberkulose starb. Für Eduard, der ihn in Ochsenwang und Cleversulzbach mehrfach vorübergehend bei sich aufgenommen und ihm, wenngleich mit zunehmendem Widerwillen, auch immer wieder finanziell unter die Arme gegriffen hatte, dürfte der Tod des unruhigen Bruders einer Erlösung gleichgekommen sein.
Nicht viel besser bewährte sich Adolph Mörike, der das Schreinerhandwerk erlernte und als Instrumentenbauer tätig war. Er führte über Jahre hin ein unstetes Leben, dessen Stationen nur teilweise zu rekonstruieren sind, und wurde ebenfalls mehrfach straffällig. Peinlicherweise saß er sogar einige Monate lang gemeinsam mit Karl im Arbeitshaus ihrer Vaterstadt Ludwigsburg ein – was das für die Familie bedeutete, kann man sich ausmalen. Eduard, der selbst nicht mit Reichtümern gesegnet war, brachte auch für diesen Bruder beträchtliche Geldsummen auf, bis es ihm endlich doch zu bunt und sein Ton merklich rauer wurde. In einem Brief an den Freund Wilhelm Hartlaub schilderte er im Frühjahr 1838 das derzeitige „Familienunglück“:
Carl hat sich ohne unser mindestes Vorwissen neue Angriffe kriminelle Drohungen gegen den JustizMinister erlaubt ohne Zweifel um ihm irgend eine Hilfe, ein Amt oder dergl. abzuzwingen. Dafür ist er nunmehr auf 6. Monate ins Arbeitshaus verdammt. Adolf, der ganz verworfene Mensch hat anderweitig böses Zeug gemacht, hierauf gegen mein ausdrückliches Verbot sich hieher geschlagen u. da ich ihn auf keine Weise sehen wollte, mein Haus mit Zudringlichkeiten bestürmt, worüber meine Mutter u. ich fast krank geworden sind. (12, S. 191)
Indes brach der Kontakt nicht völlig ab. Noch 1862 verfasste Mörike für Adolph, der sich bei der Leipziger Firma Breitkopf & Härtel als Klavierbauer bewerben wollte, ein zurückhaltendes, aber wohlwollendes Empfehlungsschreiben.15 Sein Bruder bekam die Stelle und konnte seine Existenz allmählich in ruhigere Bahnen lenken. Dennoch nahm es mit ihm ein trauriges Ende: Nach dem Unfalltod seiner Frau verfiel er in geistige Umnachtung und beging im April 1875 Selbstmord. Ob Eduard, der bald darauf verstarb, noch davon hörte, wissen wir nicht.
Auch Ludwig machte im Laufe seines Lebens allerlei sonderbare Sprünge und erlangte nie eine feste und dauerhafte berufliche Stellung. Er besuchte die Ackerbauschule in Hohenheim und arbeitete erst in der Schweiz, dann auf Schloss Pürkelgut bei Regensburg als Gutsverwalter; später gab er sich, überwiegend in München, mit dem Wollhandel ab und wurde schließlich Porzellanmaler. Dass er ebenfalls mehr als einmal finanzielle Unterstützung benötigte, muss kaum eigens erwähnt werden.
So erwies sich der scheue, ewig kränkelnde und wenig lebenstüchtige Eduard, der noch vor dem vierzigsten Lebensjahr seine Pensionierung beantragte, ironischerweise als der solideste und gesellschaftlich erfolgreichste aller Mörike-Brüder. Keines der übrigen männlichen Familienmitglieder erfüllte auch nur ansatzweise die Hoffnungen, die die Verwandtschaft in sie gesetzt haben dürfte. Wenn Mörike den Brüdern beistand, soweit es seine schwachen Kräfte erlaubten, und ihre Wege mit Bangen verfolgte, war dies gewiss nicht nur der geschwisterlichen Liebe, sondern auch der berechtigten Angst um den Ruf der Familie geschuldet: Kriminelle Verwandte, von denen einer nicht einmal vor Drohungen gegen Regierungsmitglieder zurückschreckte, konnten dem Staatsdiener, der Mörike als Vikar und Pfarrer war, keineswegs gleichgültig sein. Wie sehr ihn die Umtriebe von Karl und Adolph, ganz abgesehen von den Kosten, die sie verursachten, auch seelisch belasteten, lassen seine Briefe, die sich überwiegend auf sparsame Andeutungen beschränken, meist nur erahnen.
Ganz anders sah es mit den engsten weiblichen Angehörigen aus. War der Binnenraum der Familie damals aufgrund der spezifischen Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern ohnehin für gewöhnlich von den Frauen dominiert, so muss der frühe Tod des Vaters diese Prägung in Mörikes Fall noch verstärkt haben. Im Grunde blieb die Ursprungsfamilie für den Dichter zeitlebens eine schützende und bergende Sphäre, über die Mutter und Schwestern wachten. Seit den Tagen in Ochsenwang, als Charlotte Mörike zu ihm zog, lebte er fast ununterbrochen in weiblicher Obhut: mit der Mutter, mit der Mutter und der Schwester Klara, mit Klara allein oder mit ihr und seiner Ehefrau Margarethe. Dabei verharrte er immer bis zu einem gewissen Grade in der Rolle des unmündigen, umsorgten Jungen. Als ein „verwöhntes Kind“, dem man seinen Willen tun müsse, charakterisierte die ältere Schwester Luise den bald zwanzigjährigen Bruder in ihrem Tagebuch16, und er selbst bekannte noch im vorgerückten Alter, dass er „ohne weibliche Hilfe kaum existiren“ könne (16, S. 54). Wenn äußere Nöte oder seelische Konflikte seine Widerstandskraft zu überfordern drohten, war es die Familie, bei der Mörike Geborgenheit suchte und fand. Nie zeigte sich das deutlicher als in dem fatalen Sommer 1824, als er, zutiefst verstört durch seine verworrene Affäre mit Maria Meyer, überstürzt aus Tübingen abreiste und sich zu seiner Mutter und seinen Schwestern nach Stuttgart flüchtete. Was ihm gerade Luise in solchen Situationen bedeutete, verrät das Gedicht Nachklang. An L., dessen erste Strophe hier zitiert sei:
Wenn ich dich, du schöne Schwester sehe,
Und betrachte deinen Ernst so gerne,
In den Augen diese klaren Sterne,
Ist’s, als wollte weichen all mein Wehe.17
Wie aus den weiteren Versen zu erschließen ist, stellte Mörike die „reine Seele“ der engelsgleichen Schwester als rettende und erlösende Macht den quälenden erotischen Verstrickungen gegenüber. Später widmete er auch der Mutter zwei Gedichte, die im antiken Versmaß des Distichons abgefasst sind und in die Sammlung seiner Lyrik aufgenommen wurden: An meine Mutter und An Dieselbe. Trost, Frieden und Liebe strahlen hier von der Muttergestalt aus – und zwar im Kontrast zu einer „Welt“ (1.1, S. 169), die dem Sprecher offenbar ein ums andere Mal bittere Enttäuschungen bereitet. Der Schlussvers von An meine Mutter stellt zudem erneut eine Verbindung zu religiösen Vorstellungen her.
Allerdings bildete die intime Familiensphäre für Mörike nicht nur einen Ort der Fürsorge und der wohltuenden emotionalen Zuwendung. Von früh an sah er sich dort auch mit bestimmten Erwartungen konfrontiert, die sowohl moralische als auch ganz praktische Fragen betrafen und einen erheblichen Druck auf ihn ausübten. So war Luise, die mit noch nicht einmal dreißig Jahren an Tuberkulose sterben sollte, eine sehr fromme Frau mit strengen sittlichen Grundsätzen und scheint die Freundschafts- und Liebesbeziehungen ihres Bruders aufmerksam, sorgenvoll und auch ein wenig eifersüchtig überwacht zu haben. Mehrfach drängte sie ihn, sich von Menschen zurückzuziehen, deren Verhalten sie missbilligte und deren Lebenswandel ihr verdächtig vorkam. Das galt neben Maria Meyer etwa für Rudolf Lohbauer, den Mörike bereits aus gemeinsamen Ludwigsburger Kindertagen kannte und der sich in Tübingen wieder um seine Freundschaft bewarb. Mörike wagte zwar ein zaghaftes Wort zu seinen Gunsten, unterwarf sich aber doch rückhaltlos dem Urteil der Schwester, die ihn schon früher vor Lohbauers leidenschaftlichem Ungestüm gewarnt hatte:
Rudolf macht alle Anstalten mich diesen Winter für seinen Umgang zu gewinnen. Wahrhaftig, es wird mir schwer, die alte Liebe zu ihm aus meinem Herzen zu reissen, zumal da sich sein äußeres u. inneres Leben zur Reinigkeit hinsehnt. – Aber Dein nächstes Wort soll mich in diesem leidenvollen Kampf entscheiden, soll mich ein für alle mal entweder von ihm scheiden oder gib mir einen Mittelweg! (10, S. 113)
Luise fuhr daraufhin selbst nach Tübingen, um nach dem Rechten zu sehen, und bewog den Bruder dazu, Lohbauers Annäherung strikt abzuweisen.18
Die Familie war es überdies, die Mörikes beruflichen Werdegang festlegte. Bereits frühzeitig wurde besprochen und geklärt, welche Richtung er einschlagen sollte: „Mein Vater wünschte nicht, daß einer sr Söhne seinen Beruf ergreife u. man war, besonders auf den Wunsch eines verehrten Oheims, schon ziemlich übereingekommen mich dem geistlichen Stande zu widmen“ (7, S. 330). Und auch nach dem Tod Karl Friedrich Mörikes achteten neben der Mutter noch einige männliche Autoritätspersonen darauf, dass der Heranwachsende nicht von dem vorgegebenen Pfad abwich. Außer Georgii, dem im Investiturlebenslauf erwähnten „verehrten Oheim“, hatte dabei vor allem Christoph Friedrich Ludwig Neuffer, der Ehemann einer Schwester von Charlotte Mörike, der erst in Benningen bei Ludwigsburg und später in Bernhausen auf den Fildern Pfarrer war, ein gewichtiges Wort mitzusprechen.