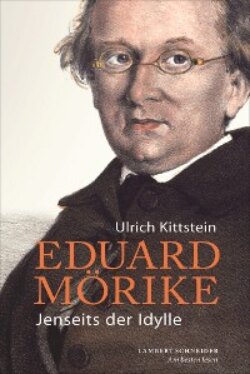Читать книгу Eduard Mörike - Ulrich Kittstein - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
„Freundeslieb’ und Treu‘“
ОглавлениеGedichte wie Trost oder Verborgenheit und manche Passagen in Mörikes Briefen könnten den Eindruck erwecken, als habe er die Einsamkeit über alles geliebt und sich wie ein Einsiedler vor der Welt verkrochen. Das ist jedoch nur sehr bedingt richtig, denn es gibt auch eine Reihe von Indizien, die genau in die entgegengesetzte Richtung weisen. Wir wissen bereits von seiner ausgeprägten Vorliebe für freundschaftliche Geselligkeit in den Uracher und Tübinger Tagen, und in der Vikariatszeit wurden häufig Klagen über den Mangel an frischen Anregungen und geselligem Umgang laut. Solche Impulse erkannte Mörike nämlich ebenfalls als notwendig für sein Schaffen, und in dieser Beziehung waren die Nachteile einer „Landpfarrey“ nun einmal nicht zu übersehen, wie er Mährlen gestand: „Was mir aber für einen großartigen Zweck im Poëtischen so nöthig – ach! viel nöthiger als irgend einem Andern ist – das geht ja dort ganz verloren! – eine lebhafte Berührung mit Diesem oder Jenem, der ein gleiches Bestreben oder wenigstens Liebe zu dem Meinigen und Liebe genug für mich hätte, um mich nicht einschlafen zu lassen“ (11, S. 32). Von der Sehnsucht nach einem produktiven Austausch mit Gleichgesinnten, nach dem „belebenden Athem“ (S. 80) und dem „erfrischende[n] Umgang“ (S. 173) eines Kameraden ist auch sonst des Öfteren die Rede: „Was wollt ich geben um einen rechten Freund, der in der Gegend wohnte. Ich bedarf so gar sehr der Mittheilung und gelegentlichen Reibung, sonst gerath ich mit allem leicht ins Stocken“ (S. 64). Dem Gespräch und seiner beflügelnden Wirkung schrieb der Dichter so große Bedeutung zu, dass er sich in Briefen manchmal ersatzweise eine mündliche Unterhaltung mit dem entfernten Adressaten ausmalte. „Man soll nur versuchen, statt für sich allein, mit andern zu denken und sich einen Dialog fingiren, so wird gewiß immer etwas Gescheidteres herauskommen“, stellte er befriedigt fest, nachdem er mit Hilfe dieses Kunstgriffs in einem Schreiben an den Bruder Karl eine verbesserte Version seiner Übersetzung des lateinischen Jesu, benigne zuwege gebracht hatte (S. 255).
Zu viel des Guten durfte es aber natürlich auch nicht werden, und so klingt in einem Brief an Luise Rau aus dem einsamen, hoch auf der Schwäbischen Alb gelegenen Ochsenwang mit seinen kaum mehr als dreihundert Einwohnern wieder einmal der Gedanke des rechten Maßes an: „Wie anders (muß ich mir sagen), wie glücklich könnt ich seyn mit einer kleinen, man sollte denken, so billigen Veränderung meiner äußern Lage; – gesunde Luft und ein regeres Verhältniß zur Welt in der Art wie sie mir gemäß ist – wie sehr ist nicht dadurch jede freudige Thnätigkeit, die ganze Harmonie meines Wesens bedingt!“ (11, S. 327) Auch im Hinblick auf das „doppelte Bedürfnis nach Einsamkeit und nach Anregung“8, das Mörike empfand, musste also ein Ausgleich angestrebt werden, der beiden Seiten Rechnung trug. Die Geselligkeitskultur des Biedermeier bot eine Fülle von Gelegenheiten zu Gesprächen und Bekanntschaften, meist im häuslichen Rahmen und verbunden mit allerlei künstlerischen und literarisch-ästhetischen Bestrebungen. Mörike stand in der Tat verschiedentlich mit solchen geselligen Kreisen in Verbindung, doch er bevorzugte die kleine, überschaubare und ganz informelle Runde vertrauter Freunde, weshalb er auch die Möglichkeiten zu Begegnungen, die ihm während der Cleversulzbacher Jahre das vielbesuchte Kerner-Haus im benachbarten Weinsberg eröffnete, nur sehr sparsam nutzte – mit dem Dichter Nikolaus Lenau, der dort regelmäßig zu Gast war, traf er beispielsweise nie zusammen. Waren die Personen und die Umgebung aber nach seinem Geschmack, so konnte er erstaunliche gesellige Talente entfalten und Humor und Heiterkeit versprühen, wie schon zahlreiche Bemerkungen und Erinnerungen seiner Jugendfreunde bezeugen. Er selbst charakterisierte sich wohl zutreffend, wenn er in seinem ersten Brief an Kerner von einer „lustige[n] Laune“ sprach, die seinem „sonst wohl hypochondrischen Temperament beigemischt“ sei (10, S. 95).
An die Partner in engen freundschaftlichen Beziehungen stellte er jedoch hohe Anforderungen. Einen Eindruck von dem, was echte Freundschaft für ihn bedeutete, vermitteln zwei Briefe an Männer, die ihm fast sein ganzes Leben hindurch besonders nahe standen. 1832 schrieb er an Johannes Mährlen im Anschluss an eine vergnügliche Schilderung gemeinsamer vergangener Erlebnisse:
Warum, Alter, geht mir das Herz so auf bei diesen Possen? Wahrlich nicht der Possen wegen, sondern dessentwegen, was sich von jeher so gerne darhinter versteckt hat. Das voll-befriedigte Gefühl, das erschöpfende Wohlseyn meiner armen anima, in Deiner geistigen und körperlichen Nähe, worin die ganze lange Skala möglicher Empfindungen, allgemeiner und individuellster, höchster Ernst und liebliche Narrheit so harmonischen und kräftigen Widerklang findet, wie bei keiner andern Seele, der angeborne Bruderzug, ich kanns nicht anders nennen. (11, S. 286)
Und Wilhelm Hartlaub versicherte er acht Jahre später:
Es ist nun einmal wahr, und warum soll ich Dirs nicht wiederholen, da mich das Herz antreibt: ich weiß neben Bruder und Schwester kein andres Menschenkind, verlange auch nach keinem, bei dem ich mich so wie bei Dir daheim befände, d.h. so innig in mir selber bleiben könnte. Du muthest mir nichts zu, was meinem Wesen nicht entspricht, und wenn Du mich anmahnst und aufschüttelst, so ists nicht mehr noch weniger, als ich bei meiner kranken Ängstlichkeit und jener vis inertiä, die ich selbst an mir kenne, gar wohl brauchen kann. (13, S. 111f.)
Intime Vertrautheit, die auf einer gewissen Seelenverwandtschaft beruhte, und die behutsame Rücksichtnahme auf Mörikes Eigenarten und Stimmungen ermöglichten eine vollkommene zwischenmenschliche Harmonie, die ein Gefühl tiefer Geborgenheit erzeugte. Im Umgang mit einem solchen Freund musste Mörike sich keinen Zwang antun oder aus seinem „Wesen“ heraustreten; in wohltuender Weise angeregt und ‚aufgeschüttelt‘, konnte er sich doch zugleich ganz „daheim“ fühlen. Dass die ideale Freundschaft in beiden Briefen einer geschwisterlichen Beziehung angenähert wird, ist kein Zufall, denn Freundschaft und Familie bildeten für den Dichter nahezu gleichwertige soziale Schonräume, die ihm emotionale Sicherheit gewährten und damit sein prekäres inneres Gleichgewicht stabilisierten. Als Drittes trat im günstigsten Fall noch die Liebesbindung an die Verlobte oder Ehefrau hinzu. Man betrachte nur folgende Briefauszüge nebeneinander:
Sagt ich nicht schon vor langer Zeit zu L. A. Bauer, […] der auch eine Schwester hat, wie ich: mir käm es oft vor, als hätte die meinige mit schwesterlich-tiefem Zauber in der Ferne und ohne daß sie mirs sage, meine Lebensfäden, die ich spinne oder die meine Natur spinnt, ruhig vorsehend in der Hand? (10, S. 48)
[…] es thut mir wohl, obgleich mit einer Anwandlung eines ängstlichen süßen Gefühls, Dich meinen Schutzgeist zu nennen, der ohn es selbst recht zu wissen, den verborgenen Knoten meines Lebens hält und mir leise Worte zuflüstert. (10, S. 122)
Noch kam kein Zweifel in mein Herz, daß, da Du mir geschenkt bist, das Schiksal Gutes mit mir vorhaben müsse, daß mir Dein reiner frommer Sinn das treueste Orakel für die Feststellung meiner innersten u. eigensten Angelegenheiten gewesen sey u. ferner bleiben werde; das heißt, ich werde meinem bessern Selbst treu bleiben, um so gewisser, als Du mit meinem Genius verschwistert bist und Hand in Hand mit ihm die sanften Bande hältst in denen sich mein Leben, mein Wollen hinbewegt. (11, S. 328)
Das erste Schreiben ist an Luise Mörike gerichtet, das zweite an Wilhelm Hartlaub, das dritte an Luise Rau – aber in allen Fällen geht es um dieselbe innige geistig-seelische Verbindung, um Schutz und Leitung durch eine Person, der Mörike sich vertrauensvoll und ohne Rückhalt hingab. Bei solch fließenden Grenzen zwischen Familie, Liebe und Freundschaft ist es nicht verwunderlich, dass er im Juli 1825 den Anfang eines Briefes, der eigentlich für seine Schwester gedacht war, ohne weiteres für ein Schreiben an Ernst Friedrich Kauffmann verwenden konnte.9 Der Schluss des 1837 für Hermann Hardegg verfassten Gedichts An Hermann, das auf ein vorübergehendes Zerwürfnis mit diesem Jugendgenossen zurückblickt, stellt die Freundschaft sogar über die Geschwister- und die Geschlechtsliebe, und Ähnliches geschieht auf dem Umweg über eine Bibelanspielung in einem Brief an Hartlaub aus dem Jahre 1839.10 Mit Mörikes Beziehung zu seiner späteren Frau Margarethe Speeth, in der er anfänglich eher eine neue Schwester gesehen zu haben scheint, werden wir uns an anderer Stelle noch befassen.
Geteilte Erinnerungen vor allem an die Jahre in Urach und Tübingen spielten in Mörikes Freundschaften als verlässlicher Bezugspunkt und Basis der wechselseitigen Vertrautheit eine wichtige Rolle. In Briefen an Mährlen beschwor er wiederholt die Studentenzeiten, in denen sie zu zweit Hölderlins Hyperion gelesen hatten11, und fasste sogar eine „Walfahrt nach Tübingen“ ins Auge: „im May 1830 hoffe ich mit Dir die duftige Schaale der Vergangenheit aufs neue zu kosten. Wir machen dann auch einen schweigsamen Gang auf den Österberg in W[aiblinger]s Gartenhaus, wir wollen alles Süße und alles Bittre bis auf den Grund ausschöpfen“ (11, S. 81f.). Umgekehrt verband sich die freudige Wehmut, die ihn bei Besuchen an den Orten seiner Kindheit und Jugend überkam, fast automatisch mit den Erinnerungen an die Freunde, die an diesen Plätzen hafteten. 1827 wurde eine Visite in Tübingen sogleich zum Anlass für einen überschwänglichen Brief an Mährlen12, und noch 1863 stürzte das Wiedersehen mit dieser Stadt Mörike in einen „Rausch von Erinnerungen“ und ließ ihn gegenüber Hartlaub bedauern, „daß wir die Tübinger Tour nicht miteinander machen sollten“ (17, S. 297f.). Die Vergangenheit, die er mit Hardegg teilte, reichte sogar noch weiter zurück und knüpfte sich „an die Häußer und Bäume von Ludwigsburg an die älterlichen Wohnungen, an die Balken der Bühnen an tausend Kleinigkeiten“ (10, S. 249) und ganz besonders an die „Maulbeerbäume im Hof“ des Hauses der Familie Mörike, von denen in An Hermann die Rede ist (1.1, S.113) und die der Dichter auch in anderen Rückblicken auf seine Kindheit erwähnt.
Mörikes Anhänglichkeit an die Vergangenheit macht verständlich, warum seine wichtigsten und engsten Freundschaftsbündnisse fast durchweg auf die Zeit in Ludwigsburg, Urach und Tübingen zurückgingen. Er hielt eben gerne am Gewohnten fest: „Das Anwerben neuer Freunde ist doch immer eine schwierige Sache und gewöhnlich werden sie nie so schmackhaft wie die alten“, ließ er sich bereits 1829 vernehmen (11, S. 64), und einmal bekannte er sich ausdrücklich zu seiner „Pietät für Jugendfreundschaft“ (S. 217). Zudem begünstigten die Bedingungen im Seminar und im Stift die Entstehung solcher Bindungen, während Mörikes vorsichtige Zurückhaltung im gesellschaftlichen Umgang später nur noch selten vergleichbare Gelegenheiten zuließ.
Dem Ideal vollkommener Offenheit und uneingeschränkten Vertrauens kam sicherlich der Bund mit Wilhelm Hartlaub am nächsten, jenem Mann, den Mörike sein „zweites Ich“ (13, S. 88) oder auch den „Vertrauten aus meinem innerlichen Leben“ (15, S. 340) nannte und dem er emphatisch versichern konnte, dass „kein erlogen Fädlein“ zwischen ihnen sei (12, S. 128). Hartlaub amtierte nacheinander in Wermutshausen, Wimsheim und Stöckenburg als Pfarrer. Er hielt nach dem Abschluss des Studiums zunächst noch brieflichen Kontakt mit Mörike, aber dann verloren sich die beiden für einige Jahre aus den Augen, bis eine Begegnung in Mergentheim, wo der Dichter 1837 zur Kur weilte, sie wieder zusammenbrachte. Fortan riss die Verbindung nicht mehr ab, obwohl es bisweilen Spannungen gab, weil Hartlaub äußerst empfindlich reagierte, wenn er sich von seinem Freund vernachlässigt fühlte, und später dessen Beziehung zu der Katholikin Margarethe Speeth mit größter Skepsis betrachtete. Die beiden Männer führten einen intensiven und verhältnismäßig kontinuierlichen Briefwechsel, der viele Einblicke in Mörikes privates und familiäres Leben gewährt, aber auch Besuche wurden ausgetauscht, wann immer es möglich war.
Mit dem Gedicht An Wilhelm Hartlaub (1.1, S. 237f.) schrieb Mörike 1842 eine förmliche Hymne auf „Freundeslieb’ und Treu’“. Es ist aber bezeichnend für ihn, dass die Verse nicht in der Unbestimmtheit einer schwärmerischen Empfindung verharren, sondern von einer konkreten Situation ausgehen – das lyrische Ich lauscht der Musik des Freundes, der „im Dämmerschein“ am Klavier sitzt, während es dem Wunder der Freundschaft nachsinnt. Und am Ende wird übermäßiges Pathos durch die Wendung ins Häuslich-Gesellige vermieden:
Da tritt dein Töchterchen mit Licht herein,
Ein ländlich Mahl versammelt Groß und Klein,
Vom nahen Kirchthurm schallt das Nachtgeläut’,
Verklingend so des Tages Lieblichkeit.
Tatsächlich waren Hartlaubs Frau Konstanze und ihre Töchter sowie auf der anderen Seite Klara Mörike in den regen freundschaftlichen Verkehr einbezogen.
Zu Recht hat Friedrich Sengle konstatiert, Hartlaub sei für Mörike „mehr Seelen- als Geistesfreund“ gewesen13 Mörike brauchte neben sich keinen gleichrangigen Dichter, der ihn durch die kritische Begleitung seines Schaffens anspornte, wie es etwa Schiller für Goethe gewesen war, sondern einen liebe- und verständnisvollen Partner, bei dem er sich sicher aufgehoben fühlen konnte. „Dein Urtheil schlag ich höher an als jedes andere, es sey in Lob oder Tadel“, schrieb er dem Freund (13, S. 242), aber produktive Kritik war von Hartlaub kaum zu erwarten, da er eine schier grenzenlose Ehrfurcht vor dem poetischen Genie des Freundes empfand und in der Regel mit Enthusiasmus auf dessen neueste Werke reagierte. Fragen der Literatur und der Poetik diskutierte Mörike eher im Briefwechsel mit Friedrich Theodor Vischer, über den in einem anderen Kapitel zu sprechen sein wird.
Angesichts von Mörikes Empfindlichkeit und seiner Neigung, Konflikten und Spannungen aus dem Wege zu gehen, kann es nicht überraschen, dass sich manche Freundschaftsbindungen mit der Zeit lösten, wenn sie seinen Erwartungen nicht mehr entsprachen. Begreiflich ist aber ebenso, dass er in solchen Fällen den offenen Bruch lieber vermied und es vorzog, sich einfach in Schweigen zu hüllen – erinnern wir uns an den Absagebrief an Waiblinger, der seinem Adressaten nie zugestellt wurde. Etwas näher sei hier die wechselvolle Beziehung zu Hermann Kurz betrachtet. Kurz, neun Jahre jünger als Mörike, hatte ebenfalls Theologie studiert, dann aber ein Leben als freier Schriftsteller, Übersetzer und Redakteur gewählt. Mit seinen Büchern wenig erfolgreich, musste er lange mit materiellen Nöten kämpfen, bis er 1863 endlich eine Stelle als Bibliothekar in Tübingen erhielt. Während er sonst oft als strenger und spöttischer Kritiker literarischer Werke auftrat, brachte er Mörike ungeteilte Bewunderung entgegen. Das Schreiben, mit dem Kurz den Kontakt knüpfte, datiert vom 20. Mai 1837 und setzte einen für Mörikes Verhältnisse ungewöhnlich regen und bald auch sehr vertraulichen brieflichen Austausch in Gang. Im Mai 1838 kam in Cleversulzbach die erste Begegnung zustande, bei der man gleich das Du vereinbarte. Die persönliche Bekanntschaft scheint Mörikes Neigung jedoch bereits spürbar abgekühlt zu haben, denn seine Briefe wurden nun seltener und wortkarger. Ende des Jahres gab es während seines mehrwöchigen Aufenthalts in Stuttgart „kleine Reibungen“ zwischen den Freunden, weshalb er Kurz vorschlug, „vor der Hand nur durch schriftliche Communikation einander nahe bleiben zu wollen“ (12, S. 229); wenigstens zeitweilig machte das Du auch wieder der förmlichen Sie-Anrede Platz. Nachdem 1839/40 noch einmal heftige Kontroversen ausgetragen worden waren, über deren Natur wir nichts Genaueres wissen, führten mehrere Treffen in der Nähe von Cleversulzbach zu einer erneuten Annäherung. Danach verstummte Mörike aber ganz, und volle dreißig Jahre vergingen, bis man wieder voneinander hörte. Als Kurz nämlich die Erzählung Mozart auf der Reise nach Prag in den „Deutschen Novellenschatz“ aufnehmen wollte, den er gemeinsam mit Paul Heyse herausgab, wandte er sich 1871, zwei Jahre vor seinem Tod, mit einem Brief an den Dichter. Er erhielt auch eine freundliche und versöhnliche Antwort, allerdings ohne jede Andeutung einer Erklärung für Mörikes langes Schweigen!14 Gesehen haben sich die beiden nie mehr.
Der eigentliche Grund für die Entfremdung dürften persönliche Animositäten gewesen sein, die in der Verschiedenheit der Charaktere begründet waren. Darauf lässt jedenfalls die einzige etwas präzisere Aussage schließen, die von Mörike zu diesem Thema überliefert ist: „Seine Manieren widerstreben meinem natürlichen Gefühl“, schrieb er in jenen Stuttgarter Tagen Ende 1838 über Kurz, „er hat, besonders andern gegenüber, so etwas Süffisantes“ (12, S. 229). Generell bedurfte es keiner konkreten Streitanlässe, um freundschaftliche Bande zu lockern oder gar nicht erst zustande kommen zu lassen. Wie später beispielsweise auch Theodor Storm erleben musste, hielt der Dichter bereits Distanz, wenn die eigentümliche Wesensart eines Menschen jene beglückende Harmonie unmöglich machte, die er im Umgang mit Freunden wie Mährlen oder Hartlaub erlebte. Jedenfalls war es, soweit wir das beurteilen können, durchweg Mörike, der sich spröde und distanziert verhielt oder eine Verbindung ganz einschlafen ließ. Dass er seinerseits jemals vergeblich um einen Freund geworben hätte, ist nicht bekannt.
Selbst enge Vertraute hatten von seinen Eigenheiten einiges auszustehen. 1831 schickte Vischer, der monatelang ohne Nachricht von ihm geblieben war, ein einziges Blatt mit einem großen Fragezeichen, woraufhin der Dichter sich schließlich doch zu einer Antwort bequemte15 Nach 1840 wurde ihr Briefwechsel aber sogar für sieben Jahre unterbrochen, unter anderem deshalb, weil Mörike sich über einige ihn betreffende Bemerkungen in Vischers Kritischen Gängen geärgert hatte.16 Andere Gefährten mussten sich oft ebenfalls lange gedulden, bis sie endlich wieder eines Briefes gewürdigt wurden. Die wortreichen Erklärungen, mit denen Mörike immer wieder um Entschuldigung für seine „Brieftrendlerei“ (11, S. 220) bat, würden ein stattliches Heft füllen. Symptomatisch ist sein Versuch, gegenüber Karl Mayer ein „langes, unbegreiflich langes Schweigen“ zu rechtfertigen: „Aller Welt bin ich auf diese Art verschuldet, und meine besten Freunde sind mir feind deßhalb, allein es ist gewiß, daß ich nur darum Niemanden mehr genugthue, weil ich mir selbst nicht mehr genüge“ (15, S. 329). Zumal wenn er sich brieflich über persönliche Angelegenheiten äußern wollte, war Mörike auf eine ausgeglichene Stimmung angewiesen, er musste sozusagen mit sich selbst im Reinen sein. An den Altersfreund Moriz von Schwind schrieb er:
Es ist der alte schlimme Eigensinn meiner Natur, daß ich, wenn es nach Innen nicht glatt und aufgeräumt bei mir aussieht, gerade den Edelsten und Besten gegenüber, bei denen ich, sobald die Feder einmal in Bewegung ist, am meisten in Versuchung komme, von mir selbst und aus dem Tieferen heraus zu reden, am schwersten mich zu einer Mitteilung entschließen kann. Durch Klagen rührt man nur den Grund der Klage auf, den man sich immer gern verbirgt, um noch erträglich fort zu existieren. (18, S. 236)
Und schon einige Jahre vorher teilte er Vischer mit, dass er „als ein Kranker“, der sich schonen müsse, „allen schriftlichen Verkehr, der irgend darnach war um mich in stärkere Bewegung zu versetzen und das Innerste herauszufordern, aufgegeben“ habe (16, S. 13). Ein anderes, mindestens ebenso häufiges Erklärungsmuster begegnet bereits 1821 in der ersten Mitteilung des siebzehnjährigen Schülers an Waiblinger: „Als ich Ihren Brief geleßen, war es fest bey mir beschlossen, ihn gleich am folgenden Tage zu erwiedern, daran wurd ich aber gehindert u. nun ward es eben verschoben, bis ich am Ende den Muth nicht mehr recht hatte“ (10, S. 21). Augenscheinlich empfand Mörike schon die kleinste Verzögerung bei der Beantwortung eines Briefes als drückende Last, die es ihm dann erst recht unmöglich machte, zur Feder zu greifen. Noch 1867 beschrieb er diesen fatalen Mechanismus folgendermaßen: „So strafte sich das erste Unterlassen u. Verschieben durch eine immer wachsende Verschuldung, indem, wie das so geht, die rechte Schreibelust durch das Versäumniß selbst merklich herabgestimmt war“ (18, S. 207).
Dabei war der Brief ein Medium, das Mörike, wenn er sich denn einmal zum Schreiben aufraffte, virtuos zu handhaben verstand. Wer einen Brief verfasst, schlüpft zwangsläufig in eine bestimmte Rolle, die von seiner Schreibsituation, dem behandelten Gegenstand und dem Adressaten abhängig ist und die er schreibend ausgestaltet: Er wird zum Geschäftspartner, Berichterstatter, Bittsteller, Ratgeber, Freund oder Liebhaber – die Reihe lässt sich beliebig fortsetzen. So können auch Mörikes Briefe nach ihren Anlässen und Empfängern in verschiedene Rubriken eingeordnet werden, denen jeweils ein spezifischer, fein abgestufter Ton eigen ist. Die Skala reicht vom ehrfurchtsvollen, mit offiziösen Wendungen durchsetzten Stil der Briefe an den König und andere hochgestellte Persönlichkeiten über den höflichen, aber nüchternen Duktus von Verlegerbriefen bis zu dem burschikosen Ton, den der Student oft gegenüber seinen Kommilitonen anschlug, dem vertraulichen Geplauder der Familienkorrespondenz oder der empfindsamen Poesie der Liebesbriefe an Luise Rau. Was Mörike auszeichnet, ist sein ungewöhnlich bewusster Umgang mit solchen Rollen, der viele seiner Briefe im Verein mit ihrer wohlbedachten sprachlichen Gestaltung zu wahren Kunstwerken macht. Auf seine eigentümlichen Selbstinszenierungen in der Korrespondenz mit bestimmten Partnern und auf gewisse spielerische Täuschungen und Experimente, die er sich dabei gelegentlich erlaubte, werden wir noch mehrfach zu sprechen kommen. Die Grenzen zur poetischen Fiktion lösten sich vollends auf, wenn Mörike gelegentlich sogar Motivkomplexe seines literarischen Werkes im Briefverkehr entwickelte und erprobte. Außerdem liebte er es, Briefe durch Gedichte, eigenhändige Zeichnungen oder sogenannte „Musterkärtchen“ aus seinem privaten Umfeld zu ergänzen. In diesen Verfahren drückt sich eine Annäherung der Kunst an die Sphäre des Alltagslebens aus, die rigoros mit dem Postulat der ästhetischen Autonomie bricht und die auch in anderen Bereichen seines Schaffens wirksam wurde.
Neben dem souveränen, kunstbewussten Rollenspiel hatte die Affinität zum Maskenwesen, die Mörike schon in jungen Jahren an den Tag legte, freilich noch eine andere Seite. Das früheste Zeugnis dafür ist der folgende „psychologische Exkurs“ (10, S. 29) in einem Brief an Waiblinger von 1822:
Das ist ein wunderlicher, aber schon tausenmal v. mir verfluchter Zug, daß ich, aus einer dunkeln Besorgniß, ich möchte dem Freund oder Bekannten, den ich zum erstenmal oder auch nach langer Zeit wieder sehe, (der aber im ersten Fall schon v. mir gehört haben muß) in einem ungünstigen Licht erscheinen, blizschnell aus meinem eigentlichen Wesen heraustrete. Das ist schon so eingewurzelt bey mir, daß ich diese Maske fast bewußtlos annehme u. so den Freund abhalte, mir frey, mit warmen Zutrauen entgegenzukommen, mithin keinem v. beyden, am wenigsten mir selbst damit diene. Dabey ist mir aber nicht wohl zu Muthe, es drückt mich immer, es ist als wär ich in einen neblichten Duft halb eingeschleyert, als stünde der Freund klar u. wahrhaft mir vor Augen, wo ich mich ihm dann so gerne ganz offen u. unbefangen zeigen möchte, je mehr ich ihn liebgewinne u. bemerke, daß er so mich nicht lieben kann, da möcht ich ihm gerne mit Thränen mein Inneres aufschließen, das von Wunden blutet – aber ich kann nicht mehr aus dem Schleyer herausspringen ich scheue mich vor ihm u. zürne wüthend über mich selber; u. dieser Zwiespalt diese Unzufriedenheit mit mir steigt dann aufs Höchste, wenn der Geliebte fort ist – ich brenne, ihn noch einmal zurückrufen zu können, um ihm das unächte Bild aus dem Herzen zu reissen – Aber genug! (S. 28f.)
Hier wird die Maske, die ihren Träger doch eigentlich schützend nach außen abschirmen soll, schmerzlich als Zwang zur Verstellung empfunden, der die ersehnte rückhaltlose Offenheit dem Anderen gegenüber unmöglich macht. Dieser quälende Zustand und die mit ihm verbundenen Phänomene des Missverständnisses, der Täuschung und des Betrugs, die sich in allen zwischenmenschlichen Verhältnissen einnisten können, bilden auch in Mörikes literarischem Werk ein zentrales Thema. Die Schwärmerei des Dichters für ideale freundschaftliche Beziehungen, die solche Schranken zu überwinden und die Fremdheit zwischen den Individuen in einem beglückenden Einklang der Gefühle und Seelenregungen aufzuheben vermochten, wird vor diesem Hintergrund umso begreiflicher.