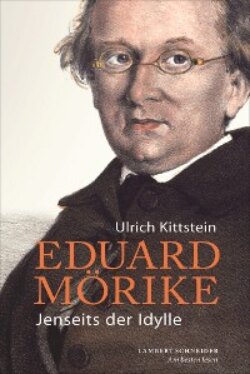Читать книгу Eduard Mörike - Ulrich Kittstein - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Im Verborgenen: Rückzugsstrategien und Grenzziehungen
ОглавлениеVon einem „vernünftigen Schema meiner künftigen Oeconomia interior“ – also gewissermaßen seines Seelenhaushalts –, mit dessen Hilfe er „dem gänzlichen Bankerott noch vorzubeugen“ hoffe, sprach Mörike bereits 1829, als sein Versuch, dem Kirchendienst zu entfliehen, gescheitert war (11, S. 31). Ähnliche Überlegungen durchziehen die Briefe späterer Jahre, in denen immer wieder das Bestreben des Dichters hervortritt, einen stabilen Ausgleich zwischen den Anforderungen der Umwelt und den eigenen Bedürfnissen zuwege zu bringen, der ihm eine halbwegs gesunde und zufriedene Existenz ermöglichen sollte. Im Dienste dieses Ziels mussten die Anregungen und Eindrücke von außen ebenso wie die eigenen Aktivitäten so weit eingeschränkt werden, dass sie ihn nicht überforderten. Daher gewann der Gedanke des rechten Maßes, der ja jeder Diätetik zugrunde liegt, für Mörike einen überragenden Stellenwert. Ihm ist die zweite Strophe des Gedichts Gebet gewidmet, die 1832 zunächst unabhängig von der ersten entstand:
Wollest mit Freuden
Und wollest mit Leiden
Mich nicht überschütten!
Doch in der Mitten
Liegt holdes Bescheiden.
(1.1, S. 210)
Nicht der Gegensatz zwischen „Freuden“ und „Leiden“, sondern der zwischen dem richtigen Maß und dem ‚Zuviel‘ strukturiert diese Verse: Statt sich das Angenehme zu wünschen und von Leid befreit werden zu wollen, wie man es eigentlich erwarten sollte, bittet das lyrische Ich darum, von jeglichem Übermaß, es sei nun im Guten oder im Bösen, verschont zu bleiben. Im Redegestus des christlichen Gebets verkündet es ein Ideal der rechten Mitte, das eher philosophischen Lebenslehren der Antike verpflichtet ist, wie man sie bei Aristoteles oder in der „aurea mediocritas“ des Horaz formuliert findet.4 Mörike sah sich wegen seiner „bößen hypochondrischen Natur“ schon frühzeitig auf eine solche Haltung verwiesen, wie er 1825 dem Freund Ernst Friedrich Kauffmann schrieb: „Ich tepeszire mit Leid und Freude gerne so fort – sonst komm ich aus dem Gleichgewicht und habe nach beiderley Schwelgereyen nachher wieder unendlich viel mit Schmerzen abzuräumen, zu sondern und einzuschachteln“ (10, S. 104). Das Verb „tepeszieren“ leitet sich vom lateinischen „tepesco“ ab, das so viel wie „lau oder warm werden“ bedeutet. Die ‚lauwarme‘ Mittellage in heilsamer Distanz zu allen Extremen schien Mörike die bekömmlichste zu sein.
Betrachten wir die unterschiedlichen Gebiete, auf denen die „strenge geistige Diät“ (12, S. 98), die er sich verordnete, wirksam wurde! Bereits die bewusste Beschränkung des poetischen Schaffens, die er zeitweilig vornahm, war nicht nur auf körperliches Unvermögen, sondern auch auf die Furcht vor den aufreibenden geistig-seelischen Wirkungen des Dichtens zurückzuführen: „Was mein Verhältniß zu der Poesie betrifft so ists für jezt eigentl. nur die Sehnsucht eines Liebhabers zur Liebsten, der sich Diät halber enthalten muß. Ich darf mich nicht, auch nur auf eine Stunde mit ganzer Seele an einen Gegenstand hingeben“, teilte er Friedrich Theodor Vischer mit (12, S. 147), und dem befreundeten Poeten Karl Mayer schrieb er: „Mit meiner Gesundheit geht es nicht übel. Nur darf ich mich noch an Nichts hingeben, was einige Anstrengung fordert. Im poetischen Feld, auf meinem eignen wenigstens, ruht Alles“ (13, S. 151). Der kleine Einschub im letzten Satz ist aufschlussreich, denn in der Tat sah sich Mörike damals sehr wohl in der Lage, Mayer bei der Vorbereitung einer Lyriksammlung zu helfen und ihm Vorschläge zur Verbesserung seiner Gedichte zu unterbreiten; nur vor der selbständigen schöpferischen Tätigkeit musste er sich hüten. Wir werden noch sehen, dass die Übersetzungen antiker Dichtung, die er in den späten dreißiger Jahren in Angriff nahm, aus denselben diätetischen Rücksichten erwuchsen. Die Sorge um sein Wohlbefinden war also mit dafür verantwortlich, dass Mörikes Oeuvre so schmal blieb, obwohl es ihm keineswegs an fruchtbaren Ideen fehlte und er jederzeit über „einen ganzen Rummel von selbsterfundnen Stoffen“ (12, S. 147) und ein „bestens assortirte[s] MährchenWaarenLager“ verfügte (S. 199). In einem Brief an David Friedrich Strauß fasste er 1838 sein Dilemma zusammen: „Ich habe ein ganzes Nest voll kleiner u. größerer Geschichten, Novellen u. Mährchen im Kopf, kann mich aber […] zur Zeit an so etwas mit Lebhaftigkeit, wie ich doch müßte, nicht hingeben“ (S. 164).
Da sich seine „Diät“ konsequenterweise „selbst auf die Lektüre“ erstreckte (12, S. 158), ließ Mörike auch bei der Auswahl seines Lesestoffs Vorsicht walten. Vischers kühne Novelle Ein Traum, in der sich ein nihilistischer Selbstmörder vor dem Thron eines philiströsen, selbstzufriedenen Gottes rechtfertigt, kam ihm da sehr ungelegen, obwohl er ihre literarischen Qualitäten anerkannte – dergleichen störe seine „geistige Diät u. Ökonomie“ und verursache ihm „Übelkeit“ (11, S. 169). Vollends unerträglich fand er die „kranke Desperationskoketterie“, die er den Gedichten Heines unterstellte: „es hat sich bey mir seit Lesung der Letzteren eine Art Abneigung gegen alle lyrische Verzweiflungsexpektorationen eingenistet in so fern sie nemlich NB. das Gefühl zu lange in Anspruch nehmen“ (S. 170f.). Den Roman Die Zerrissenen von Alexander von Ungern-Sternberg schlug er lieber gar nicht erst auf:
Mich schreckte […] der Titel den ich charakteristisch für unser Zeitalter nahm […]. Übrigens sage ich bei dieser Gelegenheit, daß ich der Kränklichkeit und Schmerzens-Pralerei unserer jezigen Poësie gegenüber mich (wenn ich je an eine neue Arbeit von mir denke) herzlich nach einem gesunden idealen Stoffe sehne, der sich eine antike Form assimilirte. Nur diß bewahrt entschieden vor jenem modernen Unwesen, von dem man doch wider Willen mehr oder weniger auch mit sich schleppt. (12, S. 46)
Ausdrücklich bezieht sich Mörike hier auf jene weltschmerzliche ‚Zerrissenheit‘, die in der Restaurationsepoche nach 1815 so verbreitet war und unter anderem in den Werken von Nikolaus Lenau, August von Platen und Heinrich Heine einen literarischen Niederschlag fand. Die Hochkonjunktur dieser melancholischen Stimmungslage, die mit ihren Sinnzweifeln und ihrem Lebensekel schon Züge des späteren Nihilismus vorwegnahm, hatte verschiedene Gründe: Das Zerbrechen der romantischen Dichter-Utopien und der hochfliegenden Entwürfe der idealistischen Philosophie, der fortschreitende Zerfall metaphysischer Gewissheiten sowie die bedrückenden politischen Verhältnisse jener Jahre und der Eindruck einer allgemeinen gesellschaftlichen Stagnation dürften eine Rolle gespielt haben. Mörikes entschiedene Antipathie gegen dieses „moderne Unwesen“ ist für ihn ebenso charakteristisch wie das nachgeschobene Eingeständnis, dessen fatale Wirkungen auch selbst zu verspüren. Das Gefühl, unfrei und in der Entfaltung seiner Fähigkeiten empfindlich behindert zu sein, auf das er, wie es scheint, immer wieder mit Kränklichkeit reagierte, war demnach keine reine Privatsache, sondern ein zeittypisches, von gewissen geistesgeschichtlichen, politischen und sozialen Konstellationen begünstigtes Phänomen, obwohl es in Mörikes Fall sicherlich durch die ganz individuellen Bedingungen seiner Existenz modifiziert wurde. Der in der zitierten Passage angedeutete Gedanke, dass man in der Hinwendung zur Antike ein Heilmittel für solche Leiden finden könne, wird uns an anderer Stelle noch beschäftigen, denn er sollte später entscheidenden Einfluss auf das Schaffen des Dichters nehmen. Harmonie und Idyllik, die zumindest weite Teile seines Werkes in so auffallendem Maße prägen, und das vielzitierte „holde Bescheiden“ aus dem Gedicht Gebet (1.1, S. 210) waren für ihn jedenfalls keine Selbstverständlichkeiten, sondern wurden der äußeren Beengung und mancherlei inneren Konflikten stets aufs Neue mühsam abgerungen.
Dass Mörike in Phasen besonderer Empfindlichkeit auch den Umgang mit seinen Mitmenschen einschränkte, hat uns bereits der weiter oben angeführte Brief an Waiblinger verraten. Von Krankheit, Schwäche und hypochondrischen Sorgen geplagt, sah er sich oftmals sogar genötigt, Besuche abzulehnen, die ihm eigentlich nicht unwillkommen gewesen wären. 1837 beispielsweise musste er sowohl auf Bauers Gesellschaft verzichten – „es wäre für mich, unter meinen Umständen, des Guten zu Viel“ (12, S. 128) – als auch eine Einladung von Hermann Kurz ausschlagen:
Es liegt in der Natur einer solchen Zusammenkunft, daß sie, auch wenn man keineswegs darauf ausgeht, sich außer Athem zu setzen, doch nicht ohne lebhafte Anregung dessen, was in und an uns ist, Stattfinden kann. Nun fühle ich mich aber in der That weit nicht gestärkt genug, um mich einem Genuß der Art zu überlassen. Ich kenne mich auf diesen Punkt und weiß, ich würde unwillkürlich weiter geführt, als sich mit meiner Reizbarkeit und meinem ganzen difficilen Zustande verträgt. (S. 130f.)
Vier Jahre später entging dem Cleversulzbacher Pfarrer aus ähnlichen Gründen eine Bekanntschaft, die ihm vielleicht sehr nützlich gewesen wäre. Als Ludwig Tieck auf der Durchreise im nahen Heilbronn Station machte, arrangierte Justinus Kerner ein Treffen mit Mörike – und Tieck, der ein schmeichelhaftes Interesse an dem schwäbischen Kollegen bekundet hatte, war nicht nur ein Autor, den Mörike seit seiner Jugend schätzte, sondern auch ein Mann von beträchtlichem Einfluss in literarischen Kreisen und am Berliner Hof. Wer aber am vereinbarten Tag nicht erschien, war Mörike. In einem kurzen Schreiben an Tieck entschuldigte er sich unter Hinweis auf „ein unerwartet eingetretenes Unwohlseyn“ (19.2, S. 22), während er gegenüber Kerner, der die verpasste Gelegenheit wortreich beklagte, ein wenig ausführlicher wurde: „Ach! wäre ich gesund und nicht von aussen immer so gehezt und beengt, wie viel zufriedener sollten meine Freunde mit mir seyn. So aber muß ich ihnen öfter undankbar, als ein launischer Hypochonder erscheinen. Ich weiß das Alles anders und kann es doch nicht ändern!“ (13, S. 181)
Neben dem wachen „Instinkt, Alles zu meiden, was mich einigermaßen lebhaft anregen könne“ (13, S. 21), war bei solchen Zwischenfällen ein ausgeprägter Widerwille gegen jede noch so entfernte Berührung mit der Sphäre der Öffentlichkeit im Spiel, die seinem diätetischen Programm strikt zuwiderlief. Deshalb bedeutete auch das Predigen unter sämtlichen Pflichten seines geistlichen Berufs die größte Plage für ihn. Schon zu Beginn des Vikariats sah er „mit den peinlichsten Gefühlen einem jeden Predigttag entgegen“ (10, S. 180), und im Laufe der Zeit wurde ihm das Sprechen vor der Gemeinde mehr und mehr zur physischen und psychischen Qual. Er sei „nicht über eine Viertelstunde öffentlich zu reden im Stande“, versicherte er 1838 (12, S. 210), und seinen Abschied vom Pfarrberuf begründete er kurz und bündig mit den Worten: „Ich kann das Predigen nicht vertragen“ (14, S. 127). In Cleversulzbach schob er die lästige Aufgabe jahrelang auf seine Vikare ab, bis er endlich nicht mehr umhin konnte, seiner offenkundigen Amtsunfähigkeit mit dem Gesuch um vorzeitige Pensionierung Rechnung zu tragen. Später empfand er sogar die wenigen Unterrichtsstunden, die er wöchentlich am Stuttgarter Katharinenstift erteilte, zunehmend als belastend.
In der ängstlichen Sorge um seine zarte körperliche und seelische Konstitution wurzelte auch Mörikes Neigung, sich in überschaubare, abgeschlossene Zufluchtsräume zurückzuziehen, die Schutz und Geborgenheit verhießen. Aus diesem eigentümlichen Verhaltensmuster entwickelte der Dichter wiederum einen zentralen Motivkomplex seines Werkes. In dem Gedicht Erinnerung besinnt sich der Sprecher auf ein solches Refugium aus Kinderzeiten: Es sind die „großen Kufen“ in „Nachbar Büttnermeisters Höfchen“, in denen er sich an Sonntagnachmittagen mit seiner Freundin behaglich niederzulassen pflegte (1.1, S. 14). Als Seminarist baute Mörike sich an einem Felsen in der Nähe des Städtchens Urach eine Hütte, in der er ungestört sein konnte. 1822 erwähnt er dieses „Sorgenfrey“ in einem Brief an Waiblinger, in dem er seine „abgeschiedene Zelle“ mit einem Novalis-Zitat zum Lob der Einsamkeit in Verbindung bringt (10, S. 29), und aus derselben Zeit stammt das Gedicht In der Hütte am Berg, dessen erste Strophen folgendermaßen lauten:
„Was ich lieb und was ich bitte
Gönnen mir die Menschen nicht,
Darum, kleine, moos’ge Hütte,
Meid ich so des Tages Licht.
Bin herauf zu dir gekommen,
Wo ich oft der Welt vergaß
Gerne sinnend bei dem frommen
Roten Kerzenschimmer saß.
Weil ich drunten mich verliere
In dem Treiben bang und hohl,
Schließe dich, du kleine Türe
Und mir werde wieder wohl!“–5
Dass es starke regressive Tendenzen waren, die den Rückzug ins Enge, Vertraute und Geborgene so verlockend erscheinen ließen, tritt hier sehr deutlich zutage. Ist die Tür erst einmal geschlossen, legen sich die Wände der Hütte wie eine zweite schützende Haut um das verletzliche Individuum und halten all jene Mächte fern, die es als feindselig und bedrängend erfährt. Dabei korrespondiert diese geschlossene Sphäre, wie der Fortgang des Gedichts bestätigt, dem seelischen Innenraum des Sprechers: In der Abkehr von der „Welt“ da draußen mit ihrem störenden grellen Licht und ihrem verworrenen „Treiben“ wendet sich das Ich der träumerischen Innerlichkeit und dem Reich der Phantasie zu, das sich im milden Kerzenschimmer auftut.
Dieselbe Grundfigur begegnet in Mörikes Roman, wo der junge Theobald Nolten unter dem Dach des Hauses seines Ziehvaters eine Zufluchtsstätte findet: „Dort nämlich ist ein Verschlag von Brettern, schmal und niedrig, wo mir die Sonne immer einen besondern Glanz, überhaupt ein ganz ander Wesen zu haben schien, auch konnte ich völlig Nacht machen, und (dieß war die höchste Lust), während außen heller Tag, eine Kerze anzünden, die ich mir heimlich zu verschaffen und wohl zu verstecken wußte“ (3, S. 278). In Mörikes Idyllendichtung werden wir die Vorliebe für abgeschiedene Bezirke der Ruhe und der Selbstbesinnung ebenfalls antreffen. Verständlicherweise wurden solche Plätze vor allem dann wichtig, wenn äußere Herausforderungen und eine aufgewühlte seelische Verfassung ihm zu schaffen machten. So zog er sich im Sommer 1824, als ihn die Affäre mit Maria Meyer belastete, in Stuttgart am liebsten in ein einsames Gartenhäuschen zurück, „eine wahre moderne Eremitage“, wo er die Stille und die „freundliche Dämmerung“ genoss (10, S. 56f.) und seinen Umgang fast ganz auf seine beiden Schwestern beschränkte. Auch von der Ehe mit Luise Rau erhoffte er sich eine heilsame Begrenzung seines Lebenskreises, wie er der Verlobten anvertraute:
Schon oft hab ich gedacht: von dem Augenblicke wo wir über die eigene Hausschwelle treten, fängt die Beschränkung meines Daseyns an, die mir erst die wahre Freiheit geben soll und indem mein Horizont sich zu verengen scheint wird er sich vielmehr erweitern, die Spannkraft der Seele wie sie bisher zerstreut bald da bald dorthin gezogen und vergeudet worden war, ist nun auf Einen Punkt gewiesen, sie wirkt nur jederzeit auf das hin was zunächst liegt und mit der Strenge mannigfaltigerer Pflichten wächst die Aussicht ins Leben […]. (11, S. 167)
In späteren Jahren wollte er sich mit ähnlichen Überlegungen sogar Krankheit und Bettlägerigkeit schmackhaft machen: „Das Fleckchen Sonne, das dem Vogel die Ecke seines Käfigs wärmt, wer weiß, obs ihn nicht inniger ergötzt als es die Fülle in der Freiheit draußen thäte“ (15, S. 229). Übrigens konnte er sich bei seinem Lob der Zurückgezogenheit einmal mehr auf antike Vorbilder berufen, etwa auf Epikur und Horaz, aber auch auf Ovid: Unter einer Zeichnung, die das Schulhaus und die Kirche des entlegenen Dörfchens Ochsenwang zeigt, notierte er in lateinischer Sprache eine Anspielung auf den Vers „bene qui latuit bene vixit“ („Gut lebt, wer gut im Verborgenen bleibt“).6
Es gibt eine ganze Reihe von Gedichten, die gewisse Aspekte des von Mörike entwickelten diätetischen Konzepts und seine Strategien des Rückzugs und der Verweigerung reflektieren. Auf humoristische Weise behandelt Die Visite das Thema des menschenscheuen Poeten: Als virtuoser Verwandlungskünstler wehrt das Dichter-Ich die zudringlichen Philister, die seine Ruhe stören, erfolgreich ab, bis schließlich wenigstens eine Art Waffenstillstand zwischen den beiden Parteien zustande kommt. Eine solche Kunst des Sich-Entziehens war Mörike bestens vertraut, wenngleich er von der märchenhaften Leichtigkeit, mit der sie hier geübt wird, nur träumen konnte. Das Gedicht Trost führt dagegen im Tonfall existenziellen Ernstes vor, wie der lyrische Sprecher angesichts der Widrigkeiten des Lebens in der Besinnung auf sich selbst, auf die unangreifbare innere Einheit seines Ich, Mut und Fassung gewinnt. Etwas detaillierter sei ein weiteres förmliches Programmgedicht der Abschließung und der Introversion analysiert, das aus gutem Grund zu Mörikes berühmtesten Werken zählt. Es entstand wie die oben zitierte zweite Strophe von Gebet im Jahre 1832:
Verborgenheit
Laß, o Welt, o laß mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben,
Laßt dieß Herz alleine haben
Seine Wonne, seine Pein!
Was ich traure weiß ich nicht,
Es ist unbekanntes Wehe;
Immerdar durch Thränen sehe
Ich der Sonne liebes Licht.
Oft bin ich mir kaum bewußt,
Und die helle Freude zücket
Durch die Schwere, so mich drücket
Wonniglich in meiner Brust.
Laß, o Welt, o laß mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben,
Laßt dieß Herz alleine haben
Seine Wonne, seine Pein!
(1.1, S. 145)
Die beherrschende Geste der Abwehr, der Abgrenzung macht sich schon im formalen Aufbau geltend, denn die identischen Strophen 1 und 4 bilden einen Rahmen, der das Gedicht markant nach außen abschließt. Und nur in diesen Strophen wendet sich der Sprecher an die anonyme „Welt“, während die beiden Binnenstrophen ganz seinem inneren seelischen Leben gewidmet sind. Die Rahmenstruktur, die auf einer anderen Ebene im Schema des umgreifenden Reims wiederkehrt, gibt überdies bereits zu erkennen, dass hier keine Entwicklung geschildert, sondern ein statischer Zustand, eine bestimmte Gemütsverfassung des Ich vorgeführt wird.
Gleich in der Eingangszeile gewinnt der Gestus der Weltabsage eine ungemein suggestive sprachliche Gestalt: „Laß, o Welt, o laß mich sein!“ Die Wiederholungen, die l-Alliteration, die in den beiden folgenden Versen nachhallt, und die strikte Beschränkung auf einsilbige Wörter intensivieren den eindringlichen Appell und verleihen ihm geradezu den Charakter einer magischen Beschwörung, einer Zauberformel. Fast könnte man auch meinen, hier spreche ein christlicher Eremit, der sein Sinnen und Trachten einzig auf Gott richtet, und es ist in der Tat denkbar, dass der Kult der Innerlichkeit, von dem Verborgenheit Zeugnis ablegt, von typischen Haltungen einer pietistisch gefärbten Frömmigkeit beeinflusst wurde. Sie erscheinen im Gedicht jedoch in einer völlig säkularisierten Form, denn statt der religiösen Besinnung strebt Mörikes lyrisches Ich lediglich ein reines Für-sich-Sein an, in dem es ungestört verharren möchte. Wie schon in dem Gedicht In der Hütte am Berg wird alles, was jenseits davon liegt, also insbesondere die Sphäre der sozialen Beziehungen, mit dem pauschalen Begriff „Welt“ umschrieben. Diese Welt, die immerhin „Liebesgaben“ zu bieten hat, ist in Verborgenheit freilich keineswegs negativ konnotiert, und ebenso wenig stellt die Innenwelt des Sprechers – sein „Herz“, das ja „Wonne“ und „Pein“ gleichermaßen kennt – einen Bezirk ungetrübten Glücks dar. Dennoch wünscht das Ich ganz in dieser Innerlichkeit aufzugehen und sich die Außenwelt vom Leibe zu halten, die es mit ihren Verheißungen aus sich herauszulocken trachtet. Von einer kämpferischen Opposition, von Polemik oder Gesellschaftskritik kann dabei aber nicht im Entferntesten die Rede sein: Der Sprecher der Verse proklamiert einen bescheidenen, stillen Rückzug in die geheimen Tiefen seines Gefühlslebens.
Die Ambivalenz von Wonne und Pein wird in den Binnenstrophen weiter differenziert. Die Verfassung des sprechenden Ich ist durch eine unbestimmte, offenbar grundlose Trauer und drückende Schwere, kurz: durch tiefe Melancholie gekennzeichnet. Gerade diese Melancholie wird jedoch immer wieder zur Quelle unvermuteter Glückserfahrungen, die ihre schwermütige Dämmerung wie ein Blitz „wonniglich“ durchdringen und erleuchten. Eine solche Auffassung der Melancholie hat Tradition – man denke nur an Albrecht Dürers bekannten Kupferstich Melencolia I, der den titelgebenden Gemütszustand in einer versonnen dasitzenden Frauengestalt personifiziert, die zur Überraschung des Betrachters mit Flügeln ausgestattet ist: Der plötzliche Aufschwung, die Loslösung von der Erdenschwere gehört zu den genuinen Möglichkeiten des Melancholikers. Für Mörike selbst war die gemischte Empfindung von Gedrücktheit und unvermittelt ‚aufzuckender‘ Freudigkeit eine der vertrautesten Stimmungslagen überhaupt, die ihm einen eigentümlichen Genuss verschaffte. Auf eine Variante dieser wehmütigen Heiterkeit, die in seinen Briefen und Dichtungen geradezu den Rang eines Leitmotivs hat, sind wir bereits im Zusammenhang mit seinen sehnsüchtigen Erinnerungen an die Kindheit in Ludwigsburg gestoßen. Man findet auch zahlreiche Briefstellen, die fast wie Paraphrasen des Gedichts Verborgenheit wirken. Dem Jugendfreund Waiblinger schilderte Mörike zum Beispiel seine Gefühle angesichts eines regnerischen Sommertages, der „naß u. melankolisch angerückt kommt“: „das Leben selber scheint, wie das Grün von Bergen u. Bäumen auf diesem sanften aschgrauen Grund erst recht betrachtenswerth u. innig“, und dem Schreiber ist dabei „wohl“ zumute, „halb weinerlich u. lustig“ (10, S. 57). Einige weitere Belege seien hier unkommentiert aneinandergereiht: „mir war selten so wohl u. doch etwas traurig zu Muth“ (S. 42); „voll wehmüthig seeliger Verwirrung“ (S. 174); „Mir ist wohl und weh“ (11, S. 47); „meine Stimmung ist ein Gemisch von Wehmuth und Zufriedenheit“ (S. 56); „wehmüthig-freudige Stimmungen“ (S. 171); „ein Bliz von Freude und Wehmuth“ (S. 176); „mit Wehmuth und mit Heiterkeit zugleich“ (S. 315).
Die Vorliebe für derartige Hell-Dunkel-Schattierungen des Gefühls übertrug Mörike auch auf die Figuren seines Romans. „Ich unterhielt zu Zeiten eine unbestimmte Wehmuth bei mir, welche der Freude verwandt ist“, erzählt Theobald Nolten im Rückblick auf seine Jugend (3, S. 278), und seine Schwester Adelheid scheint Mörike ebenfalls aus dem Herzen zu sprechen:
„Indem ich“, hob sie nach einer Weile an, „wohl gute Lust hätte, recht wehmüthig zu seyn, wie dieser graue Tag es selber ist, so rührt sich doch fast wider meinen Willen ein wunderlicher Jubel in einem kleinen feinen Winkel meines Innersten, eine Freudigkeit, deren Grund mir nicht einfällt. Es ist am Ende doch nur die verkehrte Wirkung dieses melancholischen Herbstanblicks, welche sich von Kindheit an gar oft bei mir gezeigt hat. Mir kommt es vor, an solchen trauerfarbnen Tagen werde die Seele am meisten ihrer selbst bewußt; es wandelt sie ein Heimweh an, sie weiß nicht wornach, und sie bekommt plötzlich wieder einen Schwung zur Fröhlichkeit, sie kann nicht sagen woher […].“ (S. 191)
Auch der Schauspieler Larkens weiß, dass die „heimlich melancholische Beschränkung“ nichts anderes ist als eine „graue Folie jener unerklärbar tiefen Herzensfreudigkeit, die so recht aus dem innigen Gefühl unseres Selbst hervorquillt“ (S. 229). Vielfach bilden Zeiträume des Zwielichts und des Übergangs das atmosphärisch passende äußere Pendant solcher Stimmungen – etwa der Herbst oder die Dämmerung, die in Mörikes Lyrik nicht zufällig eine herausragende Rolle unter den Tageszeiten spielt. Und als typische Stilfigur ist der gemischten Empfindung das Oxymoron zugeordnet, das zwei einander eigentlich ausschließende Begriffe zusammenzwingt: „wehmüthig-freudig“ gibt ein Beispiel dafür ab oder, als äußerste Zuspitzung, die Formulierung „Schmerzensglück“ aus dem Gedicht Früh im Wagen, dessen Szenerie wiederum in das zweifelhafte Licht der Morgendämmerung getaucht ist (1.1, S. 146).
Gleichwohl wäre es mindestens in einer Hinsicht voreilig, das lyrische Ich in Verborgenheit ohne weiteres mit dem Autor Mörike zu identifizieren. Denn so diffus die hier evozierte Gefühlslage als solche auch sein mag, ihre Schilderung im Gedicht zeichnet sich jedenfalls durch bestechende Klarheit und die außerordentliche Präzision von Sprache, lyrischer Form und poetischer Motivik aus. Verharrt der Sprecher der Verse, seiner selbst „kaum bewußt“, in einem dämmernden Seelenzustand, ohne ihn reflektierend zu durchdringen, so beweist dagegen ihr Verfasser einen äußerst wachen Kunstverstand und eine souveräne Meisterschaft des Gestaltens – dieses Gedicht ist gewiss kein Produkt einer vagen Träumerei! Und seine Komplexität tritt noch eindrucksvoller hervor, wenn wir die bislang ausgesparte poetologische Dimension ins Auge fassen. Verborgenheit scheint nämlich auch den Vorgang der Inspiration zu thematisieren, die sich bei Mörike gleichfalls durch blitzartige Plötzlichkeit im Verein mit freudiger Erregung auszeichnet und deren unverfügbaren Augenblick die dritte Strophe im poetischen Bild festhält: Wo der Mensch ganz in sich selbst zurückkehrt, um in die träumerischen Tiefenschichten seiner Seele einzutauchen, kann sich unvermutet der schöpferische Funke entzünden. Auch in diesem Punkt führt Mörike eine ehrwürdige Tradition fort, denn die Verknüpfung von Melancholie und Schöpfertum stellt seit der Antike und der Renaissance einen Topos der europäischen Geistesgeschichte dar, der gerade um 1800 wieder Hochkonjunktur hatte. Viele große Künstler des Abendlandes galten als Melancholiker, und noch Goethe schrieb die Verse: „Zart Gedicht, wie Regenbogen,/Wird nur auf dunklen Grund gezogen;/Darum behagt dem Dichtergenie/Das Element der Melancholie.“7 Dass Mörike dieser Gedanke nicht fremd war, wird die Analyse seiner Mozart-Novelle bestätigen. Verborgenheit lässt also nicht nur eine bestimmte seelische Verfassung anschaulich werden, sondern bestimmt zugleich auch die Bedingungen der künstlerischen Inspiration.
Tatsächlich erklärte Mörike die Abkehr von der geschäftigen „Welt“ und den Rückzug auf sich selbst zu wichtigen Voraussetzungen seines poetischen Schaffens. Die Vermutung, dass er damit nur aus der Not seiner gesteigerten Empfindlichkeit und seiner diätetischen Schutzmaßnahmen eine Tugend machte, kann man freilich nicht ganz abweisen, etwa wenn er in einem Brief an Luise Rau wortreich den eng umschränkten „Gesichtskreis einer wirtemb. Pfarrey“ rühmt:
Ich will, wenn ich einer Luftveränderung für meine Gehirnkammer bedarf, aus einer kleinen Reise nach einer Ansehnlichen Stadt, mehr ziehen und meine poetische Musterkarte stärker bereichern als der verwöhnte Städter der mitten auf dem Tummelplaze des gestalt- und farbreichsten Lebens wohnt; – eben die Seltenheit pikanter Erscheinungen schärft den Blick der sie zu ergreifen und zu steigern hat. Wenige aber starke Eindrücke von außen, – ihre Verarbeitung muß im ruhigen bescheidenen Winkel geschehen; auf dem ruhigen Hintergrund wird sich ihr Kolorit erhöhen und die Hauptsache muß doch aus der Tiefe des eigenen Wesens kommen. […] Überhaupt lebe ich der festen Überzeugung, bey einem Schriftsteller der auch nur etwas mehr ist als z.B. Wilh. Hauff[…] verhält sich die Notwendigkeit äußerer Anregung (und lebender Stoffe des Tages) zur Bedingung des eigenen Ideenfonds wie 4 zu 80. Wer der lezteren Summe gewiß ist, der findet die erstere auch als Dorfpfarrer […]. Wer die 80 nicht besizt der muß sie sich aus der andern Summe ergänzen und sich seine Copien aus Theezirkeln, Gesellschaften us.w. holen, den feinen Ton studieren, hinter jedem Stutzer und seiner Cravatte den Satyr spielen und das dann als Poesie drucken lassen. […] eine Iphigenia schreibt sich gar wohl ohne das, wenn man zuvor ein J. Wolfgang v. Göthe […]. (11, S. 96f.).
Das klingt verdächtig nach dem angestrengten Versuch einer Selbsttröstung und -rechtfertigung, und es war gewiss kein glücklicher Einfall Mörikes, sich hier ausgerechnet auf den welt- und erfahrungshungrigen Goethe zu berufen. Wenn man aber den ins Allgemeine gesteigerten Anspruch dieser Thesen einmal beiseite lässt und sie lediglich als Umschreibung von Mörikes eigener Haltung liest, ist zu konstatieren, dass er seinen Maximen zeitlebens treu blieb. 1838 bekräftigte er sie noch einmal gegenüber Hermann Kurz, der sich für eine Weile in der Residenzstadt aufgehalten hatte: „Ein Leben wie Du es in Stuttgart führtest, das ist ein Zustand der fliegenden Hitzen, wo man bunte Liköre statt ächten Weins trinkt. Ein schönes Werk von innen heraus zu bilden, es zu sättigen mit unsern eigensten Kräften, dazu bedarfs – weißt Du so gut als ich – vor allem Ruhe u. einer Existenz die uns erlaubt, die Stimmung abzuwarten“ (12, S. 202).
Die Bindung seiner dichterischen Produktivität an das Leben in der „Verborgenheit“, das eine sorgfältige diätetische Regulierung der äußeren Anregungen und Einflüsse nach dem Prinzip des heilsamen Maßes gestattete, prägte Mörikes gesamte innere Biographie. Sie erklärt auch die bemerkenswerte Entschiedenheit, mit der er zumindest seit den dreißiger Jahren seine eigentümliche Daseinsweise durchhielt und verteidigte. Um eventuellen Störfaktoren zu begegnen, entwickelte er eine Art passiver Resistenz, deren wichtigste Strategien der Rückzug, das Ausweichen und das Schweigen waren – und natürlich die Kränklichkeit, die es ihm immer wieder erlaubte, sich unbequemen Anforderungen zu verweigern. Die von ihm selbst gebrauchte Formel von der „vis inertiä“ (13, S. 112), der eigentümlichen Beharrungskraft des Nichtstuns, bezeichnet seine wunderliche Begabung in diesem Punkt äußerst prägnant. Zu Hilfe kamen ihm dabei allerdings – neben dem unschätzbaren lebenspraktischen Beistand der Mutter und der Schwester Klara – die Opferbereitschaft seiner Freunde und die Großzügigkeit der Vorgesetzten. Die kirchlichen Amtsträger bewiesen im Umgang mit dem schwierigen Vikar und Pfarrer eine erstaunliche Langmut, Wilhelm Hartlaub borgte ihm Predigten und half finanziell aus, Ludwig Bauer bemühte sich um berufliche Förderung und materielle Unterstützung, Johannes Mährlen und Hermann Hardegg setzten sich selbstlos für ihn ein, und in Mörikes Stuttgarter Zeit übernahm Karl Wolff, der Rektor des Katharinenstifts, ein ums andere Mal bereitwillig die Unterrichtsstunden seines unpässlichen Kollegen. Der Druck und die Einschränkungen, denen Mörike sich fast unablässig ausgesetzt fühlte, resultierten vorwiegend aus strukturellen Gegebenheiten und Notwendigkeiten, denen er sich kaum entziehen konnte. Mit den Menschen in seinem persönlichen Umfeld hat er dagegen fast durchweg großes Glück gehabt.