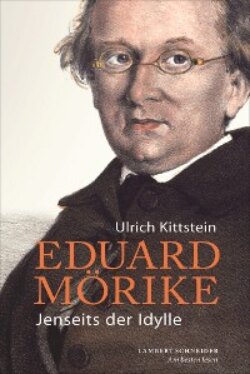Читать книгу Eduard Mörike - Ulrich Kittstein - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. GRUNDZÜGE DES LYRISCHEN SCHAFFENS Proteus Mörike
ОглавлениеEduard Mörikes Gedichtwerk ist nicht gerade schmal, aber doch von recht überschaubaren Dimensionen: Es umfasst rund siebenhundert Texte, von denen zu seinen Lebzeiten nicht einmal die Hälfte publiziert wurde. Will man dieses Oeuvre jedoch in seiner Gesamtheit charakterisieren und damit gewissermaßen das Profil des Lyrikers Mörike zeichnen, so stößt man auf erhebliche Probleme. Jost Schillemeit umschreibt sie folgendermaßen:
Mörikes Lyrik scheint einer stilkritisch orientierten Literaturwissenschaft größere Schwierigkeiten zu bereiten als das Werk der meisten anderen deutschen Lyriker gleichen Ranges. Das Schwierige, vielleicht Unmögliche ist nicht so sehr die Interpretation des einzelnen Gedichts – die eigentlichen Schwierigkeiten beginnen vielmehr, wenn man nach durchgehenden Merkmalen sucht, um das zu erfassen, was man Mörikes lyrischen Stil nennen könnte. Hält man Ausschau nach solch durchgehenden Zügen, so erkennt man zwar Gemeinsamkeiten zwischen einzelnen Gedichten, es lassen sich Reihen bilden, aber sie brechen bald ab und umfassen kaum je einen nennenswerten Teil des Gesamtwerkes.1
Tatsächlich unterscheidet sich Mörike von anderen großen Lyrikern des 19. Jahrhunderts wie Clemens Brentano, Joseph von Eichendorff, Theodor Storm, Conrad Ferdinand Meyer oder Stefan George durch den fast schon irritierenden Facettenreichtum seines Werkes, das keinen bestimmten, eindeutig wiedererkennbaren ‚Ton‘ aufweist. Der Dichter Mörike ist ein Proteus, dem es Vergnügen bereitet, unablässig in neuen Gestalten zu erscheinen; auch im Spiel mit den mannigfachen Formen, Stilen und Redeweisen der Lyrik manifestiert sich seine ausgeprägte Neigung zum Maskentreiben und zur Verstellung.
Die Bemühungen, in dieser überbordenden Fülle doch noch ein geheimes Gesetz zu entdecken, reichen weit zurück und zielen meist darauf ab, ein Entwicklungsprinzip auszumachen, das dem Werdegang des Lyrikers Mörike als innere Logik zugrunde liegt. Schon 1839 glaubte Friedrich Theodor Vischer, den Freund auf eine Linie festlegen zu können, die aus dem Umkreis der „nebelhafte[n] Romantik“ in die helle Sphäre der „Kunstpoësie, der klassisch veredelten Form, der reinen Idealität“ führe2: Mörike habe von früh an eine Vorliebe für das Phantastische und Märchenhafte und für die Einfachheit des Volkslieds besessen, inzwischen aber den „Uebergang […] aus der Dämmerung volksthümlicher Naivetät in das […] Reich des bewußten Geistes, in das helle Licht der Besonnenheit und künstlerischen Weisheit“ vollzogen3 – in Vischers Augen eindeutig ein Fortschritt, den er unter anderem mit Mörikes Hinwendung zu antiken Mustern seit der Mitte der dreißiger Jahre belegt.
Einige Überlegungen der wissenschaftlichen Forschung stehen dem von Vischer skizzierten Modell gar nicht so fern. Heinz Schlaffer beispielsweise rekonstruiert in Mörikes Gedichtwerk eine Bewegung von der anfänglichen subjektiven Standortgebundenheit des lyrischen Sprechers, mit der sich der Dichter bereits von romantischen Einheits- und Verschmelzungsphantasien abkehre, hin zum poetischen Entwurf begrenzter, aber in sich geordneter Räume4, und Dagmar Barnouw beobachtet einen Wandel von der Selbstaussprache des fühlenden Subjekts, das lediglich Fragmente der äußeren Realität in seinen Vorstellungskreis ziehe, zur vollendeten ‚entzückten Anschauung‘ konkreter Wirklichkeit, die erst durch die Rede des Poeten in ihrer wahren Gesetzlichkeit sichtbar werde.5 Beide Arbeiten kranken allerdings daran, dass sie ihre Thesen auf eine allzu schmale Textbasis stützen und zu einem Schematismus neigen, der die Vielgestaltigkeit von Mörikes Lyrik eher verdeckt als erhellt. Eine äußerst materialreiche und differenzierte Studie hat dagegen Renate von Heydebrand vorgelegt, die anhand einer Fülle von Einzelanalysen Mörikes Weg von der monologischen ‚einsamen‘ Lyrik über die erzählende Darstellung zur dialogisch ausgerichteten gesellig-gesprächigen Mitteilung nachzeichnet.6 Diese Einteilung kann zumindest der vorläufigen Orientierung auf einem so schwer überschaubaren Feld dienen, auch wenn sie lediglich Tendenzen erfasst, die sich über die Jahre oder Jahrzehnte hin mehr oder weniger deutlich ausgeprägt haben, und nicht mit einer klaren Phasengliederung der Entwicklung des Autors verwechselt werden darf.
Mit der Frage nach Kontinuität und Wandel in der Geschichte von Mörikes Werk werden wir uns noch mehrfach beschäftigen. Eine erste Annäherung an diesen Lyriker gelingt aber am besten über die allgemeine Feststellung, dass er ein außergewöhnliches Talent besaß, literarische Formen und Gattungen sehr unterschiedlicher Herkunft produktiv fortzuschreiben, womit er eindrucksvoll demonstrierte, wie sich schöpferische Originalität mit Traditionsbezogenheit verbinden lässt. Ein radikaler Neuerer war Mörike nämlich keineswegs; statt mit avantgardistischem Pathos den Bruch mit dem Herkommen zu proklamieren, zog er es vor, an die Gestaltungsmöglichkeiten anzuknüpfen, die ihm die Überlieferung zur Verfügung stellte. Und deren Reichtum war in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts immens. Das gilt schon für das Repertoire an metrischen und strophischen Formen, aus dem ein Dichter damals schöpfen konnte und dessen Bandbreite von den antiken Vers- und Strophenmaßen über die verschiedensten Liedstrophen bis zu den reimlosen freien Rhythmen reichte, denen Klopstock und der junge Goethe Eingang in die deutsche Literatur verschafft hatten. Die Schwerpunkte, die Mörike auf diesem Gebiet setzte, deuten bereits auf gewisse Aspekte seiner Poetik hin. Udo Pillokat formuliert den Sachverhalt treffend: „Mörike wählt Versmaße, die ihm eine maßvolle, mittlere Gestaltungsfreiheit gewähren“7, während er die Extreme für gewöhnlich meidet. So schrieb er nur selten in freien Versen: Zwei Stücke aus dem Peregrina-Zyklus und das ebenfalls in seinen jungen Jahren entstandene Gedicht Im Freien, das sich eng an Klopstock und Goethe anlehnt, sind hier zu nennen, während die freien Rhythmen in den späteren Werken An eine Äolsharfe und Erinna an Sappho durch die versteckte Paraphrase antiker metrischer Formeln schon wieder eine ganz eigentümliche Ausprägung erhalten.
Auf der anderen Seite hielt die Abneigung gegen jedes zur Schau getragene Virtuosentum Mörike von der Verwendung jener hochgradig artifiziellen Vers- und Strophenformen aus dem romanischen und orientalischen Raum zurück, die sich die Romantiker erschlossen hatten und in denen Poeten wie August von Platen oder Friedrich Rückert ihre Kunstfertigkeit zeigten. Das Gedicht Apostrophe persifliert allzu künstliche Reimgebilde, die bei dilettantischer Ausführung leicht ins Komische fallen, bezeugt durch seine kleine Vorbemerkung allerdings auch, dass Mörike „Rückerts geniale Formen“ sehr wohl von ihrer bloßen mechanischen Nachahmung zu unterscheiden wusste (1.1, S. 179). Terzinen, Sestinen oder Ghasele beispielsweise findet man in Mörikes Lyrik nicht. In den zwanziger und dreißiger Jahren bevorzugte er statt dessen relativ einfach gebaute vierzeilige Reimstrophen, die er vielfältig zu variieren verstand – Nächtliche Fahrt, 1823 geschrieben, liefert ein frühes Beispiel dafür. Die lockere madrigalische Form, die jambische Verse von wechselnder Länge und mit freier Reimstellung ohne regelmäßige Strophengliederung aneinanderfügt, kam ihm damals ebenfalls entgegen (Josephine, Peregrina IV etc.); vereinzelt finden sich auch trochäische Madrigale, zu denen das berühmte Frühlingsgedicht Er ist’s zählt. An komplexeren Formen fällt neben dem Sonett, auf das wir noch ausführlicher zu sprechen kommen werden, die achtzeilige Stanze ins Auge. Mörike benutzte sie in seiner Seminarzeit als feierliche Prunkform in den Gedichten Die Liebe zum Vaterlande und Auf Erlenmayers Tod, die für den Vortrag bei offiziellen Anlässen gedacht waren, griff aber auch später noch in Besuch in Urach und einem Gedicht des Peregrina-Zyklus auf sie zurück. Für manche Gedichte, darunter Balladen wie Der Feuerreiter, verwendete er überdies anspruchsvolle Strophenformen eigener Erfindung, die eine subtile Binnengliederung aufweisen.
Eine schlichtere metrische Gestalt verlieh der Dichter lyrischen Texten, die erzählenden oder reflektierenden Charakter haben und häufig in einem scheinbar kunstlosen Plauderton gehalten sind. Hier treffen wir oft reimlose trochäische Verse mit vier oder fünf Hebungen an, so in Abreise, An Karl Mayer, Erinnerung, Ländliche Kurzweil und An meinen Vetter; seltener liegen gereimte trochäische Vierheber vor wie in Der Petrefaktensammler oder Mit einem Teller wilder Kastanien. Unstrophisch gereihte, gleichmäßig gebaute jambische Reimverse gibt es etwa in Auf ein altes Bild und An Wilhelm Hartlaub. Für Gelegenheitsgedichte gebrauchte Mörike bisweilen den Blankvers, also den reimlosen jambischen Fünfheber – Beispiele sind Der Frau Generalin v. Varnbüler und In das Stammbuch von Theodor Buttersack (Nach seines Vaters Tod) –, und vereinzelt taucht bei ihm sogar der Knittelvers auf, der etwa in Erzengel Michaels Feder gut zu dem altertümlichen Legendencharakter des Werkes passt. Zu all dem kommen schließlich seit der Mitte der dreißiger Jahre noch die antiken Metren hinzu, denen wir in einem späteren Kapitel gesonderte Beachtung schenken werden.
Ein gutes Beispiel für Mörikes kreative Aneignung einer festgefügten, traditionsreichen lyrischen Form liefert seine Sonettdichtung. Das aus der italienischen Literatur des Spätmittelalters stammende Sonett hatte sich in Deutschland bereits im Barock großer Beliebtheit erfreut und war in jüngerer Zeit durch die Romantiker zu neuen Ehren gebracht worden. Dabei verpflichtete August Wilhelm Schlegel den Sonettdichter strikt auf den jambischen Fünfheber mit weiblicher Kadenz und auf das Reimschema a b b a | a b b a | c d e | c d e – Vorgaben, die schon Goethe in seinem Sonettzyklus von 180/08 als verbindlich anerkannte und die Mörike ebenfalls bis ins Detail beachtete. Die Herausforderung, eine solch strenge Form zu meistern und ihrem hohen Kunstanspruch gerecht zu werden, mag ihn gereizt haben; jedenfalls trägt seine Verwendung des Sonetts – wie bei Goethe – alle Züge eines Experiments, das die Möglichkeiten der Gattung auslotet.8 So drängen sich die meisten Sonette Mörikes in einem eng begrenzten Zeitraum zusammen: Nachdem 1828 neben dem Peregrina-Sonett mit Antike Poesie, Eberhard Wächter und Seltsamer Traum drei Gedichte entstanden waren, die auf die eine oder andere Weise die Kunst selbst zum Thema machen, schrieb er im Frühjahr 1830 in rascher Folge sieben Sonette für seine Verlobte Luise Rau. Auch die Verknüpfung des Sonetts mit der Liebesthematik hat eine Tradition, die bis zu den Tagen Dantes und Petrarcas zurückreicht, und inhaltlich und sprachlich passte Mörike die Gedichte für Luise der Würde der Sonettform an, indem er einen besonders erlesenen Stil wählte und das Liebeserlebnis zu einer quasi-religiösen Ausnahmeerfahrung verklärte. Nach dem Abschluss dieser kurzen produktiven Phase scheint sein Interesse am Sonett erschöpft gewesen zu sein; das Experiment war beendet. Jedenfalls spielten Sonette in seinem Schaffen fortan praktisch keine Rolle mehr. Eine der Ausnahmen ist allerdings bemerkenswert: In dem Gedicht Zwei dichterischen Schwestern aus dem Jahre 1845 wird die Sonettform selbstreflexiv und zugleich zum Gegenstand des geselligen Spiels, indem der Verfasser die Reimklänge in sämtlichen Versen durch Gedankenstriche ersetzt und damit den Leser zwingt, das Fehlende nach dem bekannten Schema selbständig zu ergänzen.
Hinter der metrischen und strophischen Vielfalt steht bei Mörike die der ‚Töne‘, der lyrischen Redestile, nicht zurück. Heydebrand unterscheidet den Volkston, den Gesellschaftston und den antikischen Ton, aber diese Rubrizierung vermittelt nur einen sehr vagen Eindruck von der Fülle der Möglichkeiten, die Mörike nutzte und variierte. Seine Gedichte kennen die Satire und den feinsinnigen Humor ebenso wie die burleske Komik, der Ton empfindsamer Gefühlsinnigkeit steht neben der augenzwinkernden erotischen Anspielung, der gesellige Plauderton neben der religiösen Ergriffenheit, schwärmerische Naturseligkeit neben gelassener Schilderung und Reflexion – ganz zu schweigen von mancherlei Mischungen und subtil eingesetzten Brechungen dieser verschiedenen Sprachgesten. Auffällig ist indes auch hier das Fehlen der Extreme, denn Mörike steigert das Pathos der Liebe wie des Leidens nie über ein bestimmtes Maß, schreibt aber andererseits auch keine nüchtern belehrende oder spruchhafte Gedankenlyrik. Sein Reich ist die fein differenzierte, vielfältig abgestufte Mittellage.
Neben manchen Werken mit idyllischen Zügen passten die volksliedhaften Gedichte, die seit 1828 breiten Raum in seinem lyrischen Schaffen einnahmen, seit jeher am besten in das populäre Bild vom schlichten, gemütvollen Pfarrer-Poeten. Doch auch dieser Einschätzung liegt ein Missverständnis zugrunde, weil Mörike den Volkston ebenso kunstbewusst handhabte wie sämtliche anderen oben genannten Stile. Schon im Sturm und Drang und in der Romantik waren es hochgebildete Autoren, die sich für Volkslieder interessierten und aus ihnen neue lyrische Ausdrucksformen gewannen; ihre Dichtung im Ton des Volkslieds war von Anfang an eine Spielart der modernen Kunstpoesie. Dass es sich bei Mörike nicht anders verhielt, führt uns eine Anekdote aus dem Jahre 1837 vor Augen. Seinem Freund Hartlaub berichtete er damals von einem Erlebnis, das er eines schönen Novembermorgens auf einem Spaziergang in der Nähe von Cleversulzbach gehabt habe:
Auf einmal höre ich Mädchengesang, mehrere Stimmen, vom Städtchen her, und ich bleibe stehen. Es dauert kurze Zeit, so kommen ihrer drei hinter dem Vorsprung jener hohen Wand herum, an der Du mit Konstanze schon vorübergingst. Die Eine, die Schlankste des Kleeblatts lief in der Mitte, u. sang besonders klar und keck im rüstigen Daherschreiten, die andern wenigstens nicht falsch. Die Melodie, schön, eigenthümlich was man nur sagen kann. Vom Text verstand ich nur von Zeit zu Zeit ein Wort: „Wir Schwestern – wir schönen“ – dieß kehrte immer wieder. Endlich hörten sie auf. Im Heimgehn sann ich nach, wie ich den Text am schicklichsten bekomme. Und sieh! in weniger als 10. Minuten hatte ich ihn. Ich gehe nemlich durch den Garten und finde die ledige Johanne Bort, die uns gewöhnlich arbeitet, mit Schoren beschäftigt. „Hanne! kann sie nicht ein Lied – es kommen die und die Worte drin vor.“ Sie besann sich ein wenig „Ja wohl kann ichs, Herr Pfarr.“ „So sag Sies her! Nur ohne Anstand.“ (12, S. 138)
Im Anschluss präsentiert Mörike den glücklichen Fund, ein vierstrophiges Gedicht, das mit dem Vers „Wir Schwestern zwei, wir schönen“ beginnt.9 Die hübsche Geschichte aus dem Leben des einfachen, sangesfreudigen Landvolkes hat allerdings einen Haken – sie ist nämlich frei erfunden. Am Ende des Briefes deckt Mörike die Karten auf: „Was aber das Liedchen von vorhin betrifft da hab ich Dir e. kleinen Bären aufgebunden. Es ist von mir und hat sich neulich Morgens im Bett unmittelbar nach dem Erwachen wie von selbst gemacht. Ich wollte nur, daß Du es unbefangen lesen sollst (was nun geschehen ist) und mir dann schreiben ob es den Eindruck eines Volkslieds auf Dich machte, oder nur halb oder gar nicht“ (S. 139). Und um ganz sicherzugehen, ließ er es nicht bei diesem einen Versuch bewenden, sondern veranstaltete ein paar Wochen später dieselbe Probe noch einmal mit Friedrich Theodor Vischer.10 Während Hartlaub bei der Lektüre der Verse schon früh Verdacht schöpfte11, durchschaute Vischer die Irreführung erst bei der letzten Strophe, deren ironische, desillusionierende Wendung mit ihrem „frappierenden Effekt“ die „Kunstpoesie“ erkennen lasse.12 Der Volkston ist also nichts anderes als eines der poetischen Register, über die Mörike verfügte, eine mit Überlegung gewählte Sprachmaske, deren Wirkung sogar experimentell getestet werden konnte. ‚Naiv‘ wird man das nicht mehr nennen wollen.
Werfen wir schließlich noch einen Blick auf die durch ihre Gegenstände oder ihre strukturellen Darbietungsformen bestimmten Gattungen und Genres, die in Mörikes Lyrik dominieren. Die Themen seiner Gedichte erscheinen, wenn man sie lediglich schlagwortartig benennt, durchweg konventionell. Neben Natur und Liebe, die eindeutige Schwerpunkte bilden, ist die Bedeutung religiöser Sujets nicht zu unterschätzen. Man findet Scherzgedichte und Parodien in vielen Spielarten und eine Fülle von Gelegenheitsgedichten an einzelne Personen, die sich vor allem in Mörikes späteren Jahren häuften und ihren Platz in seinem unmittelbaren zwischenmenschlichen Umgang, im privaten oder halb-öffentlichen geselligen Verkehr hatten. Epigramme und Episteln, also Briefgedichte, verdanken sich Anregungen aus der antiken Literatur. Auffallen könnte lediglich, dass die in der „Schwäbischen Romantik“ so beliebte Gattung der Ballade bei Mörike keine überragende Rolle spielte. Von seinen wenigen Balladen gehören die meisten in die zwanziger und dreißiger Jahre. Zu nennen sind vor allem Der Feuerreiter, Die schlimme Greth und der Königssohn, Die traurige Krönung, Die Geister am Mummelsee, der kleine Zyklus Schiffer- und Nixen-Märchen sowie Schön-Rohtraut, und mit Des Schloßküpers Geister zu Tübingen ist auch die Variante der komischen Ballade vertreten. Vielleicht hielt sich Mörike auf diesem Feld deshalb zurück, weil die Ballade bei Dichtern wie Uhland eng mit historischen Stoffen verbunden war, vor deren Verarbeitung er sich scheute. Tatsächlich sind die eben aufgeführten Werke samt und sonders im Reich des Phantastischen oder Märchenhaften angesiedelt, und ausgerechnet Der Schatten, ein Nachzügler von 1855, der noch am ehesten von einer (pseudo-)historischen Atmosphäre geprägt ist, muss wohl als die schwächste aller Mörike-Balladen gelten. Die beschränkte Anzahl der Texte sollte freilich nicht dazu verleiten, diesen Bereich seines Schaffens gering zu schätzen. Der Feuerreiter beispielsweise, mit dem wir uns an anderer Stelle eingehend befassen werden, zählt zu den faszinierendsten Balladen der deutschen Literatur.
Eine Vorliebe zeigte Mörike für Rollengedichte, die bestimmten, meist durch Beruf oder Stand stark typisierten Figuren in den Mund gelegt sind. Das verlassene Mägdlein, Der Gärtner und Der Jäger sind einige Beispiele für dieses Genre, das einen weiteren Beleg für die Lust des Dichters an der Maskerade, am Rollenspiel liefert. Es zeigt überdies, dass der Lyriker Mörike nicht auf das sogenannte Erlebnisgedicht festgelegt werden kann, das den Leser durch die Suggestion einer unverstellten, gefühlsbetonten Ich-Aussprache leicht dazu verführt, die Sprechinstanz im Text mit dem realen, biographisch fassbaren Autor gleichzusetzen. Lange Zeit galt die Erlebnisdichtung, deren Idealbild man aus Goethes frühen Gedichten ableitete, in der Germanistik als Norm des Lyrischen schlechthin – eine Auffassung, die bis heute in dem Klischee fortlebt, das der Gattung Lyrik eine besonders ausgeprägte Subjektivität zuschreibt. Aber abgesehen davon, dass auch Erlebnisgedichte in Wirklichkeit kunstvoll gestaltete Gebilde sind, die keinen simplen Rückschluss auf die Psyche ihrer Schöpfer zulassen, stand Mörike, wie die gesamte Literatur des Biedermeier, noch in manchen Traditionen, die bis weit vor die Goethezeit zurückreichen und sich mit einem solchen verengten Lyrikverständnis gar nicht vereinbaren lassen. In seinen Gedichten werden nicht nur scheinbar spontane Empfindungen artikuliert, es wird auch oft – und mit den Jahren sogar in zunehmendem Maße – erzählt, beschrieben, räsoniert oder vertraulich und scherzhaft geplaudert. Die vielfältigen Gattungen, Stilebenen, Redeweisen und Sprecherrollen, mit denen Mörikes Lyrik aufwartet, müssen zunächst einmal als literarische Mittel aufgefasst werden, die der Dichter mit hohem Kunstverstand einsetzte. Das schließt natürlich nicht aus, dass in solchen Vermittlungen auch Themen gestaltet wurden, die ihn emotional stark berührten. Gerade die distanzschaffende Wirkung von Rollenfiktionen dürfte es ihm erlaubt haben, vieles auszusprechen, was sonst wohl ungesagt hätte bleiben müssen: erotische Sehnsüchte zum Beispiel oder Angstphantasien von Betrug, Trennung und Verlassenheit. Solche Bezüge zwischen dem Werk und dem Seelenleben des Dichters können aber nur mit äußerster Vorsicht und größter methodischer Behutsamkeit rekonstruiert werden. Ein Gedicht ist ein aus Sprachmaterial geformtes Artefakt und kein ungefiltertes Selbstbekenntnis seines Autors.
Mörikes Lyrik erwuchs aus der schöpferischen Aneignung von Traditionsbeständen, denen er immer neue Seiten abzugewinnen wusste – eine Begabung, die ihn vom bloßen Epigonentum unterscheidet. Mit welchen Augen er Dichter und literarische Strömungen der ferneren und näheren Vergangenheit betrachtete, illustriert ein 1851 entworfenes Konzept für Literaturvorlesungen, die er in Stuttgart zu halten gedachte: „Mein eigner Plan ist nemlich mehr ästhetisch als historisch und geht vorzüglich dahin, an Beispielen aus unsern Schriftstellern das Urtheil über das was schön und nicht schön ist zu bilden u. zu schärfen, gewiße unächte Erscheinungen der neuern Zeit, welche das große Publikum begünstigt, zu bekämpfen pp.“ (16, S. 51). Und selbst als er auf den Gedanken verfiel, in diesen Vorträgen neben deutschsprachigen Autoren auch Dichter des griechischen und römischen Altertums zu behandeln, hob er hervor, dass es ihm dabei hauptsächlich „um den unmittelbaren Genuß des Schönen überhaupt zu thun“ sei (S. 82). Als Maßstab und Richtschnur bei der Beschäftigung mit Poeten der unterschiedlichsten Epochen diente ihm demnach ein über jeden geschichtlichen Wandel erhabenes Ideal dessen, „was schön ist“, und so war sein Verhältnis zur literarischen Überlieferung tatsächlich „mehr ästhetisch als historisch“. Sein Blick auf die Geschichte der Literatur seit der Antike erfasste nicht so sehr spezifische Produkte ganz bestimmter Zeiten und kultureller Formationen, sondern vielfältige Möglichkeiten, Schönes zu gestalten, aus denen er nach seinen eigenen Vorlieben und Bedürfnissen passende Anknüpfungspunkte auswählte.