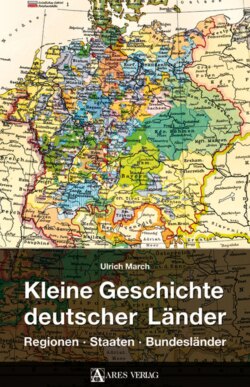Читать книгу Kleine Geschichte deutscher Länder - Ulrich March - Страница 13
C. „Straße der Romanik“
ОглавлениеDer Harz-Mittelelbe-Raum weist im hohen Mittelalter eine kulturelle Dichte auf wie wenige andere Regionen Europas; in ottonisch-salischer Zeit ist sie eine, wenn nicht die Kernlandschaft des Reiches. Hier liegen die Eigengüter des sächsischen Herzogshauses, hier bildet sich im Zuge des Aufstiegs der Dynastie ein immer enger werdendes Netz von Burgen und Pfalzen, Domen und Klöstern, von hier gehen entscheidende Impulse für die Reichspolitik aus, vor allem im Zeitalter Heinrichs I. (919–936) und gegen Ende des 10. Jahrhunderts, als das Reich wegen der Unmündigkeit Ottos III. (1002–1024) von den Kaiserwitwen Adelheid und Theophanu gelenkt wird, ferner unter Otto dem Großen (936–973) und auch noch in salischer Zeit. Die steinernen Zeugen dieser reichsgeschichtlichen Tradition erschließt heute die „Straße der Romanik“, eine vom Land Sachsen-Anhalt eingerichtete Touristenroute; hinzukommen die Baudenkmäler im niedersächsischen und thüringischen Teil des Harzes, allen voran die in Goslar und Nordhausen.
Zentrum der Region ist, in unmittelbarer Nähe der slawischen Siedlungsgrenze an einem seit jeher wichtigen Elbübergang gelegen, bis zum heutigen Tag Magdeburg. Der Ort erfreut sich der besonderen Gunst Ottos des Großen, der hier im Jahre 968 das dritte große Missionserzbistum des Reiches (nach Salzburg und Hamburg) errichtet, das nicht nur auf die Christianisierung der Elb-Oder-Slawen, sondern auch auf die der Polen und Russen abzielt. Das Gebiet westlich der mittleren Elbe wird damit zum Ausgangsraum der hochmittelalterlichen Missions-, Marken- und Siedlungspolitik. Symbol dieser Konzeption ist bis heute der Magdeburger Dom, aber auch viele andere Sakralbauten im Alt- und Neusiedelland, etwa die nahezu unverändert gebliebene Gernroder Stiftskirche, in der die sterblichen Überreste des Markgrafen Gero ruhen, des ersten bedeutenden Verfechters ottonischer Ostpolitik.
Stifterfiguren im Naumburger Dom. Markgraf Ekkehard II. von Meißen, rechts: seine Gemahlin Uta
Die reichs- und kirchenpolitische Entwicklung des Harz-Mittelelbe-Gebiets hat dazu geführt, daß die Bautätigkeit in dieser Region während des gesamten Hochmittelalters nicht abgerissen ist. Das Netz der noch aus dem 9. Jahrhundert stammenden Burgen (Querfurt, Allstedt, Magdeburg, Seeburg, Quedlinburg) wird unter Herzog und König Heinrich systematisch ausgebaut, als Wellenbrecher gegen die Ungarn einerseits, zu Regierungs-, Verwaltungs- und Repräsentationszwecken andererseits. Vielfach stellen diese Burgen, so etwa die Harzburg, die Kristallisationskerne für städtische Siedlungen dar. Besonders eindrucksvoll wirkt heute noch der Quedlinburger Burgberg, wo Heinrich eine der wichtigsten Königspfalzen des Reiches errichtet, in der er sich gerne und häufig aufhält. Unmittelbar nach seinem Tod gründet die Königswitwe Mathilde hier das Frauenstift Servatius, das sie in der Folgezeit als Äbtissin leitet; jeden Tag verweilt sie am Sarkophag ihres Gemahls, der in der Stiftskirche seine letzte Ruhe gefunden hat.
Im Zeitalter der Salier (1024–1125), die als Könige und Kaiser zu ihren fränkischen Besitzungen auch das norddeutsche Königsgut erhalten, verlagert sich das Schwergewicht der politischen Aktivität von Quedlinburg nach Goslar, das zum wichtigsten Stützpunkt der Reichsgewalt im Norden wird. Der weitere Ausbau der Harzregion zu einer geschlossenen Reichslandschaft, vor allem von Konrad II. (1024–1039), Heinrich III. (1039–1056) und Heinrich IV. (1066–1106) mit Nachdruck betrieben, stößt jedoch auf zunehmenden Widerstand des einheimischen Adels, zumal die Reichsburgen sehr häufig mit süddeutschen Rittern besetzt waren.
Nach dem Niedergang der Königsmacht, die sich bereits in staufischer Zeit im Norden nicht mehr so stark geltend macht, errichten im Harz und im benachbarten Unstrut- und Saalegebiet zahlreiche regionale Machthaber Burgen, die sich zu Herrschafts- und Verwaltungszentren entwickeln und die mitunter auch kulturgeschichtliche Bedeutung erlangen. So hat auf Burg Falkenstein Eike von Repgow verkehrt, der Verfasser des Sachsenspiegels, auf Neuenburg der Dichter Heinrich von Veldeke.
In Quedlinburg und in dem bereits 852 gegründeten Stift Gandersheim haben fast ein Jahrtausend lang unverheiratete Damen des niedersächsischen Adels gelebt und gewirkt. Die Äbtissinnen bleiben bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts reichsunmittelbare geistliche Fürstinnen, doch haben beide Abteien keine territorialpolitische Bedeutung erlangt. Die Stiftskirche Quedlinburg stellt in ihrer heutigen Form ein Juwel hochromanischer Baukunst dar; sie enthält reichen Bauschmuck, eine Hallenkrypta aus der Zeit um 1100 und eine wertvolle Schatzkammer. Oberitalienischer Einfluß auf die Architektur ist unverkennbar, ebenso wie bei der im nördlichen Harzvorland gelegenen Kirche von Königslutter. Die kaiserliche Italienpolitik hat, wie nicht nur diese beiden Beispiele zeigen, unter anderem auch kunstgeschichtliche Folgen gehabt, die bis Norddeutschland reichen.
Zum Erzbistum Magdeburg gehören die Bistümer Brandenburg, Havelberg, Merseburg, Meißen und Zeitz-Naumburg. Infolgedessen entstehen im gesamten Bereich der mittleren Elbe repräsentative Dombauten. Dies geschieht, auch in Magdeburg, bereits in ottonischer Zeit, doch sind die Vorgängerbauten der heutigen Dome nur bruchstückhaft erhalten.
Die ältere Geschichte des Erzbistums Magdeburg läßt sich nicht anders als im europäischen Zusammenhang darstellen. Anlaß der Gründung ist die Verbreitung des Christentums in Osteuropa; dabei wirken Kräfte nicht nur aus dem Reich, sondern auch aus Westeuropa mit. Der erste Erzbischof Adalbert, ein Mönch von St. Maximin in Trier, gilt nach seiner Ernennung als „Bischof der Russen“, verfügt aber auch über enge Verbindungen nach Frankreich. St. Maximin ist das Mutterinstitut des Magdeburger Benediktinerklosters St. Mauritius, aus dessen Besitz die Grundausstattung des neuen Erzbistums stammt, und die Trierer Mönche unterhalten lebhafte Beziehungen zur Rhôneregion, wo der Kult des heiligen Mauritius besonders gepflegt wird.
Durch den Slawenaufstand des Jahres 983, den zunehmenden Einfluß der von Byzanz ausgehenden orthodoxen Mission in Rußland und schließlich durch den Verlust des ursprünglich zu Magdeburg gehörenden Bistums Posen und die Gründung eines eigenen polnischen Erzbistums im Jahre 1000 verliert das Elbestift seine von Otto dem Großen festgelegte Bestimmung und einen Großteil seiner Bedeutung. Mit dem Beginn der Ostsiedlung im 12. Jahrhundert erlebt es jedoch noch einmal einen beachtlichen Aufschwung als Ausgangspunkt für die Siedlungsbewegung und für zahlreiche Kirchen- und Klostergründungen. Auch der heutige Magdeburger Dom ist damals entstanden, und zwar unter Erzbischof Adalbert II. (1205–1232), der in Paris studiert hat, ein Kenner der frühen französischen Gotik ist und den neuen Baustil nun erstmals in den Bereich der mittleren Elbe überträgt.
Der Prämonstratenserorden, 1120 von Norbert von Xanten gegründet, nimmt seinen Ausgang vom Kloster „Unserer Lieben Frauen“ in Magdeburg. Er sieht seine Aufgabe vor allem in der Slawenmission und verbreitet sich im gesamten östlichen Mitteleuropa. Seine Kirchen haben etwas Burgenartiges: strenge Baugliederung, hoch aufragendes Westwerk, flankierende Türme. Die Klosterkirche von Jerichow und der Havelberger Dom lassen noch heute etwas von der Gesinnung erahnen, die hinter einer solchen Architektur steht.
Die Kulturleistung Ostsachsens und der Harzlandschaft beschränkt sich aber nicht nur auf Religion, Kunst und Architektur. Bedeutsam sind auch die Literatur und die Geschichtsschreibung, in der ein starkes regionales Identitätsbewußtsein zum Ausdruck kommt. Widukind von Corvey und Thietmar von Merseburg, die Chronisten der ottonischen Zeit, schreiben voller Stolz über die politischen Erfolge Sachsens und seiner Dynastie und fühlen sich in diesem Sinne ganz als Norddeutsche, auch wenn ihre Geschichtsschreibung sich auf das gesamte Reich bezieht. Das gleiche gilt für die Nonne und Dichterin Roswitha von Gandersheim. Sie fühlt sich, wie ihr Gedicht „De gestis imperatoris Ottonis I.“ zeigt, ganz ihrer Heimat und deren großem Sohn verbunden. Sie behandelt aber auch, und zwar auf hohem Niveau, in ihren geistlichen Stücken und in sechs Dramen zahlreiche Gegenstände, die sie als Kennerin der europäischen Geschichte und Literatur ausweisen. Roswitha schreibt in lateinischer Sprache und gilt als herausragende literarische Vertreterin der „ottonischen Renaissance“.
Auch nach dem Ende der ottonischen und der salischen Epoche bleibt der Harz-Elbe-Raum eine wichtige Kulturregion. Bemerkenswert ist hier vor allem der Sachsenspiel Eikes von Repgow, der zum ersten Mal das niederdeutsche Gewohnheitsrecht systematisch darstellt. Von überregionaler Bedeutung ist ferner das Magdeburger Stadtrecht, das die bürgerlich-freiheitliche Stadtverfassung Magdeburgs ebenso widerspiegelt wie das Lübische Recht diejenige Lübecks. Während letztes jedoch auf den Küstenraum der Ostsee beschränkt bleibt, breiten sich das Magdeburger Recht und seine ostpreußische Variante, die „Kulmer Handfeste“, bis über die Weichsel nach Osten hin aus. Das Magdeburger Recht ist damit ein bedeutendes Phänomen der europäischen Stadtkultur.
All dies kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die wirklich große Zeit der Region mit dem Ende der ottonischen Dynastie vorbei ist. Nie wieder sind Orte wie Quedlinburg und Magdeburg die Zentren deutscher und europäischer Politik gewesen, nie wieder werden Rang und Rolle des Magdeburger Erzstifts von den Menschen so hoch eingeschätzt wie in der Zeit Ottos des Großen und des ersten „Bischofs der Russen“. Zwar behält die Stadt Magdeburg als wichtigster Elbübergang für den Handelsverkehr in West-Ost-Richtung große Bedeutung, doch auch damit ist es nach der nahezu totalen Zerstörung der Stadt im Dreißigjährigen Krieg vorbei. Erst seit dem 18. Jahrhundert gewinnt Magdeburg wieder eine gewisse Bedeutung: als wichtigste Festung im Westen des Königreichs Preußen, als Verwaltungs- und Industriestadt. Heute ist Magdeburg Hauptstadt des wieder errichteten Landes Sachsen-Anhalt, doch ist das alte Stadtbild durch die Zerstörungen des Dreißigjähren Krieges und des Zweiten Weltkrieges unwiderruflich zerstört.